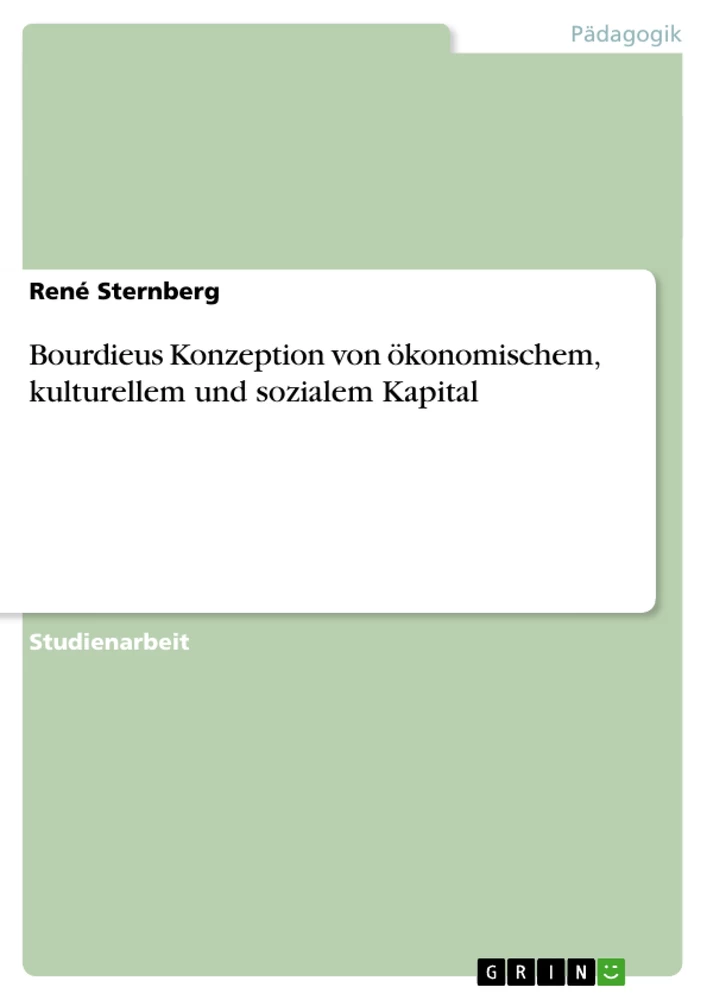Wissen hat eine immer größere Bedeutung, denn es ist ein Wettbewerbsvorteil. Die Zukunft wird die Verbindung von Wissen- und Beziehungsentwicklung verlangen, um den Wettbewerbsvorteil zu sichern.1 Auf den ersten Blick wird eventuell nicht deutlich, was Wissen mit Beziehungen zu tun hat. Diese Wechselbeziehung wird offensichtlicher, wenn man sich folgende Frage vergegenwärtigt. Wie kann man Humankapital in Aufstiegschancen umsetzen? In der Theorie des sozialen Kapitals, beeinflusst das soziale Kapital den Ertrag des finanziellen Kapitals (ökonomisches Kapital) und des Humankapitals (Kulturkapital). Dies bedeutet, dass Menschen aus ihrem finanziellen und ihrem Humankapital nur das Optimum an Erträgen erzielen können, wenn sie genügend soziales Kapital besitzen. Aber was sind soziales und kulturelles Kapital und wie können sie effektiv akquiriert bzw. angewendet werden?
Um diese Fragen und die Bedeutung der Beziehungen für das Wissen zu klären, möchte ich in meiner Arbeit die Kapital-Theorie von Pierre Bourdieu darlegen. Dabei werde ich hauptsächlich auf Bourdieus Text „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“ eingehen, welches im Sonderband „Soziale Ungleichheiten“ (Hg. Reinhard Kreckel) veröffentlicht wurde. Bourdieu möchte in seiner Arbeit alle Erscheinungsformen von Kapital und Profit beschreiben und Gesetze bestimmen, wie die Transformation zwischen den Kapitalsorten verläuft.2 Im laufe der Arbeit werde ich anhand von Beispielen verdeutlichen, was die einzelnen Kapitalsorten sind. Dabei wird u.a. veranschaulicht, warum es nicht so ist, dass alle Kinder die gleichen Bildungs- und Aufstiegschancen haben, obwohl das deutsche Schulsystem diese Chancengleichheit oberflächlich suggeriert.
Um diese Punkte zu klären, werde ich zunächst ausführen, was soziales Kapital ist und dann die Boudieuschen Kapitalsorten erläutern. Anschließend werde ich auf die Arbeit in Beziehungsnetzen und auf die Kapitalumwandlung eingehen. Zum Schluss werde ich kurz auf Kritikpunkte an der Theorie von Bourdieu und eine Ergänzung anbringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziales Kapital
- 3. Die Kapital-Theorie von Pierre Bourdieu
- 3.1. Kulturelles Kapital
- 3.1.1. Inkorporiertes Kapital
- 3.1.2. Objektiviertes Kapital
- 3.1.3. Institutionalisiertes Kulturkapital
- 3.2. Soziales Kapital
- 3.3. Beziehungsnetz und Beziehungsarbeit
- 3.4. Kapitalumwandlung
- 3.1. Kulturelles Kapital
- 4. Kritik und Ergänzung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Pierre Bourdieus Kapitaltheorie, insbesondere die Konzepte von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Kapitalformen für Bildungs- und Aufstiegschancen zu verdeutlichen und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Kapitalarten aufzuzeigen.
- Die Definition und Bedeutung sozialen Kapitals
- Bourdieus Trias von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital
- Der Einfluss von Kapital auf Bildungschancen und sozialen Aufstieg
- Die Umwandlung von Kapitalarten und ihre Dynamik
- Kritikpunkte an Bourdieus Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die wachsende Bedeutung von Wissen und Beziehungen für den Wettbewerbsvorteil. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Umsetzung von Humankapital in Aufstiegschancen und der Rolle des sozialen Kapitals dabei. Die Arbeit wird als eine Auseinandersetzung mit Bourdieus Kapitaltheorie angekündigt, die die verschiedenen Kapitalformen und ihre Transformationsprozesse beleuchten soll, um die Ungleichheit von Bildungs- und Aufstiegschancen im deutschen Schulsystem zu erklären. Die einzelnen Kapitel und ihr Aufbau werden kurz umrissen.
2. Soziales Kapital: Dieses Kapitel definiert soziales Kapital nach Littmann-Wernli und Scheidegger als die Summe der durch soziale Beziehungen zugänglichen Ressourcen. Es wird herausgestellt, dass soziales Kapital im Gegensatz zu ökonomischem und kulturellem Kapital nicht greifbar, sondern in Beziehungen verankert ist und keinen eindeutigen Eigentumsstatus besitzt. Das Kapitel diskutiert die Chancen und Einschränkungen, die mit der Nutzung sozialen Kapitals verbunden sind, wobei der Aspekt von Zeitaufwand, Kosten und normativen Erwartungen innerhalb von Beziehungen besonders hervorgehoben wird. Die Bedeutung des sozialen Netzwerkes und die Position des Individuums darin werden ebenfalls erörtert.
3. Die Kapital-Theorie von Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel stellt Bourdieus Theorie der Kapitalsorten vor. Es differenziert zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Ökonomisches Kapital wird als direkt konvertierbare Ressource (Geld, Aktien etc.) definiert, während kulturelles Kapital als verinnerlichtes Wissen, durch Schulabschlüsse etc. repräsentiert, erläutert wird. Das Kapitel hebt die Bedeutung der Kapitalstruktur für die soziale Stellung eines Individuums hervor und betont, dass die Zusammensetzung und Gewichtung der verschiedenen Kapitalarten die Erfolgschancen beeinflussen. Es wird die Konvertierbarkeit der Kapitalarten angesprochen und die Dominanz des ökonomischen Kapitals relativiert, in dem die Notwendigkeit der Transformationsarbeit betont wird.
3.1. Kulturelles Kapital: Dieser Unterabschnitt befasst sich detailliert mit Bourdieus Konzept des kulturellen Kapitals. Er erklärt, wie Bourdieu den Begriff des kulturellen Kapitals nutzte, um unterschiedliche schulische Leistungen verschiedener Klassen zu erklären, und wie das im Gegensatz zu der Annahme stand, dass schulischer Erfolg ausschließlich auf individuelle Fähigkeiten zurückzuführen sei. Die verschiedenen Formen des kulturellen Kapitals (inkorporiert, objektiviert und institutionalisiert) werden wohl auch in diesem Abschnitt erläutert, jedoch ohne detaillierte Zusammenfassung, da die Anweisung lautet, keine Unterkapitel zusammenzufassen.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Kapitaltheorie, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, Bildungschancen, Aufstiegschancen, soziale Ungleichheit, Beziehungsnetzwerke, Kapitalumwandlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pierre Bourdieus Kapitaltheorie und ihre Bedeutung für Bildungs- und Aufstiegschancen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Pierre Bourdieus Kapitaltheorie, insbesondere die Konzepte von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital, und deren Einfluss auf Bildungs- und Aufstiegschancen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interdependenz der verschiedenen Kapitalarten und deren Umwandlungsprozessen.
Welche Kapitalformen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die drei zentralen Kapitalformen nach Bourdieu: ökonomisches Kapital (Geld, Vermögen), kulturelles Kapital (verinnerlichtes Wissen, Bildungsabschlüsse) und soziales Kapital (Ressourcen durch soziale Beziehungen). Innerhalb des kulturellen Kapitals werden die Unterformen inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes Kapital unterschieden.
Wie definiert die Arbeit soziales Kapital?
Soziales Kapital wird, angelehnt an Littmann-Wernli und Scheidegger, als die Summe der durch soziale Beziehungen zugänglichen Ressourcen definiert. Es wird betont, dass soziales Kapital im Gegensatz zu ökonomischem und kulturellem Kapital nicht greifbar ist, sondern in Beziehungen verankert liegt und keinen eindeutigen Eigentumsstatus besitzt.
Welche Rolle spielt die Kapitalumwandlung?
Die Arbeit hebt die Bedeutung der Kapitalumwandlung hervor. Die verschiedenen Kapitalformen sind nicht statisch, sondern können ineinander umgewandelt werden. Diese Transformationsprozesse sind entscheidend für die Bildungs- und Aufstiegschancen von Individuen. Die Dominanz des ökonomischen Kapitals wird dabei relativiert, da die Notwendigkeit der Transformationsarbeit betont wird.
Wie wird der Einfluss von Kapital auf Bildungs- und Aufstiegschancen dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Zusammensetzung und Gewichtung der verschiedenen Kapitalformen die Erfolgschancen von Individuen im Bildungssystem und beim sozialen Aufstieg beeinflussen. Der Besitz von Kapital, insbesondere kulturellem Kapital, wird als ein wichtiger Faktor für den schulischen Erfolg dargestellt. Die Arbeit erklärt schulische Leistungen verschiedener Klassen durch die unterschiedliche Ausstattung mit kulturellem Kapital.
Welche Kritikpunkte an Bourdieus Theorie werden angesprochen?
Die Arbeit erwähnt Kritikpunkte an Bourdieus Theorie, geht aber nicht im Detail darauf ein. Ein separates Kapitel ist der Kritik und Ergänzung von Bourdieus Theorie gewidmet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Soziales Kapital, Die Kapital-Theorie von Pierre Bourdieu (inkl. Unterkapitel zum kulturellen Kapital), Kritik und Ergänzung und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel definiert soziales Kapital. Kapitel drei erklärt Bourdieus Kapitaltheorie detailliert. Die Kapitel vier und fünf bieten eine kritische Auseinandersetzung und ein zusammenfassendes Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pierre Bourdieu, Kapitaltheorie, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, Bildungschancen, Aufstiegschancen, soziale Ungleichheit, Beziehungsnetzwerke, Kapitalumwandlung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Kontext von sozialer Ungleichheit und Bildungschancen. Die OCR-Daten sind ausschließlich für akademische Zwecke bestimmt.
- Quote paper
- René Sternberg (Author), 2004, Bourdieus Konzeption von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34906