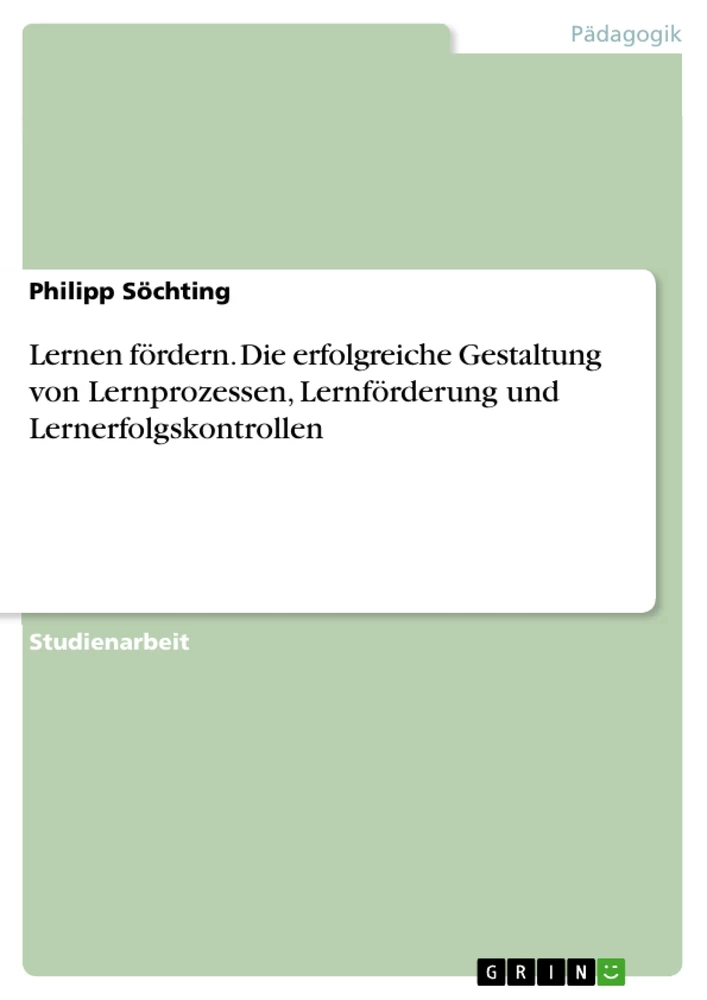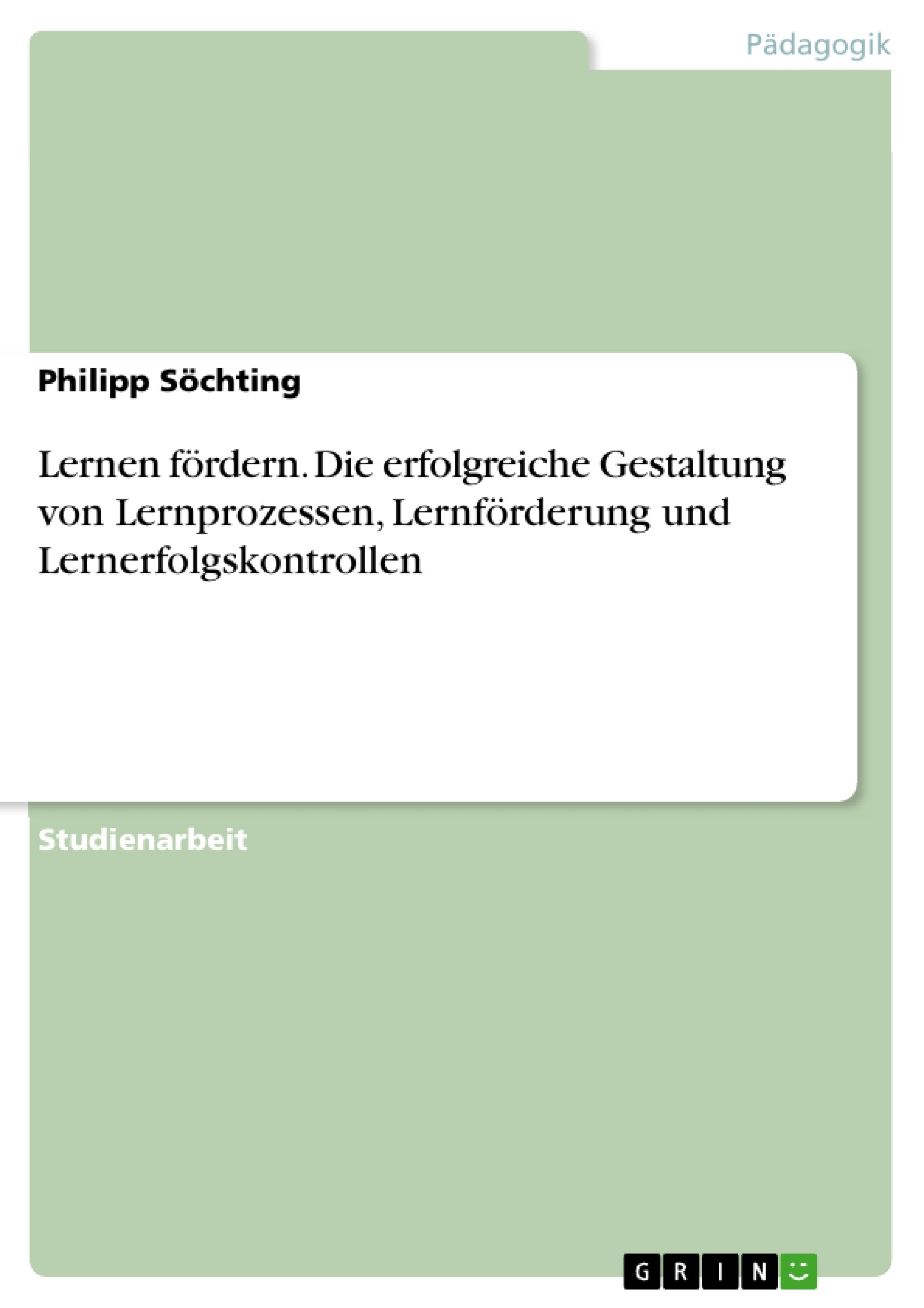Der Ausbildung von jungen Menschen wird heutzutage eine Bedeutung beigemessen, wie niemals zuvor in unserer Gesellschaft. Nachdem in den vergangenen Jahren die demographische Entwicklung unserer Bevölkerung in den Vordergrund getreten ist, wird immer wieder der Ruf nach gut ausgebildeten Fachkräften aus Wirtschaft und Politik vernommen.
Und diese Fachkräfte der Zukunft müssen zwangsläufig durch unsere heutige Jugend gestellt werden, egal ob im Handwerk, der Industrie oder dem Dienstleistungssektor.
Doch besonders im Handwerk und der Industrie, welche in der Vergangenheit eine tragende Rolle in unserer Volkswirtschaft übernommen haben, steigt das Unbehagen über den neuen Nachwuchs. Hier wird von Seiten der Unternehmen vor allem die schulische Vorbildung sowie das Engagement und die Eigeninitiative der Jugendlichen bemängelt.
Diese Hausarbeit setzt sich thematisch mit den Gebieten Lernprozesse, Lernförderung und Lernerfolgskontrollen auseinander. Der Fokus liegt hierbei auf der Ausbildung von Jugendlichen und jungen Menschen.
Jedoch ist diese Hausarbeit als keine politische Streitschrift über die Grundlagen der Schulbildung in Deutschland zu verstehen. Vielmehr soll sie eine praktische Anwendung bei den Ausbildern in den Ausbildungsunternehmen finden. Die Hausarbeit soll da ansetzen, wo es laut der Rückmeldung aus der Wirtschaft am dringendsten nötig ist, am ersten Tag der Ausbildung vor Ort.
Somit besteht die Zielsetzung dieser Hausarbeit darin, den Ausbildern in der Praxis eine Hilfestellung zu geben. Damit diese die Jugendlichen und besonders deren Lernprozesse nicht nur verstehen, sondern auch fördern. Selbst wenn wir uns momentan an einem unglücklichen Ausgangspunkt für die Ausbildung unserer zukünftigen Fachkräfte befinden, sollte das vorhandene Potential bestmöglich genutzt werden. Somit kommt auch den Ausbildern in der Zukunft eine ganz neue Bedeutung zu. Galten diese in der Vergangenheit eher als zweitrangig und wurden oft auf die reine „Betreuung“ der Jugendlichen in den Unternehmen reduziert, wandeln sie sich momentan zu wichtigen Schlüsselpositionen mit enormen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Ausbildungsbetriebe.
Die "Ressource" Mensch hat sich zur wichtigsten Ressource deutscher Unternehmen entwickelt. Diese Hausarbeit soll Ihnen als Ausbilder die richtigen Instrumente an die Hand geben, damit Sie diese Ressource optimal nutzen und somit die Zukunft Ihrer Auszubildenden und Unternehmen sichern können.
Inhaltsverzeichnis
- Lernprozesse
- Was ist Lernen?
- Grundlagen der Lernpsychologie
- Lernbereiche
- Lernkanäle
- Wahrnehmungstypen
- Lerntheorien
- Lernprozesse
- Besonderheiten des Lernens bei Jugendlichen
- Die Entwicklung von Jugendlichen
- Entwicklungsphasen
- Auswirkungen auf die Umwelt
- Entwicklung und Ausbildung
- Lebenslanges Lernen
- Erwachsenenbildung
- Besonderheiten des Lernens bei älteren Menschen
- Lernförderung
- Was ist Motivation?
- Extrinsische und intrinsische Motivation
- Bedürfnisse als Grundlage von Zielen
- Motivation durch zielerreichendes Lernen
- Lernziele
- Lernzielarten
- Lernerfolgskontrollen
- Was ist Lernerfolg?
- Lernerfolgskontrollen
- Anforderungen an Lernerfolgskontrollen
- Möglichkeiten der Messung von Lernerfolg
- Zwischen- und Abschlussprüfung
- Die Zwischenprüfung
- Konsequenzen aus der Zwischenprüfung
- Die Abschlussprüfung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Themen Lernprozesse, Lernförderung und Lernerfolgskontrollen im Kontext der Ausbildung von Jugendlichen. Sie zielt darauf ab, Ausbildern in der Praxis eine Hilfestellung zu geben, um die Lernprozesse ihrer Auszubildenden besser zu verstehen und zu fördern.
- Die Bedeutung von Lernprozessen und deren Einfluss auf die Ausbildungserfolge
- Die Rolle der Lernförderung und die Gestaltung von motivierenden Lernumgebungen
- Die Bedeutung von Lernerfolgskontrollen als Instrument der Leistungsbewertung und der Optimierung von Lernprozessen
- Die Herausforderungen der Ausbildung von Jugendlichen im aktuellen Bildungssystem
- Die Rolle des Ausbilders als Schlüsselfigur in der erfolgreichen Ausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Grundlagen des Lernens, wobei verschiedene Lerntheorien und Lernprozesse erläutert werden. Besonderheiten des Lernens bei Jugendlichen, insbesondere ihre Entwicklungsphasen und Auswirkungen auf die Umwelt, werden ebenfalls betrachtet.
Kapitel zwei befasst sich mit dem Thema Lernförderung, wobei Motivation als Schlüsselfaktor für den Lernerfolg hervorgehoben wird. Es werden verschiedene Arten von Motivation und die Bedeutung von Bedürfnissen und Zielen für den Lernprozess beleuchtet.
Das dritte Kapitel behandelt Lernerfolgskontrollen, wobei verschiedene Methoden zur Messung von Lernerfolg und die Anforderungen an Lernerfolgskontrollen vorgestellt werden. Zwischen- und Abschlussprüfungen werden als wichtige Instrumente der Leistungsbewertung und der Lernprozessoptimierung betrachtet.
Schlüsselwörter
Lernprozesse, Lernförderung, Lernerfolgskontrollen, Jugendliche, Ausbildung, Motivation, Lernziele, Lernerfolg, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, Ausbilder, Entwicklungsphasen, Lerntheorien, Bedürfnisse, Erfolgskontrollen.
- Quote paper
- Philipp Söchting (Author), 2013, Lernen fördern. Die erfolgreiche Gestaltung von Lernprozessen, Lernförderung und Lernerfolgskontrollen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350470