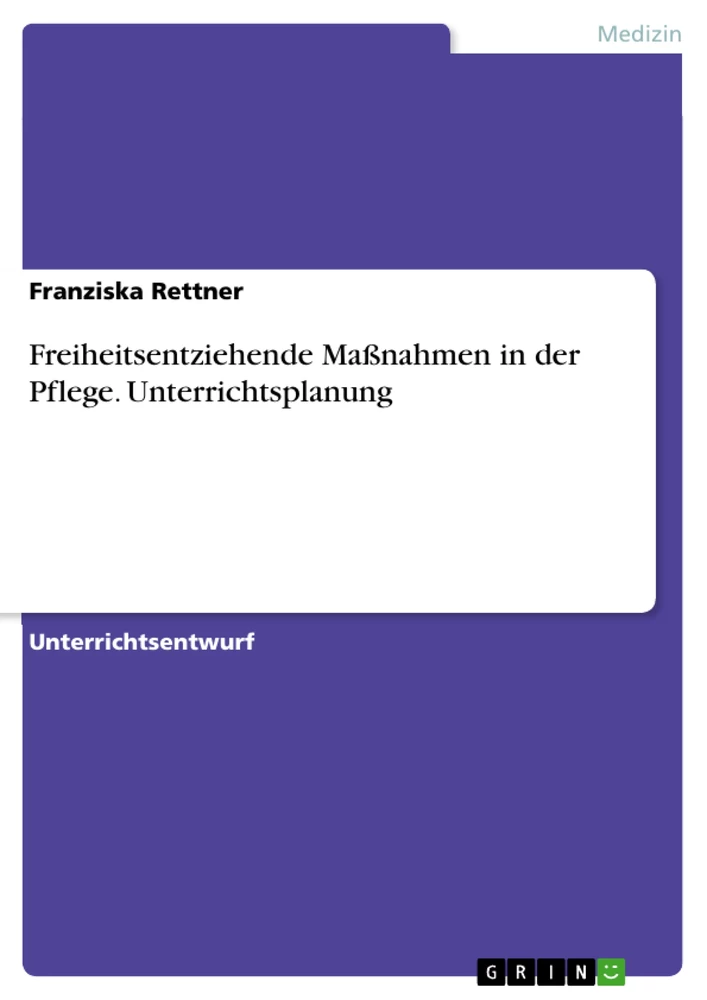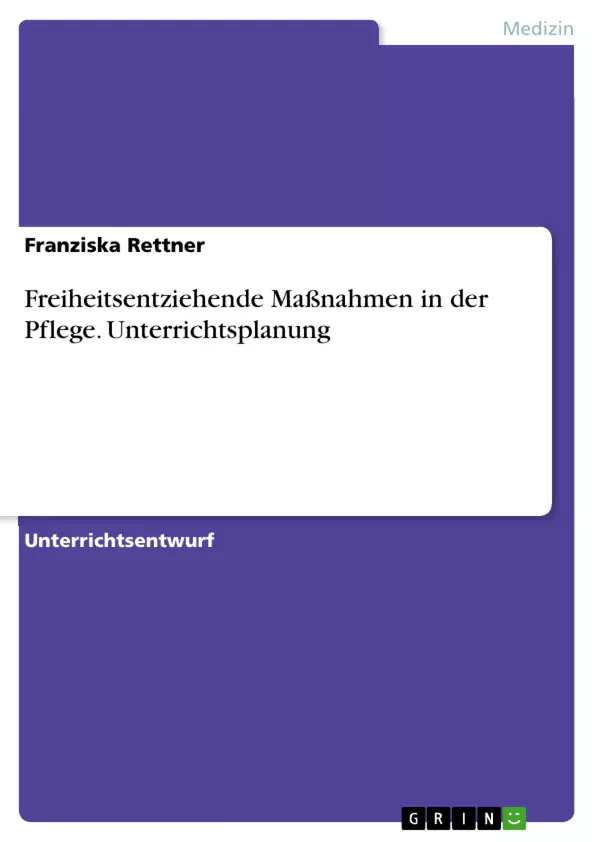Das Thema „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ (folgend als FEM abgekürzt) gehört zum Lernmodul 14a/b „Pflegehandeln an ethischen Prinzipien ausrichten und verantworten“, das innerhalb des zweiten Lehrjahres einer Krankenpflegeausbildung vermittelt werden soll. Im schuleigenen Curriculum der Pflegeschule werden folgende Inhalte aufgeführt: rechtliche und ethische Aspekte sowie Formen und Umsetzung der FEM welche in 52 Unterrichtsstunden á 45 min vermittelt werden sollen. Die genauere Ausdifferenzierung der Inhalte obliegt dabei der Lehrkraft. Diese Unterrichtsreihe hat den Schwerpunkt Freiheitsentziehende Maßnahmen.
Dieser Unterricht ist geplant und ausgerichtet nach Darmann-Finck. Das Artikulationsschema ist am Studiensemniar Neuwied (Rheinland-Pfalz) orientiert.
Der Unterricht ist auf eine Krankenpflegeklasse im 2. Ausbildungsjahr ausgerichtet und beinhaltet eine Filmsequenz (als Fallsituation), eine praktische Leibesübung, einen Grundlagenteil für Informationsweitergabe sowie eine Diskussionsrunde zum Thema FEM.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Mein Konzept
- 2 Bedingungsfeldanalyse
- 2.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
- 2.2 Die Lerngruppe
- 3 Verortung des Unterrichtsversuchs und Curriculare Bezugspunkte
- 4 Didaktische Analyse
- 4.1 Allgemeindidaktische Leitfragen nach Klafki
- 4.2 Fachdidaktische Analyse und Strukturierung
- 4.3 Intentionen - Kompetenzen
- 4.4 Methodisch - didaktische Analyse
- 4.5 Didaktische Reduktion
- 5 Stundenverlauf, Artikulationsschema
- 6 Reflexion
- 7 Literatur
- 8 Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtsplanung beschreibt ein Lernmodul zum Thema freiheitsentziehende Maßnahmen im Kontext der Pflege. Ziel ist es, die zukünftigen Pflegekräfte zu befähigen, ihr Handeln an ethischen Prinzipien auszurichten und zu verantworten. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit Argumenten rund um freiheitsentziehende Maßnahmen und der Entwicklung eines eigenen, fundierten Standpunktes.
- Ethische Prinzipien im Pflegehandeln
- Freiheitsentziehende Maßnahmen: Argumente und ethische Implikationen
- Reflexion des eigenen Handelns und die Verantwortung gegenüber Patient*innen
- Entwicklung professioneller Handlungskompetenz
- Praxisnaher Bezug und Theorie-Praxis-Transfer
Zusammenfassung der Kapitel
1 Mein Konzept: Dieses Kapitel beschreibt das pädagogische Konzept der Autorin für den Unterricht. Im Mittelpunkt stehen Werte wie Wertschätzung, Transparenz, eine positive Fehlerkultur, Lebensweltbezug und Autonomie der Schüler*innen. Die Autorin betont die Wichtigkeit eines kollegialen Umgangs mit den Schüler*innen, die Offenlegung von Lernzielen, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und den Einbezug der Lebenswelt der Schüler*innen in den Unterricht. Der Fokus liegt auf der Förderung der Handlungskompetenz und der Entwicklung mündiger, professioneller Pflegekräfte, die ihr Handeln stets reflektieren und das Wohl des Patienten im Blick haben. Die Betonung der Praxisnähe und des Theorie-Praxis-Transfers wird deutlich.
2 Bedingungsfeldanalyse: Dieses Kapitel analysiert die institutionellen Rahmenbedingungen des Unterrichts. Es beschreibt die Krankenpflegeschule, ihre Anbindung an ein städtisches Klinikum und die Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis. Die Struktur der Schule, die Ausbildungsgänge und der Schwerpunkt der Klinik werden erläutert. Das Leitbild der Pflegeschule mit dem Fokus auf umfassende Handlungskompetenz und die Offenheit für Innovation werden hervorgehoben. Schließlich werden die Lehrpersonen und ihre unterschiedlichen Qualifikationen vorgestellt, wobei die Zusammenarbeit zwischen festen Lehrkräften und Gastdozenten deutlich wird.
Schlüsselwörter
Freiheitsentziehende Maßnahmen, Pflegeethik, Handlungskompetenz, Reflexion, professionelles Handeln, Patientenwohl, Praxisbezug, Didaktik, Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsplanung: Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Pflege
Was ist der Gegenstand dieser Unterrichtsplanung?
Die Unterrichtsplanung beschreibt ein Lernmodul zum Thema freiheitsentziehende Maßnahmen im Kontext der Pflege. Ziel ist die Befähigung zukünftiger Pflegekräfte zu ethisch fundiertem und verantwortungsvollem Handeln.
Welche Themen werden im Modul behandelt?
Das Modul behandelt ethische Prinzipien im Pflegehandeln, freiheitsentziehende Maßnahmen mit ihren Argumenten und ethischen Implikationen, die Reflexion des eigenen Handelns und die Verantwortung gegenüber Patient*innen, die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz sowie den Praxisbezug und Theorie-Praxis-Transfer.
Wie ist die Unterrichtsplanung strukturiert?
Die Planung umfasst ein Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln zu Konzeptbeschreibung, Bedingungsfeldanalyse (institutionelle Rahmenbedingungen und Lerngruppe), Verortung im Curriculum, didaktische Analyse (inkl. Leitfragen nach Klafki, fachdidaktische Analyse, Intentionen/Kompetenzen, methodisch-didaktische Analyse und didaktische Reduktion), Stundenverlauf, Reflexion, Literatur und Anlagen.
Was ist das pädagogische Konzept der Autorin?
Das Konzept basiert auf Wertschätzung, Transparenz, positiver Fehlerkultur, Lebensweltbezug und Autonomie der Schüler*innen. Es betont kollegialen Umgang, Offenlegung von Lernzielen, konstruktiven Umgang mit Fehlern und Einbezug der Lebenswelt. Der Fokus liegt auf der Förderung der Handlungskompetenz und der Entwicklung mündiger, professioneller Pflegekräfte.
Wie wird die Bedingungsfeldanalyse durchgeführt?
Die Bedingungsfeldanalyse untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen (Krankenpflegeschule, Anbindung an Klinikum, Zusammenarbeit Theorie/Praxis, Schulstruktur, Ausbildungsgänge, Leitbild der Schule, Lehrpersonen und deren Qualifikationen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Freiheitsentziehende Maßnahmen, Pflegeethik, Handlungskompetenz, Reflexion, professionelles Handeln, Patientenwohl, Praxisbezug, Didaktik, Unterricht.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es werden Zusammenfassungen für "Mein Konzept" (pädagogisches Konzept der Autorin mit Fokus auf Werte und Handlungskompetenz) und "Bedingungsfeldanalyse" (Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen der Krankenpflegeschule) bereitgestellt.
Welches Ziel verfolgt die Unterrichtsplanung?
Ziel ist die Entwicklung von Handlungskompetenz bei zukünftigen Pflegekräften, die ihr Handeln an ethischen Prinzipien ausrichten und verantwortungsbewusst reflektieren können, insbesondere im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen.
- Quote paper
- Franziska Rettner (Author), 2016, Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Pflege. Unterrichtsplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350520