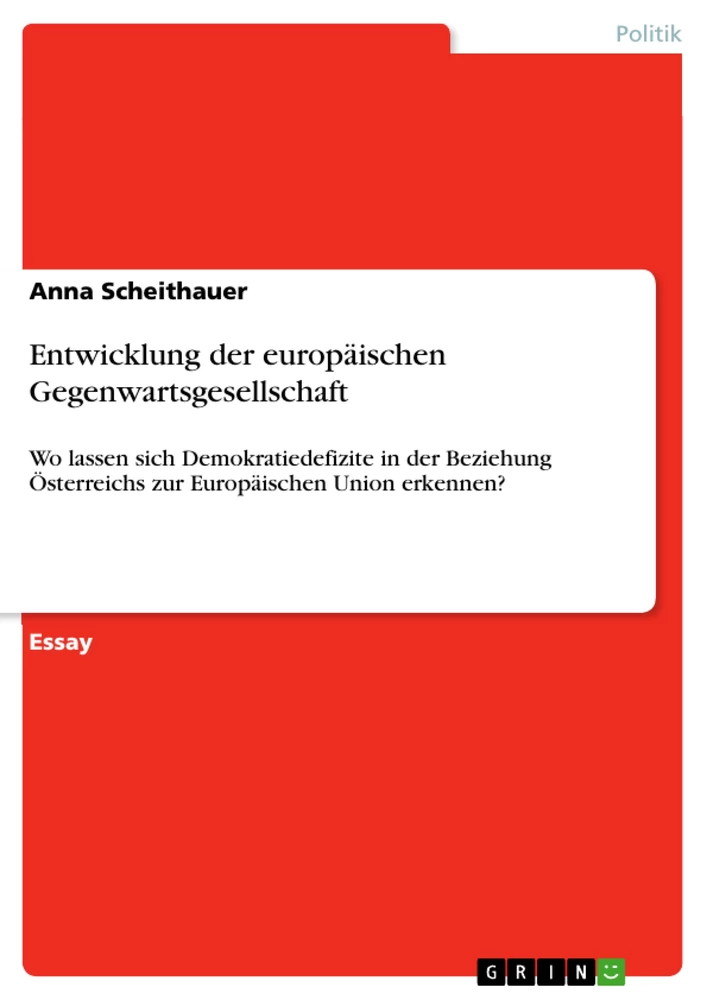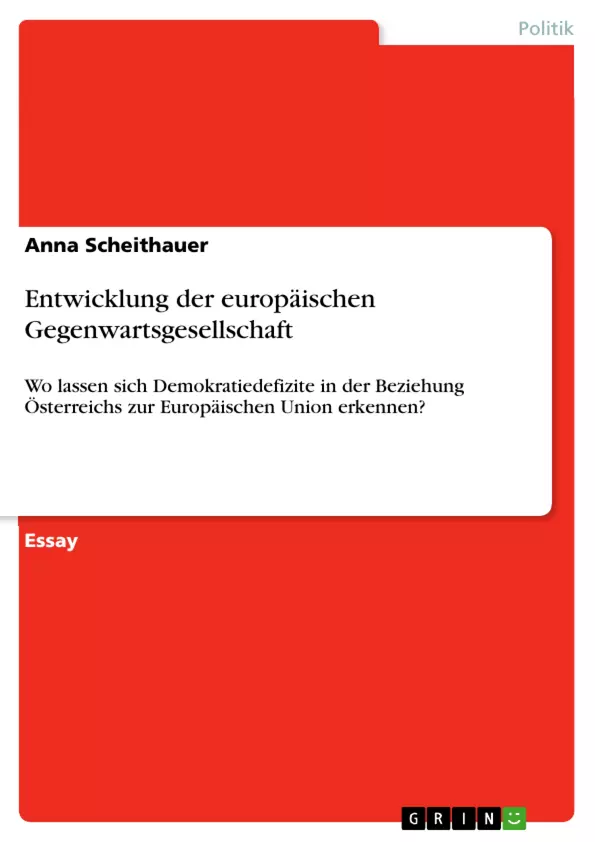Mit 1. Januar 1995 wurde Österreich in die supranationale Gemeinschaft der Europäischen Union aufgenommen, welche zur unweigerlichen Folge hatte, dass mit dieser Mitgliedschaft fortan das Gemeinschaftsrecht speziellen Vorrang vor dem staatlichen Recht genießt. Dieser Aspekt wird als Ausgangspunkt für die Arbeit dienen, welche partikulär auf die demokratiedefizitären Komponenten in der wechselseitigen Beziehung Österreichs zur EU aufmerksam macht.
Dabei wird vor allem auf die Auswirkung des EU Beitritts auf das bundesstaatliche, das demokratische und das rechtsstaatliche Prinzip der österreichischen Verfassungen näher eingegangen, welche unter anderem auch die Frage nach dem Korporatismus auf EU-Ebene aufwirft und die Folgewirkungen für die österreichische Sozialpartnerschaft ins Auge fasst. Anschließend werden die Kontroversen der Legitimität der Europawahlen, als auch in diesem Zusammenhang das Parteiensystem und die Rolle der Öffentlichkeit hinsichtlich der Problematik der unzureichenden Politisierung in der Europäischen Union erläutert. Weiters wird insbesondere das "doppelte Demokratiedefizit", welches die Problematik der Kontroll- und Legislativbefugnisse des österreichischen Nationalrates in EU-Angelegenheiten widerspiegelt, hervorgehoben. Abschließend sollen dabei werden auch die demokratieproblematischen Gesichtspunkte der entscheidenden EU-Institutionen – dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Rates – sofern sie hinsichtlich der Beziehung zu Österreich relevant sind, unter Betracht gezogen.
Generell möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass der Beitritt zur Europäischen Union durchwegs als positiver Schritt in Richtung eines integrierten Europas zu betrachten ist und die Ausarbeitung daher einzig und allein die Thematik des Demokratiedefizits zu Grunde hat, um die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit von Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich demokratischer Grundprinzipien zu lenken.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das Demokratiedefizit
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht das Demokratiedefizit in der Beziehung Österreichs zur Europäischen Union. Sie fokussiert auf die Folgen des EU-Beitritts für die österreichische Verfassung und die Funktionsweise der österreichischen Demokratie.
- Die Auswirkung des EU-Beitritts auf das bundesstaatliche, das demokratische und das rechtsstaatliche Prinzip der österreichischen Verfassung
- Die Rolle der Sozialpartner im Kontext des EU-Rechts
- Das Problem der Politisierung und die eingeschränkten Wahlmöglichkeiten in der Europäischen Union
- Das "doppelte Demokratiedefizit" in Bezug auf die Kontroll- und Legislativbefugnisse des österreichischen Nationalrats
- Die demokraitieproblematischen Gesichtspunkte der wichtigsten EU-Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Bedeutung des EU-Beitritts für Österreich und erläutert den Schwerpunkt der Untersuchung: das Demokratiedefizit.
- Das Demokratiedefizit: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des EU-Rechts auf die österreichische Verfassung und die Funktionsweise der österreichischen Demokratie. Es beleuchtet die Herausforderungen für das bundesstaatliche Prinzip, das demokratische Prinzip und das rechtsstaatliche Prinzip, sowie die Auswirkungen auf die Sozialpartner und die Politisierung der EU.
Schlüsselwörter (Keywords)
Demokratiedefizit, Europäische Union, Österreich, EU-Beitritt, Verfassung, Bundesstaat, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialpartner, Politisierung, Europawahlen, Europäisches Parlament, Europäische Kommission, Rat der Europäischen Union, Europäischer Rat, Kontroll- und Legislativbefugnisse, Nationalrat.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Demokratiedefizit" im Kontext Österreichs?
Es bezeichnet die Schwächung demokratischer Prinzipien durch die Übertragung von Kompetenzen an die EU, wodurch die direkte Mitwirkung der Bürger und des Nationalrates eingeschränkt wird.
Wie beeinflusste der EU-Beitritt die österreichische Verfassung?
Der Beitritt hatte massive Auswirkungen auf das bundesstaatliche, das demokratische und das rechtsstaatliche Prinzip, da Gemeinschaftsrecht nun Vorrang vor staatlichem Recht genießt.
Was ist das "doppelte Demokratiedefizit"?
Es beschreibt die Problematik, dass der österreichische Nationalrat in EU-Angelegenheiten nur unzureichende Kontroll- und Legislativbefugnisse hat, was die parlamentarische Kontrolle schwächt.
Welche Rolle spielen die Sozialpartner auf EU-Ebene?
Die Arbeit untersucht, wie der Korporatismus auf EU-Ebene funktioniert und welche Folgewirkungen dies für die traditionelle österreichische Sozialpartnerschaft hat.
Warum wird die Politisierung in der EU als unzureichend kritisiert?
Aufgrund mangelnder öffentlicher Debatten und eingeschränkter Wahlmöglichkeiten bei Europawahlen findet eine echte politische Auseinandersetzung auf EU-Ebene kaum statt.
Welche EU-Institutionen stehen im Fokus der Kritik?
Die Untersuchung betrachtet kritisch das Europäische Parlament, die Europäische Kommission sowie den Rat der Europäischen Union und den Europäischen Rat.
- Arbeit zitieren
- Anna Scheithauer (Autor:in), 2010, Entwicklung der europäischen Gegenwartsgesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350706