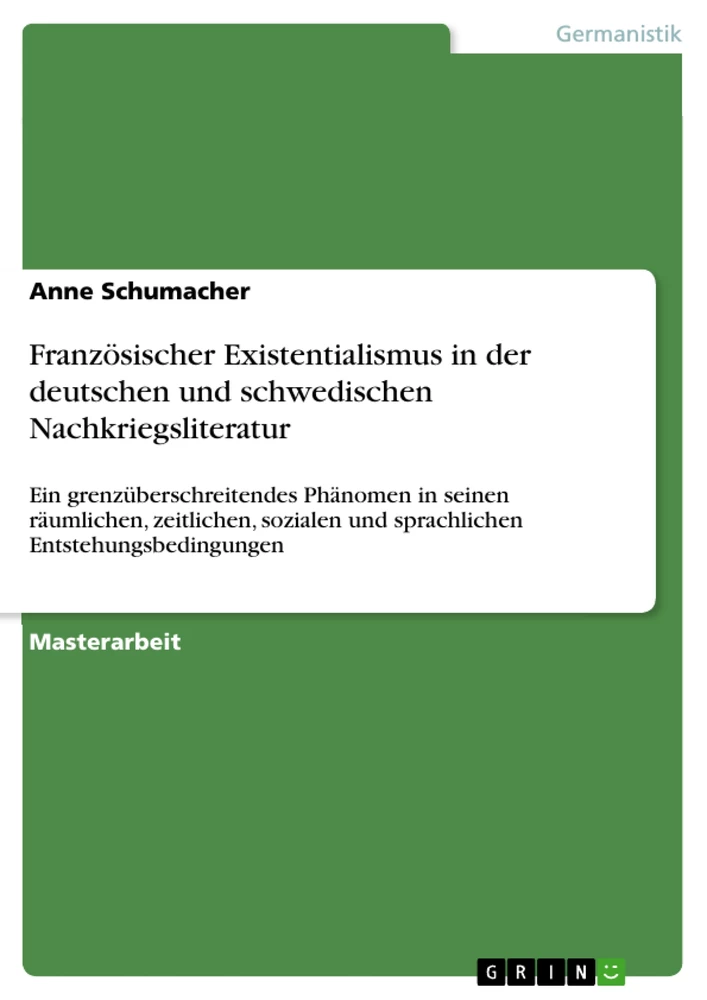Im Verlaufe der Arbeit wird untersucht werden inwiefern der französische Existentialismus die literarischen Motivkreise, die Stoffe und auch den Schreibgestus in Schweden und Deutschland nach 1945 beeinflusste. Dabei orientiert sich die hier vorliegende Arbeit an der Internationalität von Literatur, die sich auf die Intertextualität des literarischen Austausches beruft und sich mit der Frage danach befasst, weshalb der französische Existentialismus auch in der schwedischen und deutschen Literatur wirken konnte. Interdisziplinäre Berührungspunkte zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Soziologie und Philosophie sollen beleuchtet werden. Es wird angestrebt die Rezeption des französischen Existentialismus im Kontext der verschiedenen Nationen, beziehungsweise vor einem nationalspezifischen historischen Hintergrund, darzustellen, den Einfluss auf schwedische und deutsche Autoren deutlich zu machen und diese zu vergleichen. Untersucht werden gemeinsame Stoffe, Motive und Themen, sowie die zeitlichen Aspekte des Rezeptionsverlaufs.
Zunächst werden zu diesem Zweck die nationalspezifischen Kontexte Schwedens und Deutschlands beleuchte. Später wird an verschiedenen Werkanalysen deutscher und schwedischer Autoren exemplarisch dargestellt, ob und inwiefern der französische Existentialismus direkt oder indirekt seinen Ausdruck in den literarischen Werken fand. Die hier analysierten schwedischen und deutschen Werke erstrecken sich, bis auf eine Ausnahme, über den Zeitraum 1946 bis 1963, also jenem Zeitabschnitt, in welchem insbesondere die zumeist politisch links orientierten jungen Autoren in Schweden und Deutschland einer vom französischen Existentialismus inspirierten sozial engagierteren Literatur vorstanden. Dieser Zeitraum bietet sich als Untersuchungsabschnitt an, da erst Ende der 60er ein „durch die Studentenrevolte ausgelöste[r] intellektuelle[r] Dominantenwechsel“ erfolgte, welcher neue Impulse für die schwedische und deutsche Literatur der 70er Jahre mit sich brachte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Existentialismus
- 2.1 Existentialismus: Eine Begriffsklärung
- 2.2 Sartres Philosophie: Ein Atheistischer Existentialismus
- 2.2.1 Kritik an Sartres Lehre
- 2.3 Existentialismus und Literatur
- 3. Französischer Existentialismus in der deutschen Nachkriegsliteratur
- 3.1 Rezeptionskontext
- 3.1.1 Stunde Null: Kontinuität oder Wandel in Nachkriegsdeutschland
- 3.1.2 Presse und Kulturpolitik der Alliierten: Frankreich etabliert sich als Orientierungsmodell
- 3.1.3 Präformierung existentialistischer Denkfiguren
- 3.1.4 Der französische Existentialismus in Deutschland/ Auftakt
- 3.2 Polaritäten
- 3.2.1 Junge Generation und ältere Generation
- 3.2.2 Reportagen und Identitätsverlust
- 3.2.3 Existentialismus Rezeption der Vertreter der älteren Generation
- 3.2.4 Existentialismus Rezeption der Vertreter der jungen Generation
- 3.2.5 Schuldfrage und Existentialismus in der älteren und der jungen Generation
- 3.3 Existentialismus in der Nachkriegsprosa der jungen Generation
- 3.3.1 Alfred Andersch und Kierkegaard
- 3.3.2 Heinrich Böll und der Ekel
- 3.3.3 Siegfried Lenz: Eine kritische Auseinandersetzung mit Sartre nach dem Vorbild Camus’
- 3.3.4 Arno Schmidts Leviathan und Schwarze Spiegel: Schopenhauer vs. Sartre
- 3.1 Rezeptionskontext
- 4. Französischer Existentialismus in der schwedischen Literatur nach 1945
- 4.1 Rezeptionskontext
- 4.1.1 Schwedens Neutralitätspolitik während des Zweiten Weltkrieges
- 4.1.2 Schwedens Kulturpolitik während des Zweiten Weltkrieges
- 4.1.3 Die schwedische Literatur der 40er Jahre
- 4.1.4 Wegbereiter: Schwedische Autoren als ‚Präexistentialisten’
- 4.2 Rezeption des französischen Existentialismus in Schweden nach 1945
- 4.2.1 Erste Erfolge und heftige Kritik
- 4.2.2 Fyrtiotalister
- 4.3 Existentialphilosophie & Existentialismus in der schwedischen Prosa der 40er Jahre
- 4.3.1 Lars Ahlin: Min död är min
- 4.3.2 Lars Gyllensten und Kierkegaard
- 4.3.3 Stig Dagerman: L’enfer c’est les autres
- 4.1 Rezeptionskontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption des französischen Existentialismus in der deutschen und schwedischen Nachkriegsliteratur. Ziel ist es, den französischen Existentialismus nicht nur als rein literarisches oder philosophisches Phänomen zu betrachten, sondern als ein weltanschauliches Deutungsangebot, welches von Intellektuellen beider Länder hinterfragt wurde und sich in den literarischen Werken der Nachkriegszeit widerspiegelt. Die Arbeit beleuchtet die nationalspezifischen Rezeptionskontexte und vergleicht den Einfluss auf deutsche und schwedische Autoren.
- Nationale Rezeptionskontexte des Existentialismus in Deutschland und Schweden
- Der Einfluss des französischen Existentialismus auf die deutsche Nachkriegsliteratur
- Der Einfluss des französischen Existentialismus auf die schwedische Nachkriegsliteratur
- Vergleich der Rezeption in Deutschland und Schweden
- Die Rolle der "jungen Generation" und der "älteren Generation" in der Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, die sich mit der Rezeption des französischen Existentialismus in Deutschland und Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Sie stellt die Frage nach den nationalen Unterschieden in der Rezeption und betont die Bedeutung der spezifischen historischen und ideengeschichtlichen Bedingungen. Das besondere Interesse gilt der Rezeption des Existentialismus als "Résistance-Philosophie" in beiden Ländern, trotz unterschiedlicher historischer Erfahrungen im Krieg.
2. Existentialismus: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Existentialismus als philosophische Strömung. Es beleuchtet die Entwicklung in drei Phasen: die Anfänge im 19. Jahrhundert mit Kierkegaard, Nietzsche und Dostojewski; die deutsche Existenzphilosophie nach dem Ersten Weltkrieg mit Buber, Heidegger und Jaspers; und der französische Existentialismus der Nachkriegszeit mit Sartre, Marcel und Mounier. Es wird auf die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition des Existentialismus eingegangen und der gemeinsame Nenner der Ablehnung des Idealismus hervorgehoben.
3. Französischer Existentialismus in der deutschen Nachkriegsliteratur: Dieses Kapitel analysiert die Rezeption des französischen Existentialismus in der deutschen Nachkriegsliteratur. Es untersucht den Kontext der "Stunde Null", die Rolle der alliierten Presse- und Kulturpolitik, sowie die Präformierung existentialistischer Denkfiguren in der deutschen Vorkriegs- und Zwischenkriegsliteratur. Die Arbeit beschreibt die gegensätzlichen Positionen der "jungen" und "älteren" Generation deutscher Autoren und deren unterschiedliche Auseinandersetzung mit der Schuldfrage.
4. Französischer Existentialismus in der schwedischen Literatur nach 1945: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rezeption des französischen Existentialismus in Schweden nach 1945. Es untersucht den Kontext der schwedischen Neutralitätspolitik während des Zweiten Weltkrieges und deren Auswirkungen auf die Kulturpolitik. Es beleuchtet die schwedische Literatur der 1940er Jahre und die Rolle schwedischer Autoren als "Präexistentialisten". Die kontroverse Rezeption des Existentialismus in Schweden, sowie die Bedeutung der Fyrtiotalister, wird analysiert.
Schlüsselwörter
Französischer Existentialismus, deutsche Nachkriegsliteratur, schwedische Nachkriegsliteratur, Sartre, Camus, Kierkegaard, Rezeption, "Stunde Null", "junge Generation", "ältere Generation", Schuldfrage, Identität, Résistance, Neutralitätspolitik, Fyrtiotalister, Existenzphilosophie, Existenz, Freiheit, Verantwortung, Absurdität, Literatur und Politik, Engagement, Realismus, Modernismus, Pessimismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Rezeption des französischen Existentialismus in der deutschen und schwedischen Nachkriegsliteratur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption des französischen Existentialismus in der deutschen und schwedischen Nachkriegsliteratur. Sie betrachtet den Existentialismus nicht nur als literarisches oder philosophisches Phänomen, sondern als weltanschauliches Deutungsangebot, das von Intellektuellen beider Länder hinterfragt wurde und sich in der Literatur der Nachkriegszeit widerspiegelt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den nationalen Unterschieden in der Rezeption und dem Vergleich des Einflusses auf deutsche und schwedische Autoren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Nationale Rezeptionskontexte des Existentialismus in Deutschland und Schweden; Der Einfluss des französischen Existentialismus auf die deutsche Nachkriegsliteratur; Der Einfluss des französischen Existentialismus auf die schwedische Nachkriegsliteratur; Vergleich der Rezeption in Deutschland und Schweden; Die Rolle der "jungen Generation" und der "älteren Generation" in der Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Kontext der Arbeit und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Existentialismus) bietet eine Einführung in den Existentialismus als philosophische Strömung. Kapitel 3 analysiert die Rezeption des französischen Existentialismus in der deutschen Nachkriegsliteratur, inklusive der "Stunde Null" und der gegensätzlichen Positionen der "jungen" und "älteren" Generation. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Rezeption in Schweden nach 1945, unter Berücksichtigung der schwedischen Neutralitätspolitik und der Rolle der "Fyrtiotalister".
Welche Autoren werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert die Rezeption des französischen Existentialismus anhand ausgewählter deutscher und schwedischer Autoren. Im deutschen Kontext werden unter anderem Alfred Andersch, Heinrich Böll, Siegfried Lenz und Arno Schmidt behandelt. Im schwedischen Kontext werden Lars Ahlin, Lars Gyllensten und Stig Dagerman untersucht.
Welche philosophischen Strömungen werden angesprochen?
Die Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit dem französischen Existentialismus, insbesondere mit den Werken und Ideen von Sartre und Camus. Darüber hinaus werden die Einflüsse von Kierkegaard, Nietzsche und Dostojewski sowie die deutsche Existenzphilosophie (Buber, Heidegger, Jaspers) berücksichtigt.
Welche Rolle spielen die nationalen Rezeptionskontexte?
Die nationalen Rezeptionskontexte spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie die spezifischen historischen und politischen Bedingungen in Deutschland (Stunde Null, alliierte Politik) und Schweden (Neutralitätspolitik) die Rezeption des Existentialismus beeinflusst haben. Die unterschiedlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg werden explizit berücksichtigt.
Wie wird der Existentialismus in der Arbeit definiert?
Die Arbeit geht auf die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition des Existentialismus ein. Der gemeinsame Nenner der betrachteten Strömungen ist die Ablehnung des Idealismus und die Betonung von Existenz, Freiheit, Verantwortung und der Absurdität.
Welche Rolle spielen die "junge" und "ältere" Generation?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Rezeptionen des Existentialismus durch die "junge" und "ältere" Generation in beiden Ländern. Es wird analysiert, wie die jeweilige Generation mit existentiellen Fragen wie der Schuldfrage und dem Identitätsverlust umgegangen ist und wie sich dies in ihren literarischen Werken niederschlägt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französischer Existentialismus, deutsche Nachkriegsliteratur, schwedische Nachkriegsliteratur, Sartre, Camus, Kierkegaard, Rezeption, "Stunde Null", "junge Generation", "ältere Generation", Schuldfrage, Identität, Résistance, Neutralitätspolitik, Fyrtiotalister, Existenzphilosophie, Existenz, Freiheit, Verantwortung, Absurdität, Literatur und Politik, Engagement, Realismus, Modernismus, Pessimismus.
- Citation du texte
- Anne Schumacher (Auteur), 2016, Französischer Existentialismus in der deutschen und schwedischen Nachkriegsliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351059