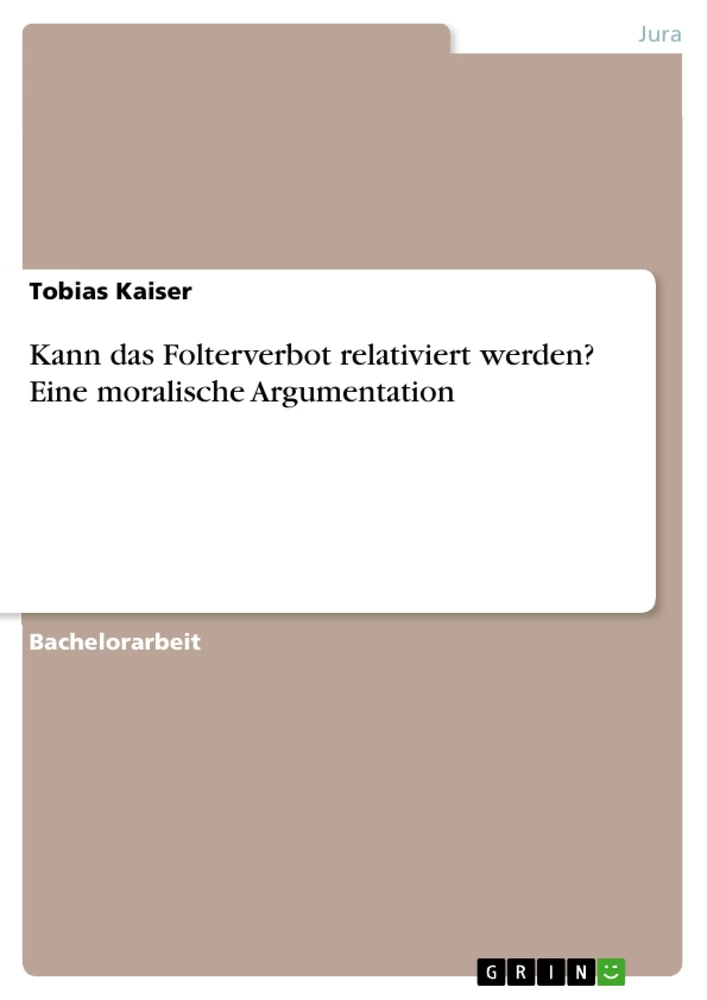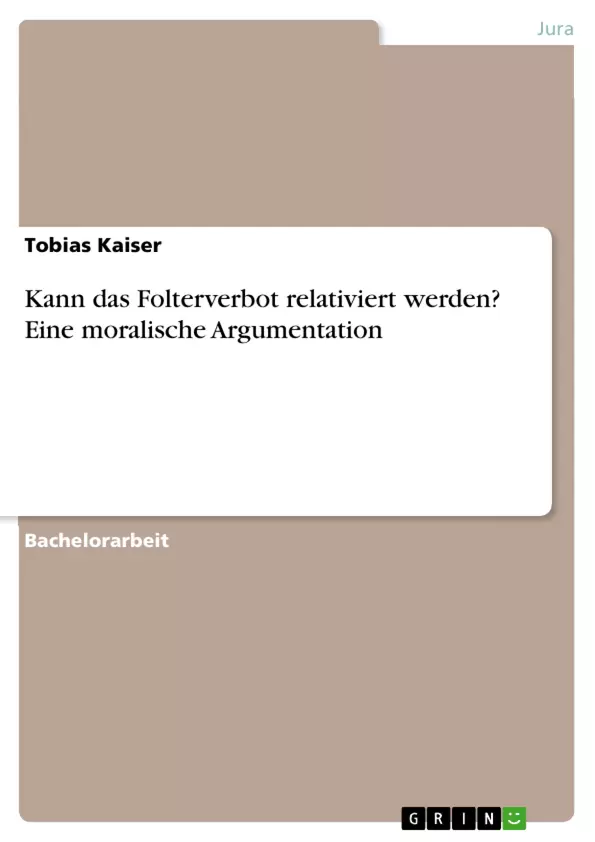Die Polizei ist eine Institution, deren Aufgaben unter anderem darin besteht, Gefahren abzuwehren. In einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland ist sie dabei an Recht und Gesetz gebunden. Somit schaffen gerade dieses Recht und Gesetz die Grenzen für polizeiliches Handeln. Es gibt jedoch Situationen, in denen das polizeiliche Ziel nur erreicht werden kann, wenn Polizeibeamte nicht konstitutionell handeln.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Autor in seiner Arbeit mit den beiden Fragen, ob eine moralische Argumentation ein bestehendes Recht in Frage stellen oder sogar Grundlage für eine Gesetzesänderung sein kann und, falls Frage 1 bejaht wird, ob die moralischen Argumente ausreichen, um Folter in Deutschland zu relativieren.
Bei der Bearbeitung der oben aufgeführten Thesen legt der Autor den Fokus auf die moralische Argumentation, um diese als Grundlage für eine mögliche Relativierung des Folterverbots anzuführen. Der rechtlichen Betrachtung kommt demnach weniger Bedeutung zu.
Der Einstieg in die Thematik erfolgt, indem mit Hilfe einer Definition erläutert wird, was unter Folter zu verstehen ist. Im Anschluss an die Begriffsbestimmung werden – angelehnt an die Ausführungen von Trapp – die acht Hauptfunktionen von Folter in einem historischen Kontext herausgearbeitet. Mit der Darstellung der Historie wird zum Einen schlüssig, warum das Thema Folter so ernst zu nehmen ist, zum Anderen wird verdeutlicht, aus welchen Gründen Folter weiterhin verboten sein soll. Um eine klare Grenze zu ziehen, wird im Anschluss auf die sogenannte Rettungsfolter eingegangen.
Da sich die Rettungsfolter ausschließlich auf die Aussageerzwingung einer Person beschränkt, wird im nächsten Kapitel die rechtliche Einordnung von Aussageverweigerungsrecht und Auskunftspflicht beleuchtet. Nachdem die rechtliche Einordnung erfolgt ist, wird der Grundsatz zwischen Moral und Recht erörtert, um darauf aufbauend moralische Argumentationen aufzuführen.
Die moralische Argumentation erfolgt in zwei Schritten. Erst werden die Ansichten jener herausgearbeitet, welche sich für ein absolutes Folterverbot aussprechen. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Argumentation aus Sicht der Befürworter, also jene, welche für eine Relativierung des Folterverbots stehen. Zur Abrundung erfolgen zum Ende eine eigene Stellungnahme sowie ein Fazit zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Folter
- Definition
- Historische Einordnung
- Antikes Griechenland und Römisches Reich
- Mittelalter
- Rettungsfolter
- Auskunftspflicht vs. Aussageverweigerungsrecht
- Polizeirechtliche & strafprozessuale Einordnung
- Durchsetzung mit Zwang
- Grundsatz zwischen Moral und Recht
- Argumentation auf moralischer Ebene
- Gegen eine Relativierung des Folterverbots
- Achtungsanspruch der Menschenwürde
- Dammbruchargument
- Grenzenlose Anwendung und Wahl der Mittel
- Falscher Tatverdächtiger
- Für eine Relativierung des Folterverbots
- Schutzpflicht der Menschenwürde
- Opferschutz vor Täterschutz
- Nothilfe statt Folter
- Analogie
- Gegen eine Relativierung des Folterverbots
- Eigene Stellungnahme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der moralischen Argumentation im Kontext des Folterverbots und untersucht, ob und inwiefern diese ein bestehendes Recht in Frage stellen kann. Darüber hinaus wird analysiert, ob die moralischen Argumente ausreichen, um die Folter in Deutschland zu relativieren. Der Fokus liegt dabei auf der moralischen Argumentation, während die rechtliche Betrachtung eine untergeordnete Rolle spielt.
- Moralische Argumentation im Kontext des Folterverbots
- Mögliche Relativierung des Folterverbots durch moralische Argumente
- Menschenwürde und ihre Schutzpflicht
- Abwägung von Schutzbedürfnissen von Opfern und Tätern
- Grenzen der Rechtsanwendung und moralische Dilemmata
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Folterverbots in Bezug auf die Polizeiarbeit vor und führt zwei Fallbeispiele an, die die Brisanz des Themas verdeutlichen. Es werden die beiden zentralen Thesen der Arbeit formuliert, die im weiteren Verlauf untersucht werden sollen.
- Folter: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Folter und beleuchtet die historische Einordnung des Themas. Es geht ebenfalls auf die Problematik der Rettungsfolter ein.
- Auskunftspflicht vs. Aussageverweigerungsrecht: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtliche Einordnung der Auskunftspflicht und des Aussageverweigerungsrechts im Strafprozess. Es wird untersucht, wie die Durchsetzung von polizeilichen Maßnahmen durch Zwang erfolgen kann.
- Grundsatz zwischen Moral und Recht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Spannung zwischen moralischen Normen und rechtlichen Vorgaben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern moralische Argumente bestehende Gesetze in Frage stellen können.
- Argumentation auf moralischer Ebene: In diesem Kapitel werden die Argumente für und gegen eine Relativierung des Folterverbots auf moralischer Ebene diskutiert. Es werden sowohl die Argumente für den absoluten Schutz der Menschenwürde als auch die Argumente für den Schutz von Opfern vor Tätern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Folterverbot, Menschenwürde, Schutzpflicht, moralische Argumentation, Recht und Gesetz, Polizeiarbeit, Rechtsstaat, sowie mit dem Spannungsfeld zwischen moralischen Normen und rechtlichen Vorgaben.
Häufig gestellte Fragen
Darf das Folterverbot in Deutschland moralisch relativiert werden?
Die Arbeit untersucht diese Frage intensiv und stellt moralische Argumente sowohl für ein absolutes Verbot als auch für eine mögliche Relativierung (z. B. bei der Rettungsfolter) gegenüber.
Was versteht man unter dem Begriff "Rettungsfolter"?
Rettungsfolter bezeichnet die Anwendung von Zwang zur Aussageerzwingung, um das Leben eines unschuldigen Opfers in einer akuten Gefahrensituation zu retten.
Welche Argumente sprechen gegen eine Relativierung des Folterverbots?
Zentrale Gegenargumente sind der absolute Achtungsanspruch der Menschenwürde, das "Dammbruchargument" (Gefahr der grenzenlosen Anwendung) und das Risiko, Unschuldige zu foltern.
Welche moralischen Gründe werden für eine Relativierung angeführt?
Befürworter argumentieren mit der Schutzpflicht des Staates für das Opfer ("Opferschutz vor Täterschutz") und betrachten die Handlung eher als Nothilfe denn als klassische Folter.
Wie wird das Verhältnis zwischen Moral und Recht in der Arbeit bewertet?
Die Arbeit erörtert das Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Verboten und moralischen Dilemmata, wobei der Fokus darauf liegt, ob moralische Einsichten eine Gesetzesänderung rechtfertigen könnten.
Welche Rolle spielt die Menschenwürde in dieser Debatte?
Die Menschenwürde ist der zentrale Bezugspunkt: Während Gegner der Folter ihre Unantastbarkeit betonen, sehen Befürworter einer Relativierung eine staatliche Pflicht, die Würde des Opfers aktiv zu schützen.
- Quote paper
- Tobias Kaiser (Author), 2015, Kann das Folterverbot relativiert werden? Eine moralische Argumentation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351430