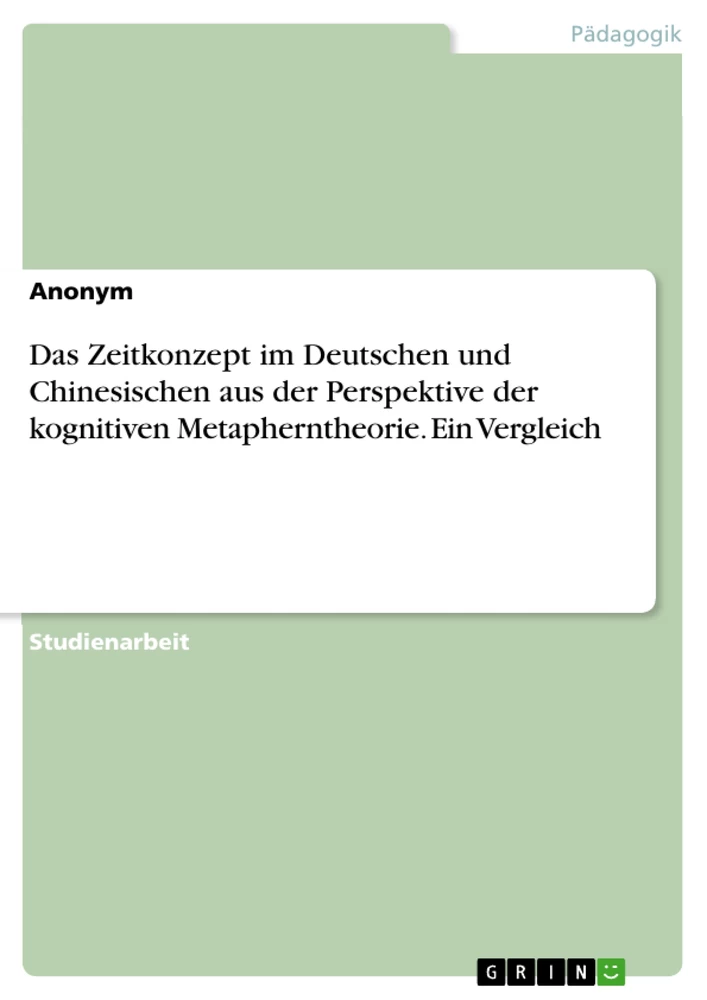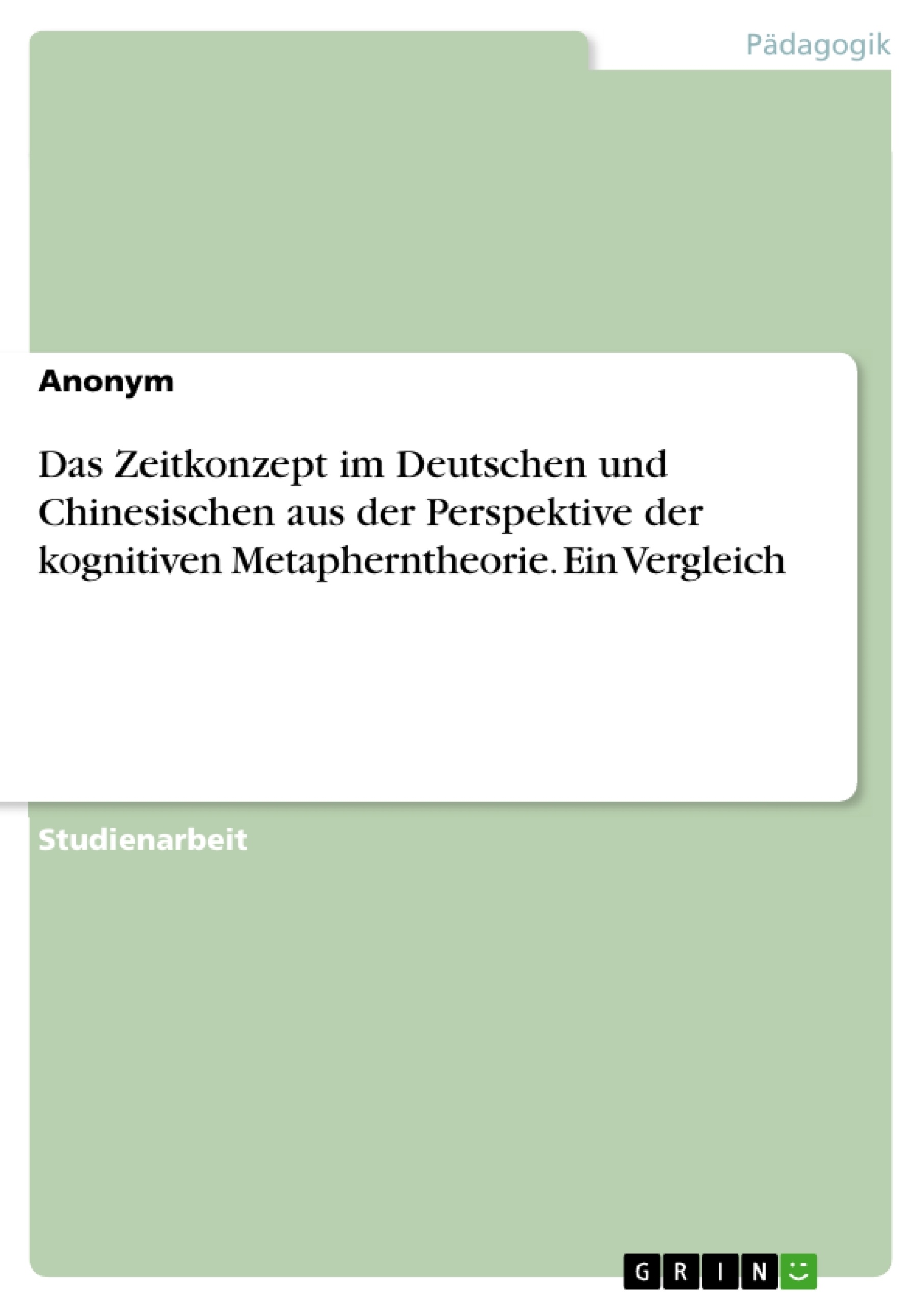Nach der kognitiven Metapherntheorie wird die Metapher nicht mehr als rein rhetorisches Stilmittel angesehen, sondern gilt als Konzeptualisierung der menschlichen Erfahrungen. Eine Metapher ist die Bedeutungsübertragung aus einem erfahrbaren Ursprungsbereich auf einen schwer erfassbaren Zielbereich, die auf physikalischen Erfahrungen basiert. Zeit ist ein abstrakter Erfahrungsbereich, der kaum fassbar und fast nur über andere, konkretere Erfahrungsbereiche begreifbar und beschreibbar ist . Am häufigsten versprachlicht man Zeit durch räumliche Metaphern.
Nach Lakoff/ Johnson schaffen unsere physikalischen Erfahrungen eine Basis für die konzeptionelle Metapher. Es ist anzumerken, dass körperliche Erfahrungen kulturell bedingt sind. Wir erfahren die Welt unter dem Einfluss von Kultur und die körperliche Erfahrung trägt unsere Kultur und wirkt auf die Konzeptualisierung ein. Es kommt zum Ergebnis, dass Fremdsprachenlernende beim Ausdruck eines abstrakten Konzepts den muttersprachlichen Ursprungsbereich verwenden, der sich von dem Ursprungsbereich der Fremdsprache unterscheidet. Solche Fehler werden von Danesi als „conceptual error“ definiert und bilden die meisten Transferfehler beim Fremdsprachlernen. Deshalb ist es wichtig, die Ausdrücke der konzeptuellen Metaphern im Deutschen und in der Muttersprache zu analysieren.
Die konzeptuelle Metaphertheorie ist nützlich für das Verständnis einer Sprache. Sie ist sehr hilfreich für das Auswendiglernen, die Beherrschung und die Erweiterung des Wortschatzes. Deshalb spielt die kognitive Metapher eine bedeutende Rolle im Wöterbuch für die Deutschlernenden. Die Arbeit zielt darauf ab, das traditionelle Wörterbuch aus der kognitiven Perspektive zu verbessern. In der Arbeit wird anhand des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch als Fremdsprache (Deutsch-Chinesisch) untersucht, wie man das deutsch-chinesische Wöterbuch mit der Metaphertheorie optimieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeit ist Raum
- Kognitive Metapherntheorie
- Konzeptuelle Metapher ZEIT IST RAUM
- Analyse von ZEIT IST RAUM Metapher
- TIME PASSING IS MOTION entlang Horizontale Achse
- TIME MOVING METAPHER
- EGO MOVING METAPHER
- Dualität der konzeptuellen Zeitmetaphern
- Analyse eines deutsch-chinesischen Wörterbuchs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die kognitive Metapherntheorie zur Optimierung eines deutsch-chinesischen Wörterbuchs beitragen kann. Sie konzentriert sich auf die Analyse der konzeptuellen Metapher „ZEIT IST RAUM“ und ihre Auswirkungen auf das Verständnis und die sprachliche Repräsentation von Zeit in beiden Sprachen.
- Kognitive Metapherntheorie und ihre Anwendung auf die Zeitkonzeptualisierung
- Analyse der konzeptuellen Metapher „ZEIT IST RAUM“ im Deutschen und Chinesischen
- Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der sprachlichen Repräsentation von Zeit
- Optimierung eines deutsch-chinesischen Wörterbuchs aus der Perspektive der kognitiven Metapherntheorie
- Bedeutung der kulturspezifischen Konzeptualisierung von Zeit für den Fremdsprachenerwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die kognitive Metapherntheorie vor und erläutert die Bedeutung der konzeptuellen Metapher „ZEIT IST RAUM“ für das Verständnis von Zeit. Kapitel 2 beleuchtet die kognitiven Metaphern und analysiert die konzeptuelle Metapher „ZEIT IST RAUM“ im Detail. Kapitel 3 untersucht die verschiedenen Modelle der Zeitkonzeptualisierung im Deutschen und Chinesischen. Schließlich wird in Kapitel 4 ein deutsch-chinesisches Wörterbuch aus der Perspektive der kognitiven Metapherntheorie analysiert und Optimierungsvorschläge gegeben.
Schlüsselwörter
Kognitive Metapherntheorie, konzeptuelle Metapher, ZEIT IST RAUM, Zeitkonzeptualisierung, Sprachvergleich, Deutsch-Chinesisch, Wörterbuchoptimierung, Fremdsprachenerwerb.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die kognitive Metapherntheorie über Zeit?
Sie besagt, dass Zeit ein abstraktes Konzept ist, das wir meist durch räumliche Metaphern (ZEIT IST RAUM) begreifbar machen.
Gibt es Unterschiede im Zeitkonzept zwischen Deutsch und Chinesisch?
Ja, während das Deutsche Zeit oft horizontal betrachtet, nutzt das Chinesische zusätzlich vertikale Konzepte zur Strukturierung von Zeitabfolgen.
Was ist ein „conceptual error“ beim Sprachenlernen?
Es ist ein Fehler, bei dem Lernende Metaphern ihrer Muttersprache wörtlich in die Fremdsprache übertragen, was oft zu Missverständnissen führt.
Wie kann ein Wörterbuch durch Metapherntheorie verbessert werden?
Indem es konzeptuelle Metaphern explizit erklärt, hilft es Lernenden, den Wortschatz systematischer zu beherrschen und Transferfehler zu vermeiden.
Was sind die „Time-Moving“ und „Ego-Moving“ Metaphern?
Bei „Time-Moving“ bewegt sich die Zeit auf uns zu; bei „Ego-Moving“ bewegen wir uns durch die Zeit auf Ereignisse zu.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Das Zeitkonzept im Deutschen und Chinesischen aus der Perspektive der kognitiven Metapherntheorie. Ein Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351796