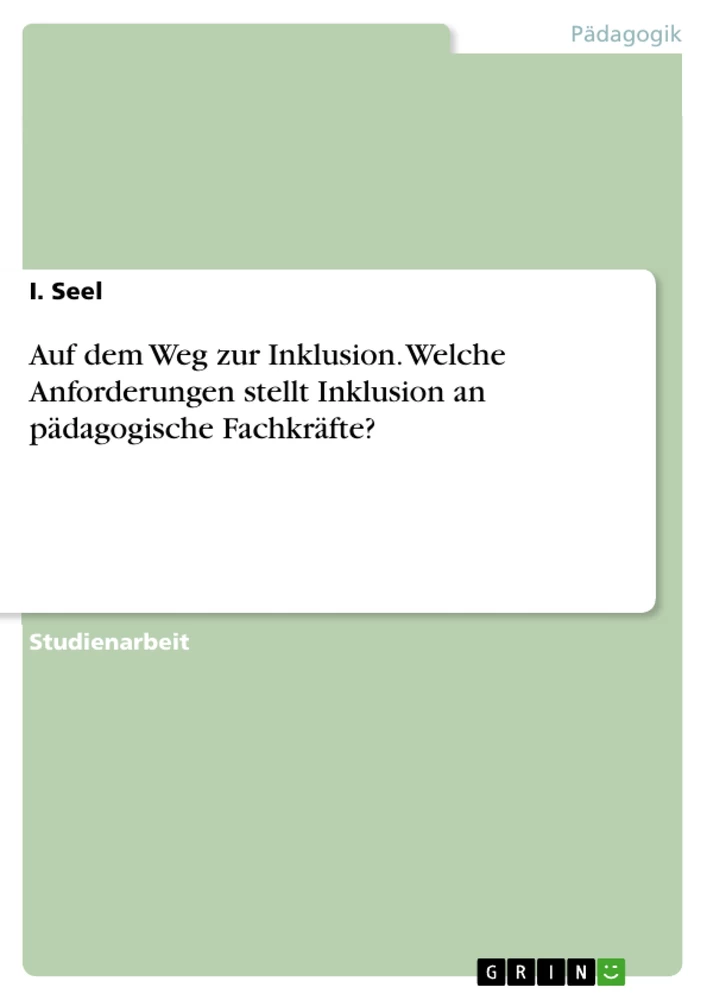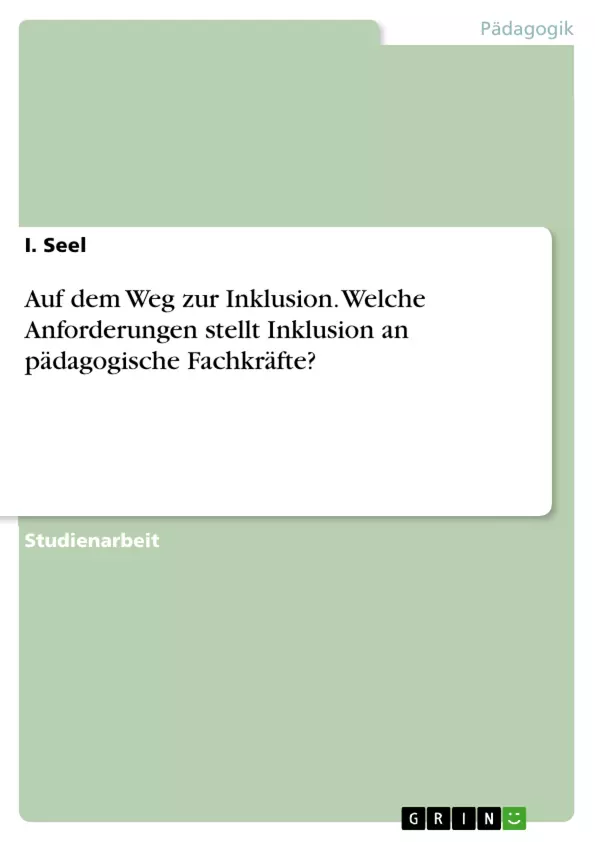Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung steht Inklusion im Fokus der Aufmerksamkeit. Mit der Forderung nach Inklusion entwickelt sich ein Paradigmenwechsel im heutigen Bildungssystem: alle Kinder, unabhängig von individuellen Fähigkeiten und kultureller oder sozialer Zugehörigkeit, sollen gemeinsam aufwachsen und lernen.
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ Diese häufig genutzten Wörter bringen zum Ausdruck, dass Heterogenität und Vielfalt zu unserer Gesellschaft dazu gehören. Auch in Kitas findet man heute ein breites Spektrum der Hetero-genität. Kindertageseinrichtungen kommt hierbei eine wichtige Rolle zu: als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution sollen sie den Grundstein für gleiche Chancen auf Teilhabe an Bildung und Gesellschaft legen. Das bedeutet, dass die Kindergärtenkonzepte sich so verändern sollen, dass alle individuellen Lebenslagen und Besonderheiten der Kinder berücksichtigt werden müssen. Wer und wie soll es realisieren? Die Wissenschaftler und Pädagogen sind darüber einigt. Die in der Kindertageseinrichtung tätigen Fachkräfte sind diejenige, die Inklusion in der Praxis umsetzen und verwirklichen sollen. Ihre Persönlichkeit, ihre Haltung, ihre Motivation, ihre Fachkenntnisse, ihre Ein-flussnahme und ihre Kooperationsbereitschaft entscheiden maßgeblich über die Umsetzung und das Gelingen inklusiver Prozesse in der Frühpädagogik.
Der begrenzte Umfang dieser Arbeit lässt nur eine vereinfachte Fragestellung zu und so möchte ich nach Antworten auf die Frage „Welche Anforderungen stellt Inklusion an pädagogische Fachkräfte?“ suchen. Ich werde mit dem gesetzlichen Auftrag zur Umsetzung von Inklusionsprozessen in Kindertageseinrichtungen beginnen und die Ziele Inklusiver Erziehung in heterogenen Gruppen erläutern. Daraufhin möchte ich steigende Anforderungen an ErzieherInnenkompetenzen beschreiben und auf einige Aspekte der Gestaltung des inklusiven Prozesses eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusive Prozesse in der Kita
- Anforderungen an ErzieherInnenkompetenzen
- Forschende Haltung
- Die biografische Arbeit
- Fachwissen, Erfahrungen und Weiterbildung
- Gestaltungsaspekte im Umgang mit Inklusion
- Teamarbeit
- Kindergartengruppe
- Pädagogische Interventionen
- Förderlicher Rahmenbedingungen
- Individuelle Förderung
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Anforderungen, die Inklusion an pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen stellt. Sie untersucht, wie Erzieherinnen und Erzieher durch ihre Kompetenzen und Haltungen inklusive Prozesse in der Kita gestalten können.
- Die Bedeutung der forschenden Haltung und der Auseinandersetzung mit Heterogenität
- Die Rolle der biografischen Arbeit und der Reflexion eigener Erfahrungen
- Die Notwendigkeit von Fachwissen, Weiterbildung und Kooperation
- Die Gestaltung von inklusiven Prozessen in der Kita-Gruppe
- Die Bedeutung von individueller Förderung und Zusammenarbeit mit Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Inklusion in der Kindertageseinrichtung und stellt die Frage nach den Anforderungen, die Inklusion an pädagogische Fachkräfte stellt. Das zweite Kapitel beleuchtet inklusive Prozesse in der Kita und die Herausforderungen, die durch die Heterogenität der Kinder entstehen. Das dritte Kapitel widmet sich den Anforderungen an die Kompetenzen von Erzieherinnen und Erziehern. Hier werden die forschenden Haltung, die biografische Arbeit und die Notwendigkeit von Fachwissen und Weiterbildung näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Inklusion, Kindertageseinrichtung, ErzieherInnenkompetenzen, Heterogenität, Vielfalt, Biografie, forschende Haltung, Fachwissen, Weiterbildung, Kooperation, individuelle Förderung, Zusammenarbeit mit Eltern.
Häufig gestellte Fragen zur Inklusion in der Pädagogik
Welche Anforderungen stellt Inklusion an pädagogische Fachkräfte?
Inklusion erfordert eine forschende Haltung, biografische Selbstreflexion, fundiertes Fachwissen sowie eine hohe Kooperationsbereitschaft im Team und mit Eltern.
Warum ist biografische Arbeit für Erzieher wichtig?
Durch die Reflexion eigener Erfahrungen mit Vielfalt und Ausgrenzung können Fachkräfte ihre eigene Haltung klären und vorurteilsfreier auf die Kinder eingehen.
Was bedeutet eine "forschende Haltung" im Inklusionsprozess?
Es geht darum, die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes genau zu beobachten, zu hinterfragen und das pädagogische Handeln stetig an die Heterogenität der Gruppe anzupassen.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die Konvention ist der völkerrechtliche Motor für den Paradigmenwechsel hin zu einem Bildungssystem, in dem alle Kinder unabhängig von ihren Fähigkeiten gemeinsam lernen.
Wie wird Inklusion in der Zusammenarbeit mit Eltern gestaltet?
Inklusive Pädagogik sieht Eltern als Experten für ihre Kinder und strebt eine Erziehungspartnerschaft an, die individuelle Lebenslagen und kulturelle Hintergründe berücksichtigt.
- Quote paper
- I. Seel (Author), 2015, Auf dem Weg zur Inklusion. Welche Anforderungen stellt Inklusion an pädagogische Fachkräfte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352248