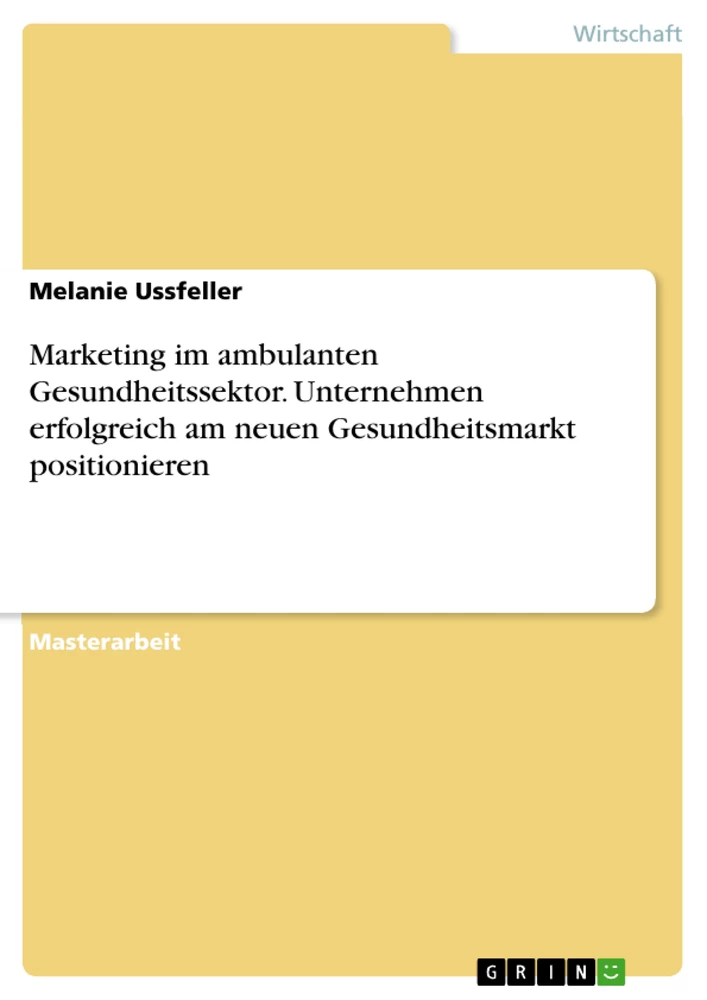In dieser Arbeit wird der Hauptfokus nicht auf das Qualitäts- und Projektmanagement gelegt, das Hauptziel dieser Masterarbeit besteht stattdessen darin, ein Marketingkonzept am Beispiel eines MVZs (Medizinisches Versorgungszentrum, nachfolgend nur noch MVZ genannt) zu entwickeln, das eine Möglichkeit zur optimalen Positionierung im Gesundheitsmarkt der ambulanten Versorgung aufzeigt. Ein Marketingkonzept, das mit wirtschaftlich und organisatorisch abgestimmten Prozessen, Teams aus Ärzten und medizinischem Personal, gemeinsam mit dem Patienten nach der für ihn optimalen Lösung sucht. Dieses Konzept soll den ambulanten Gesundheitsunternehmen die Möglichkeiten aufzeigen, dem Patienten Vertrauen und Wohlbefinden zu vermitteln, um damit eine langfristige Beziehung zum Patienten aufzubauen.
Ohne fachkompetente, freundliche und motivierte Mitarbeiter, die den Wandel der Rahmenbedingungen annehmen, ist dieser Prozess jedoch nicht durchfuhrbar. Denn nur qualifiziertes und motiviertes Personal kann den Erfolg einer Gesundheitseinrichtung nachhaltig sichern. Daraus resultierend entwickelt sich die zentrale Fragestellung: welche Management- und Marketingprozesse für die niedergelassenen Gesundheitsbetriebe sind notwendig (neben dem medizinischen Know-how) einen angenehmen Zustand im Kontext zu IGeL und Sonderleistungen für Kunden zu vermitteln, die regelmäßig in Ihrem Gesundheitsunternehmen einkaufen wollen? Denn in dem Moment, wo der Patient zum Kunden wird, verlangt er auch, wie ein Kunde behandelt zu werden.
Der überwiegende Teil der ambulanten Versorgung erfolgt durch niedergelassene Haus- und Facharzte. Insgesamt kommt dem niedergelassenen Sektor eine zentrale Bedeutung zu, weil diese Einrichtungen in der Regel den Erstkontakt des Patienten mit dem Versorgungssystem herstellen. Der niedergelassene Arzt erbringt zum einen selbst beratende, diagnostische und therapeutische Leistungen und entscheidet über den weiteren Behandlungsverlauf. Zum anderen entscheidet er über eine Arbeitsunfähigkeit und verordnet Leistungen in den Bereichen Arznei-, Heil- und Hilfsmittel. Schaut man sich Leitbilder von Gesundheitsunternehmen an, so findet man primär nahezu die gleichen Textpassagen: „Der Patient steht im Mittelpunkt“ und „die medizinische Qualität hat oberste Priorität“.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Hintergrund
- Fragestellung und Ziel der Arbeit
- Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen und Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems
- Hintergrund und Rahmenbedingungen
- Das heutige Gesundheitssystem
- Die GKV als Kernbereich des deutschen Gesundheitswesens
- Die ambulante ärztliche Versorgung
- EBM- Einheitlicher Bewertungsmaßstab
- Die private Krankenversicherung
- GOÄ - Die Gebührenordnung für Ärzte
- IGeL-Individuelle Gesundheitsleistungen
- Privat- und Kassenpatienten
- Systemunterschiede PKV und GKV an zwei Praxisbeispielen
- Zwischenfazit
- Grundlagen des Marketings
- Wachsende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen - Gesundheitsproduktion im demografischen Wandel
- Der Gesundheitsmarkt verändert sich zu Health 2.0
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Das HWG - Eine Grenze für Werbe- und Marketingkampagnen von Gesundheitsangeboten
- UWG-Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
- MBO - Musterberufsordnung der deutschen Ärzte
- Der Begriff Marketing
- Hintergrund
- Definitionen des Marketingbegriffes
- Internes Marketing
- Einordnung des Marketingbegriffes in die Gesundheitsbetriebslehre
- Gegenstand des gesundheitsbetrieblichen Marketings
- Strategisches Marketing – warum Marketing mit Strategie beginnt
- Gesundheitsbetrieblicher Marketingansatz und absatzwirtschaftliche Grundlagen des Gesundheitsbetriebes
- Der Marketingprozess im Gesundheitsbetrieb
- Interne und externe Marktanalyse
- Patientenzielgruppen und Marketingziele
- Marketingstrategien
- Marketinginstrumente
- Produktpolitik
- Preis-/ Kontrahierungspolitik
- Distributionspolitik
- Kommunikationspolitik
- Informationsstrategien im Gesundheitsbetrieb
- Werbung und Public Relations
- Corporate Identity
- Zwischenfazit
- Konzeptentwicklung und Praxisbezug
- Hintergrund
- Das MVZ als eine Struktureinheit in der ambulanten Versorgung
- Vorstellung der Einrichtung und die aktuelle Situation
- Strategisches Marketing im MVZ
- Die interne und externe Analyse der Ausgangssituation
- Definition der Patientenzielgruppen
- Festlegung der Marketingziele
- Entwicklung von Marketingstrategien
- Die Positionierung des MVZs als Marke auf dem Gesundheitsmarkt mit Hilfe der Marketinginstrumente
- Der USP und die Marke Medkonsil
- Corporate Identity
- Das Logo
- Das Leitbild
- Internes Marketing erfolgreich umgesetzt
- Corporate Behaviour - persönliche Servicequalität - im Kontext zu Qualität
- Corporate Fashion
- Coporrate Communication
- Kommunikation im Umgang mit dem Patienten
- Der Faktor Zeit
- Wartezimmer und Ambiente
- Das Marketinginstrument Patienten- und Zuweiserbefragung
- Der Internetauftritt
- Umsetzungsplan und Budgetierung des Marketingprojektes
- Entwicklung eines Marketingkonzepts für ein MVZ
- Analyse des deutschen Gesundheitssystems und seiner Rahmenbedingungen
- Anwendung von Marketinginstrumenten im Gesundheitsbereich
- Positionierung eines Gesundheitsdienstleisters am Markt
- Erstellung einer Corporate Identity für das MVZ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit untersucht die Anwendung von Marketingstrategien im ambulanten Gesundheitssektor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Positionierung von Gesundheitsdienstleistern am neuen Gesundheitsmarkt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines konkreten Marketingkonzepts für ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Bereich der Kardiologie, Pneumologie und Schlafmedizin.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert das methodische Vorgehen. Kapitel 2 beleuchtet das deutsche Gesundheitssystem, insbesondere die ambulante Versorgung und die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Kapitel 3 befasst sich mit den Grundlagen des Marketings und untersucht die Besonderheiten des gesundheitsbetrieblichen Marketings. Im vierten Kapitel wird ein Marketingkonzept für ein MVZ entwickelt, das die interne und externe Analyse, die Definition der Patientenzielgruppen und die Festlegung von Marketingzielen umfasst. Kapitel 4.7 geht auf die Positionierung des MVZs als Marke auf dem Gesundheitsmarkt ein, wobei die Corporate Identity eine zentrale Rolle spielt. Die Kapitel 4.8 bis 4.13 behandeln verschiedene Aspekte der Corporate Identity, wie z. B. das Logo, das Leitbild, Corporate Behaviour und die Kommunikation im Umgang mit dem Patienten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Marketing, Gesundheitswesen, Gesundheitsmarkt, ambulante Versorgung, MVZ, Kardiologie, Pneumologie, Schlafmedizin, Corporate Identity, Patientenzielgruppen, Marketingstrategie, Gesundheitsbetriebslehre, Rechtliche Rahmenbedingungen, Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)?
Ein MVZ ist eine fachübergreifende, ärztlich geleitete Einrichtung der ambulanten Versorgung, in der Ärzte als Angestellte oder Vertragsärzte zusammenarbeiten.
Warum ist Marketing für MVZs heute so wichtig?
Durch den demografischen Wandel und den wachsenden Wettbewerb müssen sich MVZs klar positionieren, um Patientenvertrauen zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.
Was bedeutet "Corporate Identity" im Gesundheitswesen?
Es umfasst das einheitliche Erscheinungsbild (Logo), das Leitbild und das Verhalten der Mitarbeiter, um eine unverwechselbare Marke zu schaffen.
Was sind IGeL-Leistungen?
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) sind medizinische Leistungen, die nicht zum Festbetrag der gesetzlichen Krankenkassen gehören und vom Patienten selbst gezahlt werden.
Welche rechtlichen Grenzen gibt es beim Klinikmarketing?
Wichtige Gesetze sind das Heilmittelwerbegesetz (HWG) und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), die irreführende oder zu markante Werbung untersagen.
- Citation du texte
- Melanie Ussfeller (Auteur), 2016, Marketing im ambulanten Gesundheitssektor. Unternehmen erfolgreich am neuen Gesundheitsmarkt positionieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352691