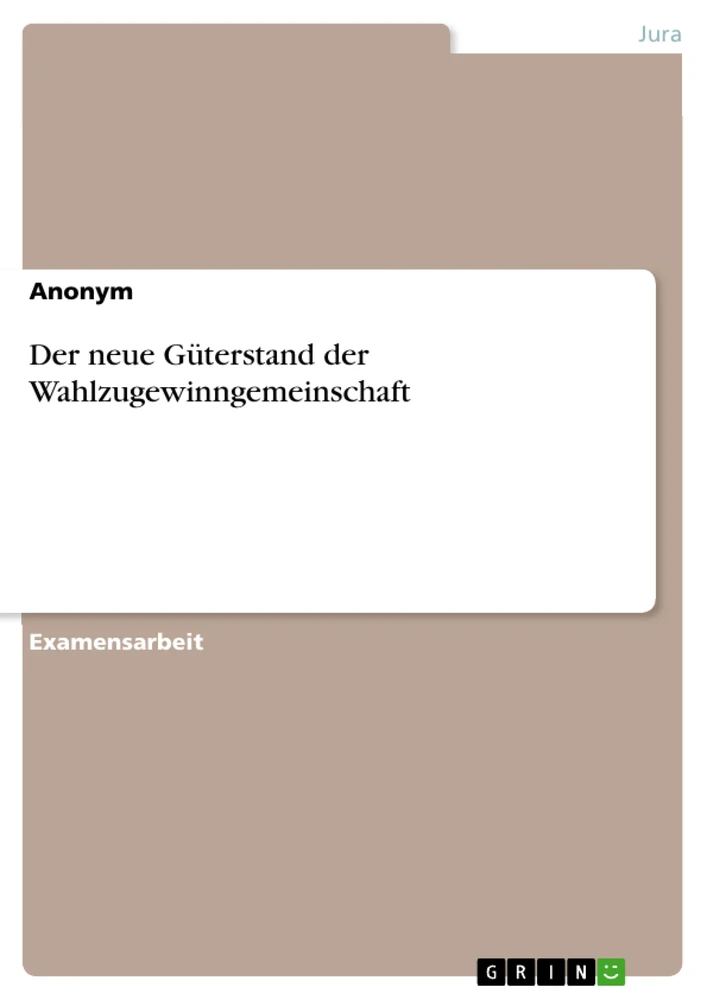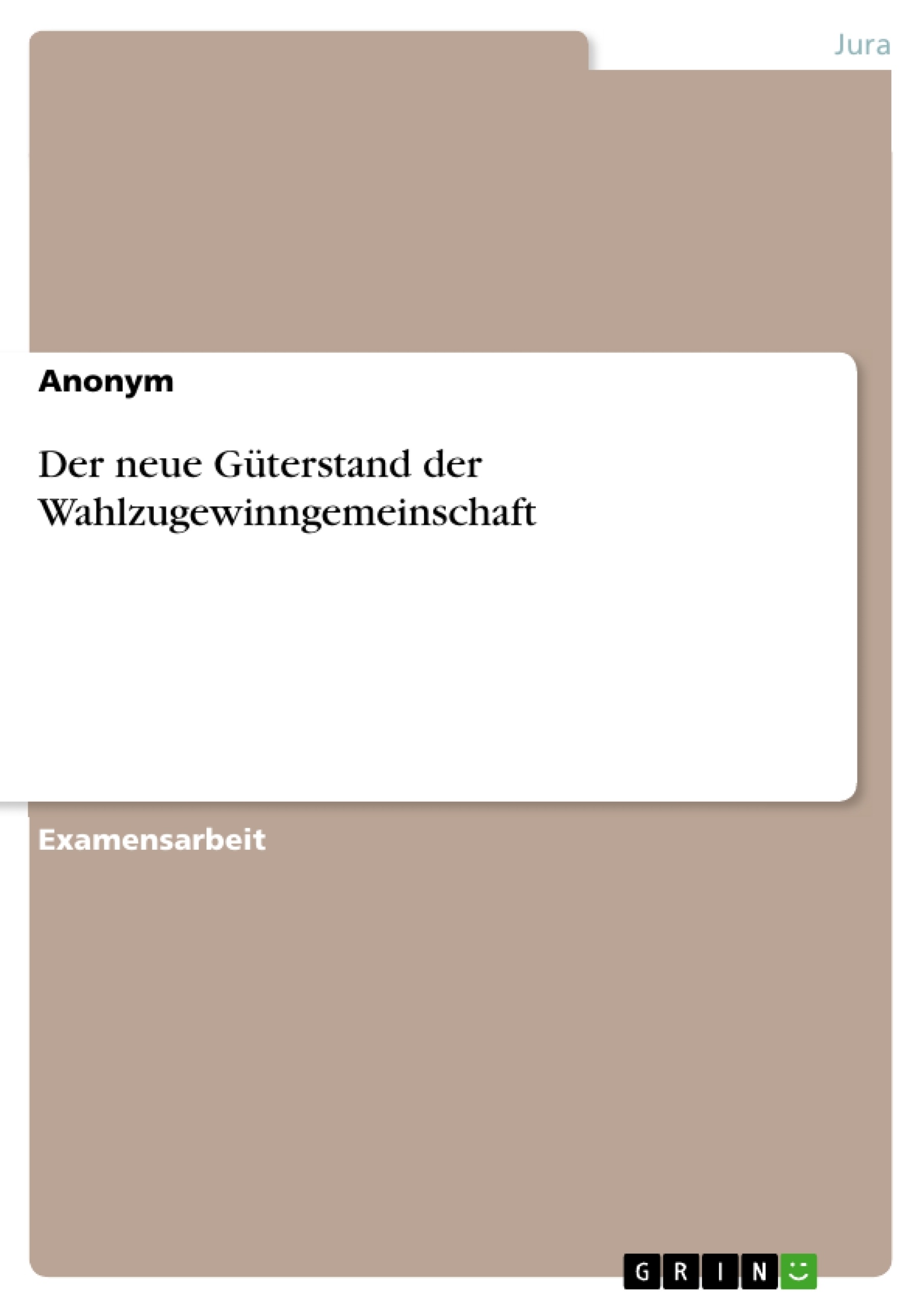Die positive Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen und der Versuch, diese Beziehungen stetig zu fördern, spiegeln sich im Alltag der beiden einst verfeindeten Nationen deutlich wieder. Die Tatsache, dass die jeweils andere Sprache in den Schulen der Länder unterrichtet wird, trägt dazu bei, dass die Verbindung zwischen den Bürgern beider Nationen beständig wächst. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Europäische Union als Raum ohne Binnengrenzen, der kurzweilige oder dauerhafte Aufenthalte im Nachbarland ermöglicht. Nicht selten mündet eine deutsch-französische Freundschaft in eine deutsch-französischen Ehe. Im Jahr 2009 wurden in Deutschland ca. 34.000 deutsch-französische Ehen eingegangen. Im Vergleich zu anderen Ehen mit Auslandsberührung stellten diese die viertstärkste Gruppe gemischt nationaler Ehen im Land dar. Während sich die Eheschließung als weitestgehend unproblematisch erweist, kommt es im Scheidungsfall häufig zu Schwierigkeiten, vor allem wenn eine güterrechtliche Abwicklung vorgenommen werden muss. Dieser Problematik traten Deutschland und Frankreich in den vergangenen Jahren entgegen. Als Resultat der deutsch-französischen Zusammenarbeit fand der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft im Mai 2013 Einzug in die nationalen Rechtsordnungen beider Staaten. Er stellt nicht nur ein Produkt deutsch-französischer Freundschaft dar, sondern verfolgt vor allem das Ziel einen Anstoß zur Harmonisierung des Familienrechts auf europäischer Ebene zu geben.
Die vorliegende Arbeit stellt den neuen Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft vor. Dabei wird zunächst auf die soziale und rechtliche Ausgangssituation in den Vertragsstaaten eingegangen. Anschließend erfolgt ein kurzer Abriss der wesentlichen Daten des Gesetzgebungsverfahrens und des Inkrafttretens des Abkommens. Der nachfolgende Vergleich der deutschen Zugewinngemeinschaft und der französischen Errungenschaftsgemeinschaft soll als Grundlage der Erläuterungen zum neuen Güterstand dienen. Den Schwerpunkt der Bearbeitung stellt die Untersuchung der Wahl-Zugewinngemeinschaft dar. Im Mittelpunkt der Darbietung des neuen Güterstandes steht die Betrachtung wesentlicher Abweichungen von den Regelungen über den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Abschließend erfolgt eine Bezugnahme auf die Bedeutung der Wahl-Zugewinngemeinschaft hinsichtlich der deutschen Rechtspraxis und der europäischen Rechtsentwicklung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Vorüberlegungen
- I. Soziale und rechtliche Ausgangssituation
- II. Bedürfnis nach einem neuen Güterstand
- III. Gesetzgebungsverfahren und Inkrafttreten
- IV. Der deutsche und französische gesetzliche Güterstand im Vergleich
- 1. Eintritt der Güterstände
- 2. Güterrechtliche Situation während der Ehe
- 3. Ausgleich bei Beendigung der Güterstände
- C. Der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft
- I. Anwendungsbereich
- II. Begründung des Güterstandes
- III. Besonderheiten während der Ehe
- 1. Verfügungsbeschränkungen
- 2. Geschäfte zur Führung des Haushalts
- IV. Beendigung des Güterstandes
- V. Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung
- 1. Anfangsvermögen
- a) Schmerzensgeld
- b) Schenkungen aus dem Anfangsvermögen
- c) Bewertung des Anfangsvermögens
- 2. Endvermögen
- 3. Ausgleichsanspruch
- 4. Kappungsgrenze
- 1. Anfangsvermögen
- VI. Ehevertragliche Modifikation
- VII. Auskunftspflichten
- VIII. Aktuelle Situation und Ausblick
- D. Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den neu eingeführten Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, der im Mai 2013 in Deutschland und Frankreich in Kraft getreten ist. Sie untersucht die Hintergründe und Ziele dieses Güterstandes, seine besonderen Merkmale und seine Auswirkungen auf das Familienrecht.
- Die soziale und rechtliche Ausgangssituation für deutsch-französische Ehen
- Das Bedürfnis nach einem neuen Güterstand
- Der deutsche und französische gesetzliche Güterstand im Vergleich
- Die Berechnung des Zugewinnausgleichs bei Beendigung des Güterstandes
- Ehevertragliche Modifikationen und Auskunftspflichten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einführung des Güterstandes der Wahl-Zugewinngemeinschaft, beleuchtet seine Entstehungsgeschichte und die Motivation hinter seiner Einführung. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich im Scheidungsfall für deutsch-französische Paare ergeben, und erklärt, wie dieser neue Güterstand eine Harmonisierung des Familienrechts in Europa fördern soll. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Vorüberlegungen zur Einführung des Güterstandes und beleuchtet die soziale und rechtliche Ausgangssituation für binationale Paare. Es analysiert die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen in Deutschland und Frankreich und die damit verbundenen Herausforderungen. Des Weiteren werden die Bedürfnisse der Paare nach einem neuen Güterstand analysiert und die Gesetzgebungsverfahren sowie das Inkrafttreten des neuen Güterstandes beschrieben.
Das dritte Kapitel analysiert den neuen Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, beleuchtet seine Anwendungsbereiche, die Begründungen für seine Einführung und seine Besonderheiten während der Ehe. Der Fokus liegt dabei auf den Verfügungsbeschränkungen und Geschäften zur Führung des Haushalts. Es beleuchtet auch die Beendigung des Güterstandes und die Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung, einschließlich der Faktoren wie Anfangsvermögen, Endvermögen und der Kappungsgrenze. Das vierte Kapitel behandelt die ehevertraglichen Modifikationen des Güterstandes und die Auskunftspflichten der Partner.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete des Familienrechts, der Rechtsharmonisierung in Europa, deutsch-französischen Beziehungen, Güterrecht, Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, Zugewinnausgleich, Ehevertrag, Auskunftspflicht und der aktuellen Situation im Familienrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft?
Es handelt sich um einen im Mai 2013 eingeführten Güterstand, der durch deutsch-französische Zusammenarbeit entstand, um das Familienrecht für binationale Ehen zu harmonisieren.
Warum wurde dieser neue Güterstand eingeführt?
Er soll Schwierigkeiten bei der güterrechtlichen Abwicklung im Scheidungsfall vermeiden, die oft durch die Unterschiede zwischen deutschem und französischem Recht entstehen.
Wie unterscheidet er sich vom gesetzlichen Güterstand?
Der Güterstand enthält spezifische Regelungen zu Verfügungsbeschränkungen, Haushaltsführung und eine harmonisierte Berechnung des Zugewinnausgleichs bei Beendigung der Ehe.
Wie wird der Zugewinnausgleich in diesem Modell berechnet?
Die Berechnung basiert auf dem Vergleich von Anfangs- und Endvermögen, wobei Besonderheiten wie Schmerzensgeld, Schenkungen und eine Kappungsgrenze berücksichtigt werden.
Gibt es Auskunftspflichten zwischen den Ehepartneren?
Ja, die Partner unterliegen gegenseitigen Auskunftspflichten, um eine faire Berechnung des Vermögenszuwachses während der Ehe zu gewährleisten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2014, Der neue Güterstand der Wahlzugewinngemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352741