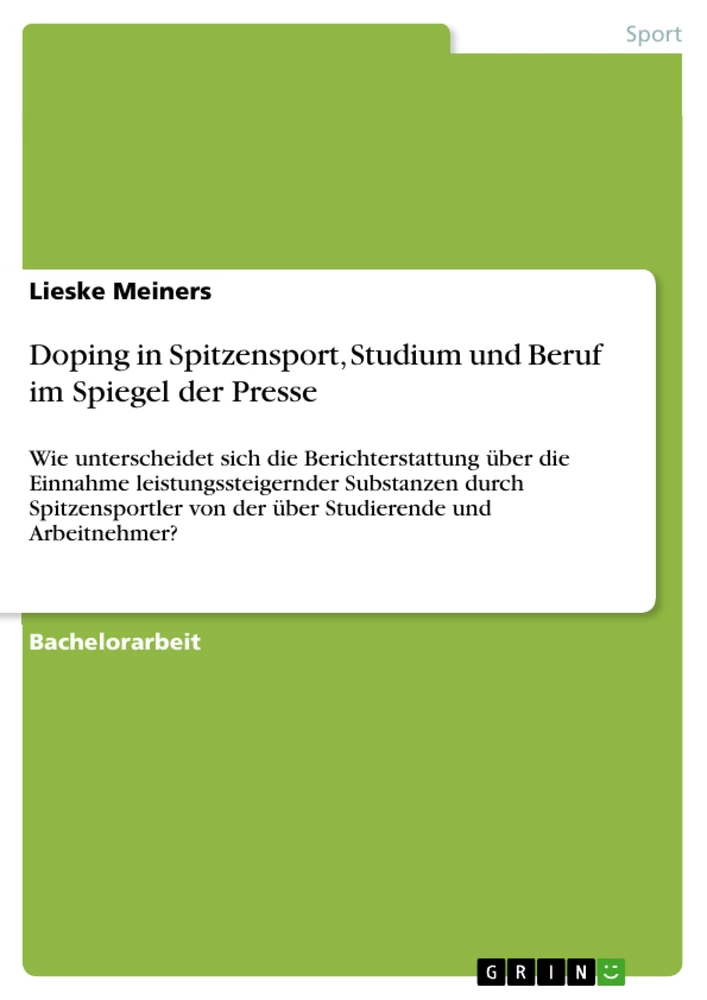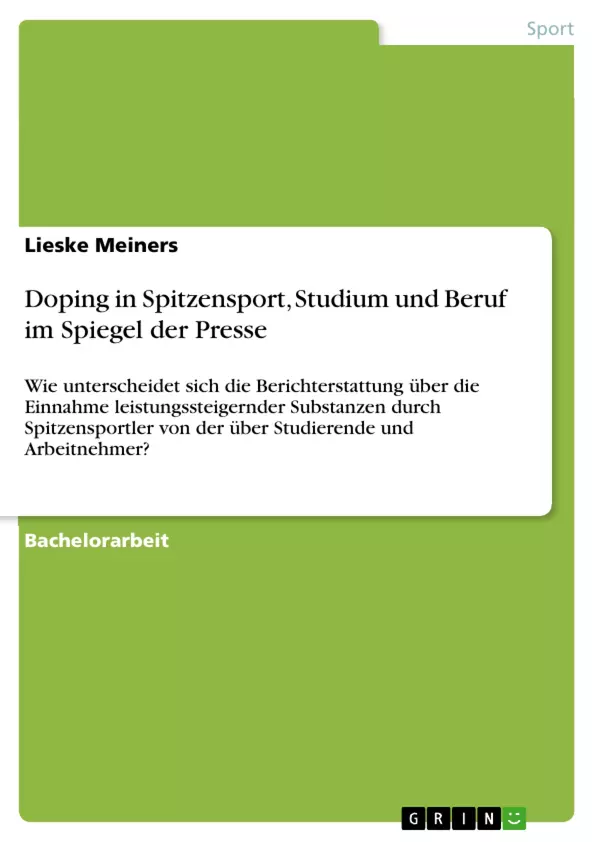Den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bildet die Frage nach Unterschieden in der printmedialen Berichterstattung über die Einnahme leistungssteigernder Substanzen durch Spitzensportler im Vergleich zu Studierenden und Arbeitnehmern. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden drei Hypothesen formuliert, die sich aus den theoretischen Überlegungen der Soziologen Bette, Schimank und Hoberman sowie der Medienwissenschaftler Galtung und Ruge ergeben. Bette und Schimank verstehen Doping im Spitzensport als strukturelles Phänomen, das durch die wechselseitige Abhängigkeit verschiedener Systeme entsteht, während Hoberman Doping in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen erforscht und es neu definiert. Galtung und Ruge formulieren Selektionskriterien journalistischer Berichterstattung, die die Medienwirksamkeit eines Ereignisses beschreiben und damit die mediale Darstellung beeinflussen.
Basierend auf diesen theoretischen Zusammenhängen wird zunächst angenommen, dass die printmediale Berichterstattung über Doping im Spitzensport in hohem Maße personalisiert ist, also individuellem Fehlverhalten seitens des Athleten zugeschrieben wird. Weiter folgt aus der Theorie, dass die printmediale Berichterstattung über Doping bei Studenten und Arbeitnehmern eher strukturellen Bedingungen zugeschrieben wird. Zuletzt steht die Vermutung, dass die printmediale Berichterstattung über dopende Studenten und Arbeitnehmern eher über gesundheitliche Risiken der leistungssteigernden Substanzen informiert, als die Berichterstattung über Doping im Spitzensport. Zur qualitativen Überprüfung dieser Hypothesen sind insgesamt 27 Artikel der Süddeutschen Zeitung ausgewählt worden, die mithilfe der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring im Hinblick auf die Fragestellung untersucht werden; 16 Artikel behandeln den Dopingfall der Profi-Tennisspielerin Maria Scharapowa, die Anfang des Jahres bei den Australian Open positiv auf Meldonium getestet wurde, während elf Artikel das Thema Hirndoping und Neuro-Enhancement bei Studierenden und Arbeitnehmern zum Inhalt haben
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Vorgehen und Ziel der Untersuchung
- Aktueller Forschungsstand
- Was ist Doping?
- Begriffsbestimmung
- Definition
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Doping im Spitzensport: Doping als Struktureffekt
- Doping in anderen gesellschaftlichen Kontexten
- Medientheoretische Einordnung
- Realitätskonstruktion durch Medien
- Doping in den Medien
- Methode
- Strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring
- Durchführung
- Bestimmung des Ausgangsmaterials
- Analyse der Entstehungssituation
- Formale Charakteristika des Materials
- Das Kategoriensystem
- Darstellung der Ergebnisse
- Ursachen von Doping
- Gesellschaftliche Strukturen
- Individuelles Fehlverhalten
- Gefahren durch Doping
- Gesundheitliche Risiken/ Nebenwirkungen
- Schäden für übergeordnete Systeme
- Interpretation der Ergebnisse
- Hypothese 1 – Die personalisierte Berichterstattung über Doping im Spitzensport
- Hypothese 2 – Die strukturell geprägte Berichterstattung über Doping bei Studierenden und Arbeitnehmern
- Hypothese 3 – Informationen über gesundheitliche Nebenwirkungen
- Beantwortung der Forschungsfrage und Diskussion
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit von Lieske Meiners befasst sich mit der Analyse von Unterschiede in der Berichterstattung über die Einnahme leistungssteigernder Substanzen durch Spitzensportler im Vergleich zu Studierenden und Arbeitnehmern. Die Untersuchung zielt darauf ab, die mediale Darstellung von Doping in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten zu untersuchen und mögliche Unterschiede in der Berichterstattung aufzudecken. Die Arbeit fokussiert insbesondere auf die Printmedien und untersucht die Süddeutsche Zeitung als Fallbeispiel. Die Analyse soll die Frage klären, ob die Berichterstattung über Doping im Spitzensport von derjenigen über „Brain-Doping“ bei Studierenden und Arbeitnehmern abweicht. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die mediale Konstruktion von Doping in beiden Kontexten zu analysieren.
- Analyse der medialen Darstellung von Doping in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten
- Untersuchung von Unterschieden in der Berichterstattung über Doping im Spitzensport im Vergleich zu „Brain-Doping“ bei Studierenden und Arbeitnehmern
- Erläuterung des medialen Diskurses über Doping und die zugrunde liegenden Strukturen der printmedialen Berichterstattung
- Anwendung der Theorie der Soziologen Bette und Schimank sowie der Theorie Hobermans zur Erklärung von Doping in verschiedenen Kontexten
- Analyse des Einflusses gesellschaftlicher Strukturen und individueller Faktoren auf die Einnahme leistungssteigernder Substanzen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Doping in den Medien dar. Es werden verschiedene Disziplinen, die sich mit Doping beschäftigen, vorgestellt und die Bedeutung der medialen Darstellung von Doping hervorgehoben. Zudem werden die medientheoretischen Grundlagen erläutert, die die zugrunde liegenden Strukturen der printmedialen Berichterstattung aufzeigen.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Doping“ und erläutert seine historische Entwicklung. Dabei werden verschiedene Definitionen von Doping dargestellt und die Unterschiede zwischen den Begriffen „Doping“ und „Neuro-Enhancement“ herausgearbeitet.
Kapitel 3 widmet sich dem theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit. Es werden die Theorien von Bette und Schimank sowie Hobermans vorgestellt, die Doping im Spitzensport und in anderen gesellschaftlichen Kontexten erklären. Die Theorien bieten einen theoretischen Rahmen für die Analyse der medialen Darstellung von Doping in verschiedenen Kontexten.
Kapitel 4 behandelt die medientheoretische Einordnung der Arbeit und erläutert die Realitätskonstruktion durch Medien. Es werden die wichtigsten medientheoretischen Ansätze vorgestellt, die für die Analyse der medialen Darstellung von Doping relevant sind.
Kapitel 5 stellt die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring vor und erläutert die Durchführung der Analyse. Es werden die Auswahlkriterien des Materials, die Analyse der Entstehungssituation und die Auswertungsschritte beschrieben.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse. Die Arbeit analysiert die Ursachen von Doping und die Gefahren, die mit der Einnahme leistungssteigernder Substanzen verbunden sind. Es werden gesellschaftliche Strukturen und individuelles Fehlverhalten als Ursachen für Doping identifiziert.
Kapitel 7 interpretiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse. Die Arbeit untersucht die drei Hypothesen, die mit der Forschungsfrage verknüpft sind. Es werden die Unterschiede in der medialen Darstellung von Doping im Spitzensport und in anderen gesellschaftlichen Kontexten analysiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Doping, Leistungssteigerung, Medien, Berichterstattung, Printmedien, Süddeutsche Zeitung, Inhaltsanalyse, Sport, Studierende, Arbeitnehmer, „Brain-Doping“, Neuro-Enhancement, gesellschaftliche Strukturen, individuelles Fehlverhalten, gesundheitliche Risiken, Nebenwirkungen, mediale Konstruktion, Dopingdiskurs.
- Citation du texte
- Lieske Meiners (Auteur), 2016, Doping in Spitzensport, Studium und Beruf im Spiegel der Presse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353694