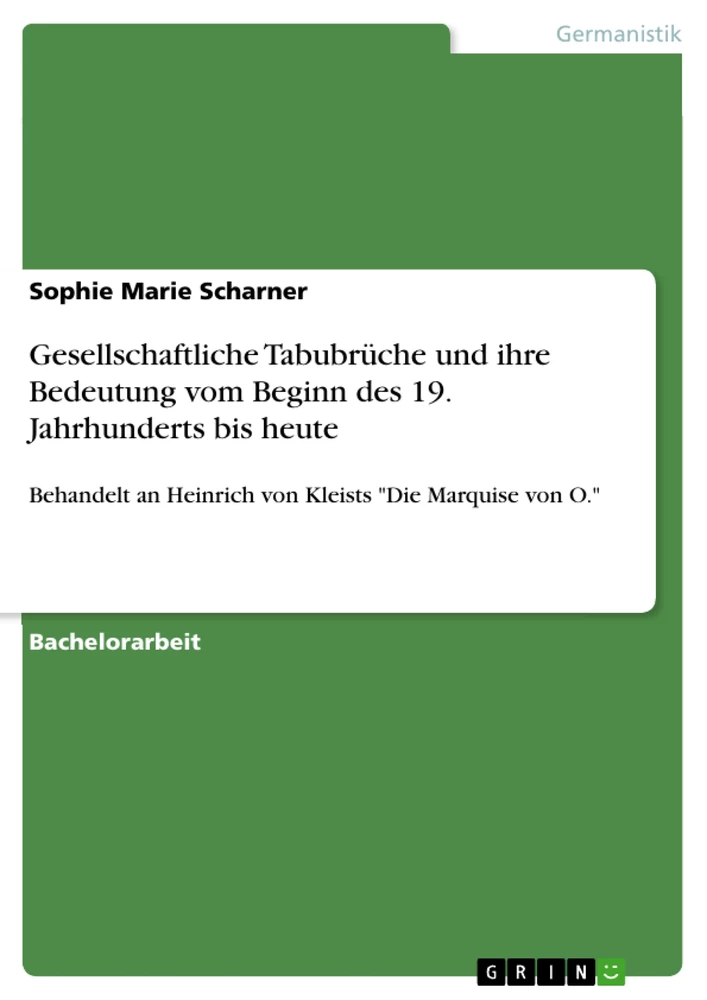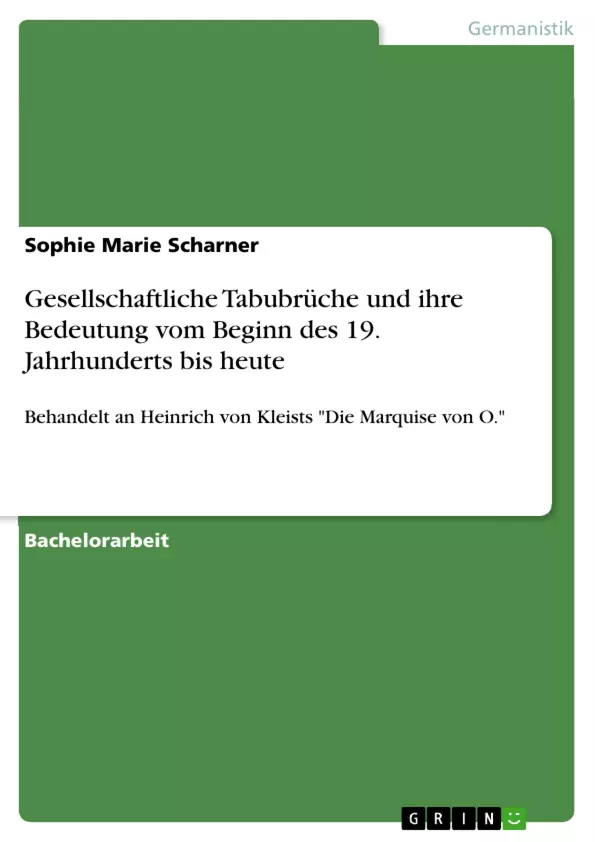Bei der Betrachtung des Textes „Die Marquise von O…“ von Heinrich von Kleist kristallisiert sich ganz klar eine Linie von Tabubrüchen heraus. Hier findet sozusagen eine Anhäufung von moralischen Grenzgängen statt, die Kleist gekonnt in verschiedenster Art und Weise in Szene setzt.
Der Bruch mit den Erzählkonventionen des 19. Jahrhunderts kollidiert heftig mit den damaligen Reaktionen der RezipientInnen. Verbote, Sperren sowie starke Ablehnungen beim Publikum und in den Medien waren nur einige der Auswirkungen. Das alles konnte nur mit dem zeitlichen Voranschreiten der Toleranz oder auch der Modernisierung überbrückt werden. Diese Enttabuisierung, wie sie Kleist beabsichtigt hatte, um vielleicht das Volk zu schockieren, wach zu rütteln und ihnen das wahre erschreckende Gesicht der Gesellschaft als Spiegel vor zu halten, kann als Offenlegung von Scheinheiligkeit unter den Menschen ausgelegt werden.
In der folgenden Arbeit wird nach einer allgemeinen Begriffserläuterung von Tabu und Moral, ein Abriss der Darstellungen Kleists in zwei grundlegende Punkte unterteilt. Einerseits die angedeuteten Tabubrüche, die nicht ausgeschrieben im Text genannt werden, sondern bloß zwischen den Zeilen herausgelesen werden können. Daher implizit von der Leserschaft angenommen werden können, worunter die Vergewaltigung in der Ohnmacht, die uneheliche Schwangerschaft und die überaus erotische Szene zwischen Vater und Tochter fallen. Andererseits die expliziten Grenzüberschreitungen, die direkt und offensichtlich ausgeschrieben in der Erzählung genannt werden. Darunter zählen die Zeitungsannonce, die Flucht der Marquise vor ihren Eltern und die Vermählung der Geschändeten mit dem dafür verantwortlichen Verbrecher.
Mit den drei Diskursen auf religiöser, militärischer und sozialer Ebene bekommt die Sicht auf Tabuverletzungen themenspezifisch dann eine gewisse Unterteilung. Abschließend versucht die im Rahmen des Bachelorseminars verfasste wissenschaftliche Ausführung auch den Wandel der Zeit in den Ansichten der Leserschaft von der ersten Erscheinung des Werkes bis heute wiederzugeben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff Tabu
- 3. Angedeutete Tabubrüche
- 3.1. Verschlafene Vergewaltigung
- 3.2. Uneheliche Schwangerschaft
- 3.3. Beginnende Inzest
- 4. Explizite Grenzüberschreitungen
- 4.1. Das öffentliche Eheversprechen
- 4.2. Verlassen des Elternhauses
- 4.3. Doppelte Hochzeit mit dem Verbrecher
- 5. Der Zwiespalt von gut und böse in drei Diskursen
- 5.1. Aus religiöser Sicht
- 5.2. Auf militärischer Basis
- 5.3. Auf sozialer Ebene
- 6. Im Wandel der Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle „Die Marquise von O...“ im Hinblick auf die Darstellung gesellschaftlicher Tabubrüche zu Beginn des 19. Jahrhunderts und deren Relevanz bis heute.
- Die Darstellung von Tabubrüchen in Kleists Werk
- Die Auswirkungen von Tabubrüchen auf die Gesellschaft
- Die Rolle der Literatur bei der Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen
- Die Veränderung der moralischen Grenzen im Laufe der Zeit
- Die Bedeutung von Tabus für die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Tabubrüche in Kleists Novelle ein und stellt den historischen Kontext sowie die Rezeption der Geschichte dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Tabu“ und definiert die verschiedenen Formen von Tabus, insbesondere im Hinblick auf gesellschaftliche Normen und Moral.
Kapitel 3 analysiert die im Text angedeuteten Tabubrüche, wie die Vergewaltigung in Ohnmacht, die uneheliche Schwangerschaft und die intimste Szene zwischen Vater und Tochter.
In Kapitel 4 werden die expliziten Grenzüberschreitungen in Kleists Werk beleuchtet, darunter die Zeitungsannonce, die Flucht der Marquise vor ihren Eltern und die Hochzeit der Marquise mit dem Täter.
Kapitel 5 untersucht die Darstellung von Tabubrüchen aus drei unterschiedlichen Perspektiven: religiöser, militärischer und sozialer Sicht.
Das sechste Kapitel widmet sich dem Wandel der Zeit in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Tabubrüchen, von Kleists Zeit bis heute.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Tabubruch, Moral, Gesellschaft, Literatur, Heinrich von Kleist, „Die Marquise von O...“, Vergewaltigung, Inzest, uneheliche Schwangerschaft, Dekonstruktion, Zeitgeschichte, Kulturgeschichte.
- Citar trabajo
- Sophie Marie Scharner (Autor), 2013, Gesellschaftliche Tabubrüche und ihre Bedeutung vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353748