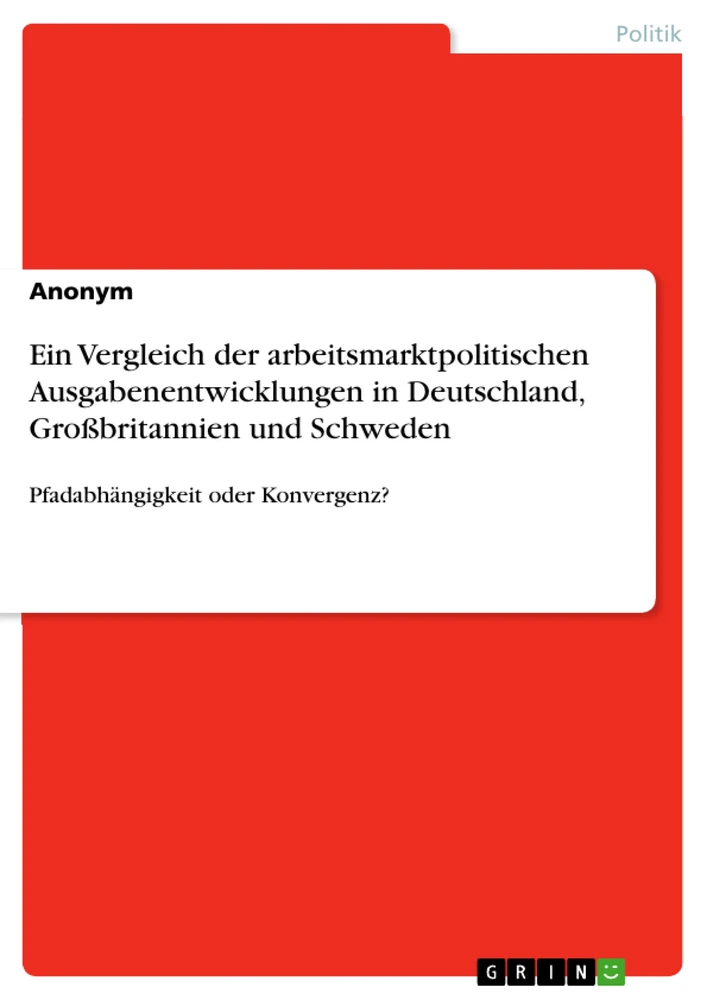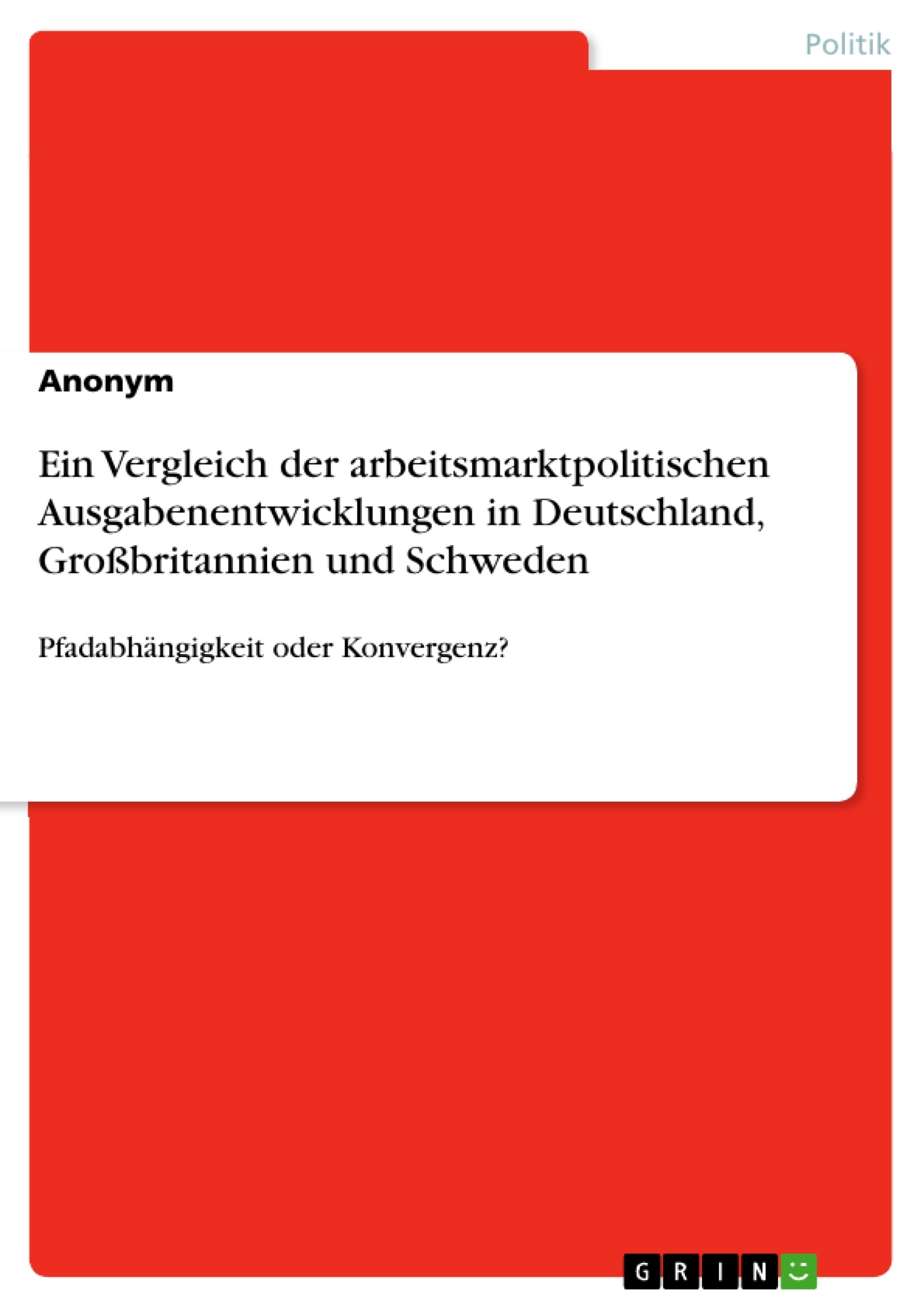Wohlfahrtsstaatlichkeit ist heutzutage ein zentrales Strukturmerkmal aller fortgeschrittenen Demokratien geworden. Eine ausgebaute Sozialpolitik zählt, zusammen mit einer demokratischen Verfassung und Marktwirtschaft, zu den wesentlichen Merkmalen der wirtschaftlich entwickelten westlichen Länder. Doch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts grundlegend verändert. Vielfältige neue Herausforderungen und Problemlagen sind entstanden. Eine der größten dieser Herausforderungen dürfte die Globalisierung mit all ihren Wirkungen und Konsequenzen sein. Unter vielen Ökonomen herrscht Einigkeit darüber, dass die Globalisierung Staaten dazu zwinge, den Sozialstaat billiger zu machen.
Doch was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff Globalisierung? Dieser ist heute sowohl aus der Alltagssprache als auch aus dem wissenschaftlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Genauso unterschiedlich wie dieser Begriff inhaltlich definiert wird, sind auch die Meinung darüber, welche genauen Auswirkungen die „fortschreitende Entgrenzung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“ (Obinger et al. 2009: 33) auf die sozialen Sicherungssysteme der einzelnen Nationalstaaten hat. Von Wohlfahrtsstaatlichkeit als Voraussetzung für Marktöffnung bis zu einem „ruinösen sozialpolitischen Unterbietungswettbewerb“ (Obinger et al. 2009: 35) sind stark gegensätzliche Ansichten vertreten. Neben Globalisierungsprozessen werden auch weitere Faktoren herangezogen und diskutiert, wenn es darum geht, wohlfahrtsstaatlichen Wandel zu erklären. Selbst darüber, ob ein solcher Wandel überhaupt nachweisbar ist, teilen sich die Meinungen der wissenschaftlichen Gemeinde.
Diesem Diskurs soll sich diese Ausarbeitung anschließen, in dem sie überprüft, ob eine konvergente Entwicklung unterschiedlicher Wohlfahrtsstaaten, wie sie im weiteren Verlauf noch näher erklärt werden sollen, festgestellt werden kann. Globalisierung soll dabei als ein möglicherweise wichtiger Faktor behandelt werden, der Anspruch dieser Arbeit besteht allerdings nicht darin, einen empirischen Beweis für Globalisierung als Hauptkriterium für arbeitsmarktpolitischen Wandel zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Esping-Andersen: „The Three Worlds of Welfare Capitalism“
- Globalisierung: Wirkung und Meinungen
- Empirie
- Fazit: Konvergenz oder anhaltende Pfadabhängigkeit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die These einer konvergenten Entwicklung unterschiedlicher Wohlfahrtsstaaten, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsmarktpolitik. Es wird geprüft, ob sich die drei von Esping-Andersen identifizierten Wohlfahrtsregime (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) im Laufe der Zeit angeglichen haben oder ob eine Pfadabhängigkeit fortbesteht. Die Globalisierung wird als potenzieller Einflussfaktor betrachtet, ohne jedoch einen empirischen Beweis für deren Hauptrolle zu liefern.
- Entwicklung unterschiedlicher Wohlfahrtsstaatstypen nach Esping-Andersen
- Auswirkungen der Globalisierung auf nationale Sozialpolitiken
- Konvergenz- oder Pfadabhängigkeitsthese im Kontext der Arbeitsmarktpolitik
- Analyse der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, Großbritannien und Schweden
- Der Einfluss der Dekommodifizierung auf die Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wohlfahrtsstaatlichkeit und deren Wandel im Kontext der Globalisierung ein. Sie betont die Bedeutung des Wohlfahrtsstaats für die Stabilität von Demokratien und Marktwirtschaften, stellt jedoch gleichzeitig die Herausforderungen heraus, die durch die Globalisierung entstanden sind. Es werden gegensätzliche Meinungen über die Auswirkungen der Globalisierung auf soziale Sicherungssysteme diskutiert, von der Notwendigkeit von Wohlfahrtsstaatlichkeit für Marktöffnung bis hin zu einem ruinösen Wettbewerb um Sozialleistungen. Die Arbeit untersucht die Hypothese einer konvergenten Entwicklung unterschiedlicher Wohlfahrtsstaaten am Beispiel Deutschlands, Großbritanniens und Schwedens, wobei die Globalisierung als möglicher Einflussfaktor betrachtet wird.
2. Esping-Andersen: „The Three Worlds of Welfare Capitalism“: Dieses Kapitel stellt die Typologie der Wohlfahrtsstaaten nach Gøsta Esping-Andersen vor. Esping-Andersen definiert drei Wohlfahrtsregime: liberal, konservativ und sozialdemokratisch. Diese unterscheiden sich in den Kriterien Dekommodifizierung (Befreiung von der Marktabhängigkeit), Stratifizierung (Förderung oder Beseitigung von Ungleichheiten) und dem Verhältnis zwischen Markt, Staat und Familie. Der liberale Typ zeichnet sich durch niedrige, bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen aus, der konservative durch Leistungen, die traditionell familiäre Strukturen bevorzugen, und der sozialdemokratische durch universelle und gleichberechtigte Leistungen. Die Arbeit nutzt diese Typologie als theoretische Grundlage für den Vergleich der ausgewählten Länder.
3. Globalisierung: Wirkung und Meinungen: Das Kapitel beleuchtet die Debatte über die Auswirkungen der Globalisierung auf nationale Sozialpolitiken. Es werden die divergierenden Meinungen dargestellt: die Warnung vor einem internationalen Wettlauf nach unten bei Sozialstandards steht der These einer pfadabhängigen Entwicklung nationaler Sozialpolitiken gegenüber. Die Debatte um den Einfluss der Globalisierung auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten wird als ein vergleichsweise junges Forschungsfeld beschrieben, in dem die Meinungen der Experten stark auseinandergehen.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Konvergenz, Pfadabhängigkeit, Arbeitsmarktpolitik, Deutschland, Großbritannien, Schweden, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Konvergenz oder anhaltende Pfadabhängigkeit von Wohlfahrtsstaaten?
Was ist der Gegenstand der Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht die These einer konvergenten Entwicklung unterschiedlicher Wohlfahrtsstaaten, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsmarktpolitik. Es wird geprüft, ob sich die drei von Esping-Andersen identifizierten Wohlfahrtsregime (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) im Laufe der Zeit angeglichen haben oder ob eine Pfadabhängigkeit fortbesteht. Die Globalisierung wird als potenzieller Einflussfaktor betrachtet.
Welche Länder werden in der Ausarbeitung untersucht?
Die Ausarbeitung analysiert die Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, Großbritannien und Schweden, um die Konvergenz- oder Pfadabhängigkeitsthese zu überprüfen.
Welche Rolle spielt Esping-Andersen in der Ausarbeitung?
Die Arbeit nutzt die Typologie der Wohlfahrtsstaaten nach Gøsta Esping-Andersen (liberale, konservative und sozialdemokratische Regime) als theoretische Grundlage für den Vergleich der ausgewählten Länder. Die drei Regime unterscheiden sich in den Kriterien Dekommodifizierung, Stratifizierung und dem Verhältnis zwischen Markt, Staat und Familie.
Wie wird die Globalisierung in der Ausarbeitung behandelt?
Die Globalisierung wird als potenzieller Einflussfaktor auf nationale Sozialpolitiken betrachtet. Die Ausarbeitung beleuchtet die divergierenden Meinungen zur Wirkung der Globalisierung: von der Warnung vor einem internationalen Wettlauf nach unten bis zur These einer pfadabhängigen Entwicklung nationaler Sozialpolitiken. Es wird jedoch kein empirischer Beweis für die Hauptrolle der Globalisierung geliefert.
Welche zentralen Konzepte werden in der Ausarbeitung verwendet?
Die wichtigsten Konzepte sind Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Konvergenz, Pfadabhängigkeit und die Typologie der Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Ausarbeitung?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob eine Konvergenz oder eine anhaltende Pfadabhängigkeit in der Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten, speziell im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, zu beobachten ist. Der Einfluss der Globalisierung auf diesen Prozess wird dabei ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Esping-Andersen's Typologie der Wohlfahrtsstaaten, ein Kapitel zur Globalisierung und deren Wirkung, ein empirisches Kapitel und ein Fazit, welches die Frage nach Konvergenz oder Pfadabhängigkeit beantwortet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Ausarbeitung?
Das Fazit der Ausarbeitung wird die Frage beantworten, ob eine Konvergenz oder eine anhaltende Pfadabhängigkeit der Wohlfahrtsstaaten im untersuchten Zeitraum zu beobachten ist. Die genaue Schlussfolgerung wird im Text selbst dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Ausarbeitung am besten?
Schlüsselwörter sind: Wohlfahrtsstaat, Globalisierung, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Konvergenz, Pfadabhängigkeit, Arbeitsmarktpolitik, Deutschland, Großbritannien, Schweden, Sozialpolitik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Ein Vergleich der arbeitsmarktpolitischen Ausgabenentwicklungen in Deutschland, Großbritannien und Schweden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354223