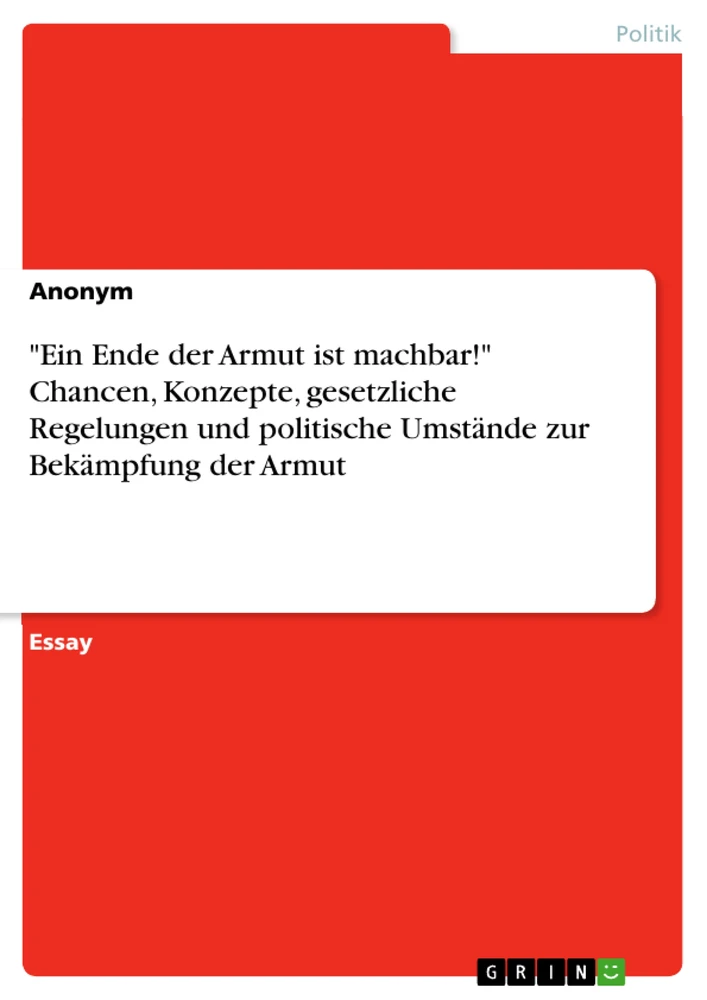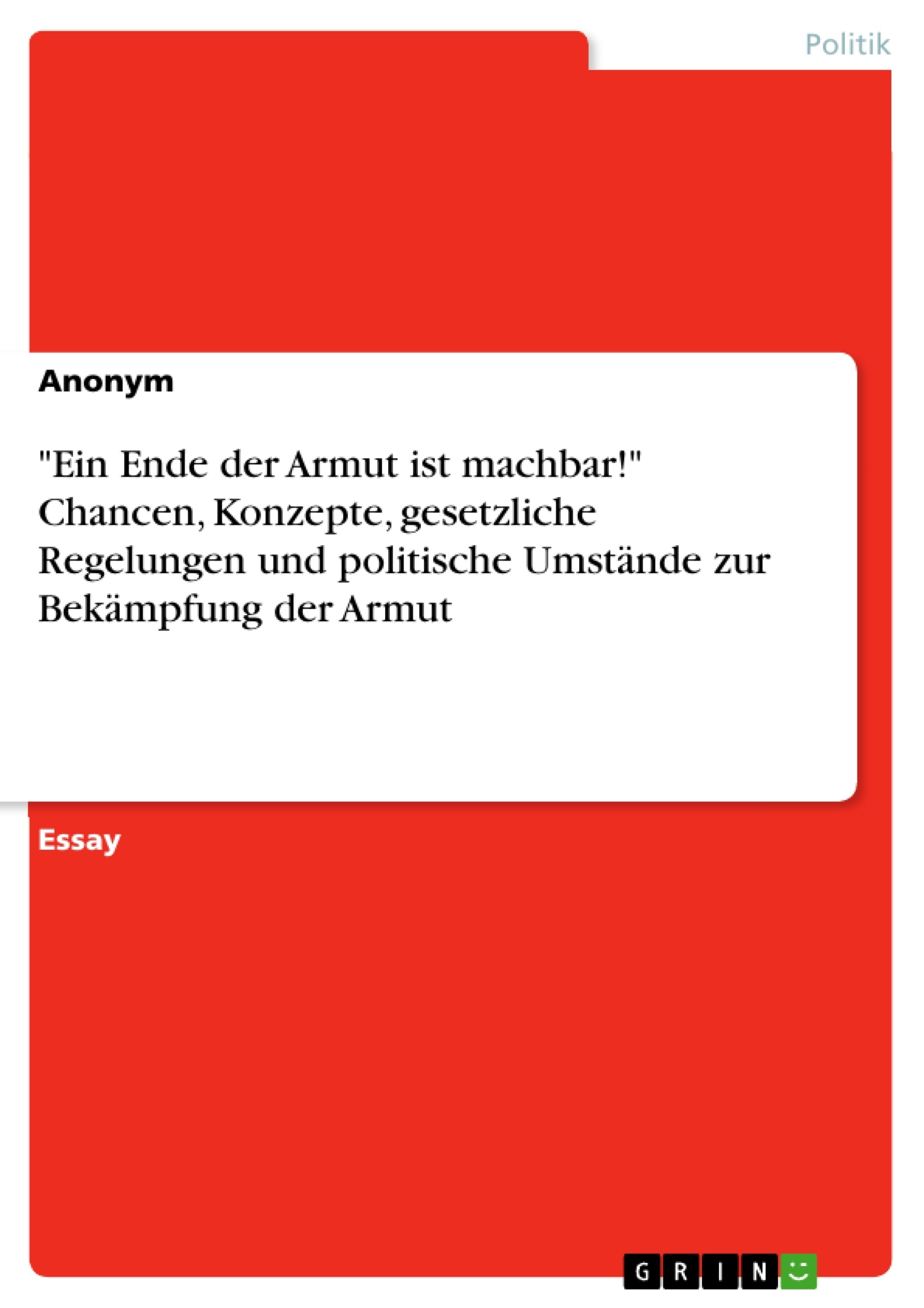Kann das historische Phänomen Armut überhaupt beendet werden? In diesem Essay möchte der Autor diese Frage kritisch diskutieren. Dabei setzt er sich mit verschiedenen Armutsdefinitionen und -konzepten auseinander und beleuchtet diese auf ein mögliches Ende der Armut hin. Ausgangspunkte bilden dabei die englischen Armengesetze von 1597, die als erste institutionalisierte staatliche Reaktion auf Armut gelten.
Des Weiteren werden Ansätze, die sich ab dem neunzehnten Jahrhundert wissenschaftlich mit der Erfassung und Erforschung des sozialen Phänomens beschäftigen, herangezogen. Wie herausgearbeitet werden soll, spielen diese in der öffentlichen Debatte um Armut und ihr mögliches Ende eine wichtige Rolle.
Nach seiner Analyse wird der Autor zu dem Schluss kommen, dass die These vom machbaren Ende der Armut nicht nur aufgrund ihres unterkomplexen Armutsverständnisses verworfen werden muss, sondern auch unter politischen und machtkritischen Gesichtspunkten bedenklich ist.
„Ein Ende der Armut ist machbar!“ Diese These vertritt der amerikanische Starökonom Jeffrey D. Sachs in seinem 2005 erschienen Buch mit dem passenden Titel „The End of Poverty“. Unsere Generation, ist Sachs überzeugt, sei in der Lage, die extreme Armut bis zum Jahr 2025 ein für alle Mal zu beenden. Die Idee vom Ende der Armut ist heute mehr als eine Vision einzelner. Seit der Verabschiedung der Milleniumsziele im Jahr 2000 ist es erklärtes Ziel der internationalen Gemeinschaft. In den 2015 beschlossenen Zielen für nachhaltige Entwicklung wird gar proklamiert, man wolle ein „end of poverty in all ist forms everywhere“ erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Armutskonzepte
- 2.1 Armutsbekämpfung in England und ihre Kritiker
- 2.2 Anfänge der empirischen Armutsforschung
- 2.3 Ende und Wiederentdeckung der Armut
- 2.4 Multidimensionale Armut
- 3. Diskussion der These
- 3.1 Sinnhaftigkeit eines absoluten Armutsbegriffs
- 3.2 Armut als soziologisches Phänomen
- 3.3 Armut und Macht
- 4. Fazit
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht kritisch die These „Ein Ende der Armut ist machbar!“. Er analysiert verschiedene Armutsdefinitionen und -konzepte im historischen Kontext, beginnend mit den englischen Armengesetzen. Die Arbeit beleuchtet wissenschaftliche Ansätze zur Erfassung und Erforschung von Armut und deren Rolle in der öffentlichen Debatte.
- Historische Entwicklung von Armutsverständnissen und -bekämpfung
- Analyse verschiedener Armutskonzepte und -definitionen
- Die Rolle von Macht und Politik in der Armutsfrage
- Kritische Auseinandersetzung mit der These vom machbaren Ende der Armut
- Empirische Armutsforschung und deren Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These „Ein Ende der Armut ist machbar!“ vor, wie sie von Jeffrey D. Sachs vertreten wird, und setzt sie in den Kontext der Millenniumsziele und der Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Der Essay kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit dieser These an, indem er verschiedene Armutsdefinitionen und -konzepte untersucht und deren Relevanz für ein mögliches Ende der Armut beleuchtet. Die Analyse wird sich auf historische und wissenschaftliche Ansätze konzentrieren und zu dem Schluss führen, dass die These aufgrund eines zu vereinfachten Armutsverständnisses und aus politischen sowie machtkritischen Gründen fragwürdig ist.
2. Armutskonzepte: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Armutskonzepten und deren historischen Entwicklung. Es beginnt mit einer Betrachtung der englischen Armengesetze von 1597, die als erste institutionalisierte Reaktion auf Armut gelten. Es wird die Entwicklung von karitativer Armenfürsorge bis hin zu staatlichen Interventionen analysiert, einschließlich der Speenhamland-Tabelle und deren Kritik. Die Kapitel beleuchten die unterschiedlichen Perspektiven von Kritikern wie Joseph Townsend, Thomas Malthus und Jeremy Bentham, die die Machbarkeit eines „Endes der Armut“ vehement bestritten und alternative Ansätze vorgeschlagen haben. Die unterschiedlichen Ansätze verdeutlichen die Komplexität der Armutsfrage und die Schwierigkeit einer einheitlichen Definition.
3. Diskussion der These: Kapitel 3 diskutiert die These „Ein Ende der Armut ist machbar!“ vor dem Hintergrund der vorherigen Analysen. Es untersucht die Sinnhaftigkeit eines absoluten Armutsbegriffs, betrachtet Armut als soziologisches Phänomen und beleuchtet den Zusammenhang von Armut und Macht. Dieses Kapitel wird die bisherigen Erkenntnisse zusammenführen und die Hauptargumente gegen die These vom machbaren Ende der Armut darlegen, basierend auf den komplexen und multifaktoriellen Aspekten von Armut und deren tiefgreifende gesellschaftliche Verankerung. Es wird eine kritische Perspektive auf die vereinfachte Darstellung von Armut in politischen Diskursen eingenommen.
Schlüsselwörter
Armut, Armutsbekämpfung, Armutskonzepte, England, Armengesetze, empirische Armutsforschung, Macht, Soziologie, Millenniumsziele, Nachhaltige Entwicklung, Jeffrey D. Sachs, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: „Ein Ende der Armut ist machbar!“
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht kritisch die These „Ein Ende der Armut ist machbar!“, analysiert verschiedene Armutsdefinitionen und -konzepte im historischen Kontext und beleuchtet wissenschaftliche Ansätze zur Erfassung und Erforschung von Armut und deren Rolle in der öffentlichen Debatte. Die Analyse konzentriert sich auf die historische Entwicklung von Armutsverständnissen, verschiedene Armutskonzepte, die Rolle von Macht und Politik, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der These vom machbaren Ende der Armut.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Der Essay beginnt mit den englischen Armengesetzen von 1597 und analysiert die Entwicklung von karitativer Armenfürsorge bis hin zu staatlichen Interventionen. Er beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Kritikern wie Joseph Townsend, Thomas Malthus und Jeremy Bentham, die die Machbarkeit eines „Endes der Armut“ bestritten.
Welche Armutskonzepte werden diskutiert?
Der Essay behandelt verschiedene Armutskonzepte, darunter ein absoluter Armutsbegriff und die Betrachtung von Armut als soziologisches Phänomen. Die multidimensionale Armut wird ebenfalls thematisiert. Die Arbeit zeigt die Komplexität der Armutsfrage und die Schwierigkeit einer einheitlichen Definition auf.
Welche Rolle spielt Macht im Zusammenhang mit Armut?
Der Essay beleuchtet den Zusammenhang von Armut und Macht und nimmt eine kritische Perspektive auf die vereinfachte Darstellung von Armut in politischen Diskursen ein. Die Rolle von Macht und Politik in der Armutsfrage wird ausführlich analysiert.
Wie wird die These „Ein Ende der Armut ist machbar!“ bewertet?
Der Essay bewertet die These kritisch und argumentiert, dass sie aufgrund eines zu vereinfachten Armutsverständnisses und aus politischen sowie machtkritischen Gründen fragwürdig ist. Die komplexen und multifaktoriellen Aspekte von Armut und deren tiefgreifende gesellschaftliche Verankerung werden als Hauptargumente gegen die These angeführt.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay ist gegliedert in eine Einleitung, ein Kapitel zu Armutskonzepten, ein Kapitel zur Diskussion der These, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Das Kapitel zu Armutskonzepten behandelt unter anderem die englischen Armengesetze, die Anfänge der empirischen Armutsforschung und die multidimensionale Armut. Das Kapitel zur Diskussion der These untersucht die Sinnhaftigkeit eines absoluten Armutsbegriffs, Armut als soziologisches Phänomen und den Zusammenhang von Armut und Macht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Essay?
Schlüsselwörter sind: Armut, Armutsbekämpfung, Armutskonzepte, England, Armengesetze, empirische Armutsforschung, Macht, Soziologie, Millenniumsziele, Nachhaltige Entwicklung, Jeffrey D. Sachs, kritische Analyse.
Wer wird als Vertreter der These „Ein Ende der Armut ist machbar!“ genannt?
Jeffrey D. Sachs wird im Essay als Vertreter der These „Ein Ende der Armut ist machbar!“ genannt, wobei seine These im Kontext der Millenniumsziele und der Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen eingeordnet wird.
Welche Forschungsansätze werden betrachtet?
Der Essay befasst sich mit der empirischen Armutsforschung und deren Bedeutung für das Verständnis und die Bekämpfung von Armut. Die verschiedenen wissenschaftlichen Ansätze zur Erfassung und Erforschung von Armut werden kritisch analysiert.
Wie ist der Essay strukturiert?
Der Essay enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Diese Elemente unterstützen den Leser beim Verständnis und der Navigation durch den Text.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, "Ein Ende der Armut ist machbar!" Chancen, Konzepte, gesetzliche Regelungen und politische Umstände zur Bekämpfung der Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354465