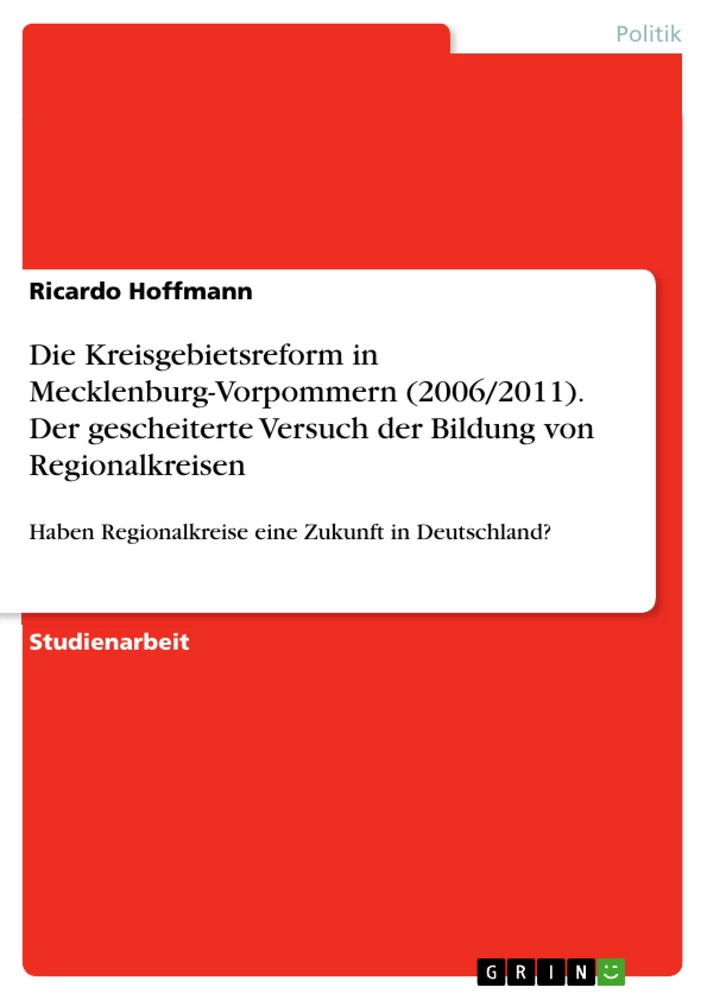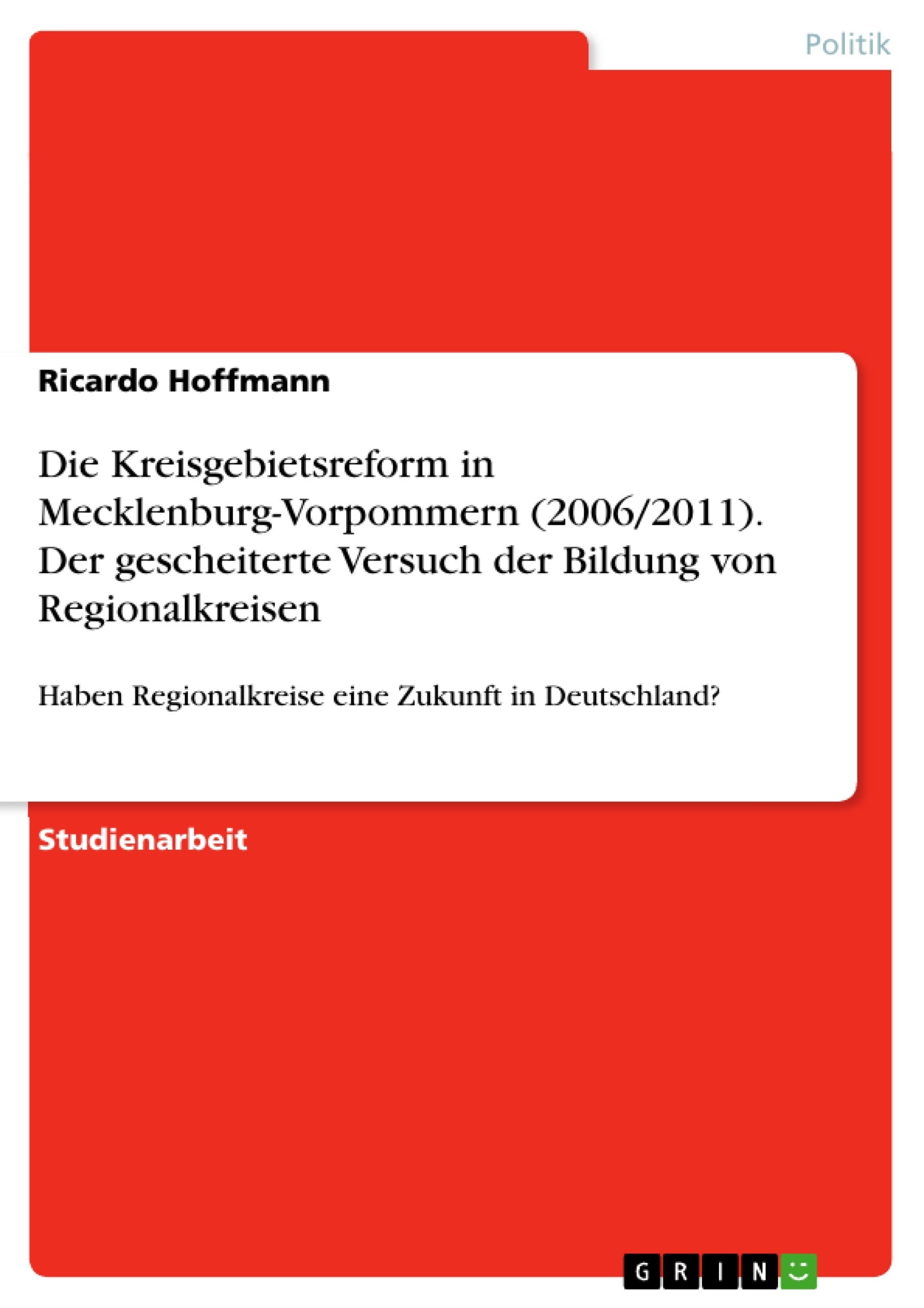Betrachtet man die Verwaltungsreformen des 21. Jahrhunderts genauer, so scheint insgesamt eine Tendenz in Richtung größerer Verwaltungseinheiten beobachtbar zu sein. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat sich aufgrund der strukturellen Herausforderungen im Jahre 2006 mit dem Verwaltungsmodernisierungsgesetz – in seinem Kernstück bestehend aus gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Kreisstruktur und einer Funktionalreform – für einen gesamtheitlichen Reformansatz entschieden.
Unter anderem hat der Gesetzgeber des deutschlandweit am dünnsten besiedelten Bundeslands mit der Bildung von fünf Regional- bzw. Großkreisen als erstes Bundesland versucht, solch ein Reformvorhaben durchzusetzen. Dabei ist er allerdings am Urteil seines Landesverfassungsgerichts in Greifswald mit Urteil vom 26. Juli 2007 gescheitert, in dem das Gesetz für verfassungswidrig erklärt wurde. So kritisierten die Greifswalder Verfassungsrichter in ihrem in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutierten Urteil, dass das Verwaltungsmodernisierungsgesetz wegen des Verstoßes gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht verstoßen würde. Darüber hinaus habe der Gesetzgeber keine schonenderen Alternativen in einem notwendigen Abwägungsprozess berücksichtigt.
Es kann überdies konstatiert werden, dass der Faktor „Raum“ bzw. „Größe“ in Bezug auf die Neugliederung von Territorialeinheiten (hier den Landkreisen) einen besonderen Faktor einnimmt. Bei sämtlichen Eingriffen in das zuvor erwähnte Selbstverwaltungsrecht dürfe der Fokus nicht alleinig auf der Verbesserung bzw. Einführung von effizienten und effektiven Strukturen liegen, sondern muss das Wesensmerkmal der bürgerschaftlich-demokratischen Entscheidungsfindung ebenso in den Abwägungsprozess miteinbeziehen.
Diese kurzen einführenden Worte lassen bereits anklingen, dass Verwaltungsreformen „nicht unbedingt das einfachste Geschäft einer Landesregierung dar[stellen]“. Gleichermaßen herausfordernd ist es, einen dermaßen von Komplexität geprägten Reformprozess ganzheitlich zu analysieren, sodass eine Einschränkung des Analysefokus auf die Bildung von Regionalkreisen sinnvoll erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Status quo in Mecklenburg im 21. Jahrhundert: Probleme und grundlegender Handlungsbedarf
- Reformoptionen: Vier Modelle als Idealtypen von Veränderungen
- Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) als Kooperationsansatz (Modell 1)
- Reformvarianten mit Gebietsveränderung: Punkt-, Paar- und Regionalmodell
- Punktmodell / Punktuelle Anpassung (Modell 2)
- Paarmodell / Reform mittlerer Reichweite (Modell 3)
- Regionalmodell (Modell 4)
- Mecklenburg-Vorpommern: Regionalmodell - Urteil – Paarmodell?!
- Der erste Anlauf in Mecklenburg-Vorpommern: Die Regionalkreisbildung
- Das Scheitern der Regionalkreisbildung: Begründungen des Urteils von 2007
- Der zweite Anlauf in Mecklenburg-Vorpommern: Lehren aus dem Urteil?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2006/2011, insbesondere mit dem gescheiterten Versuch der Bildung von Regionalkreisen. Sie untersucht die Hintergründe, die Reformoptionen, den Verlauf des Reformprozesses und die Gründe für das Scheitern der Regionalkreisbildung. Darüber hinaus wird die Frage aufgeworfen, ob Regionalkreise eine Zukunft in Deutschland haben.
- Der Status quo der Kreisstruktur in Mecklenburg-Vorpommern vor der Reform
- Die verschiedenen Reformoptionen für die Kreisgebietsstruktur
- Der Prozess der Regionalkreisbildung in Mecklenburg-Vorpommern
- Die Gründe für das Scheitern der Regionalkreisbildung
- Die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung im Kontext der Kreisgebietsreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern ein und stellt die Forschungsfrage nach der Zukunft von Regionalkreisen in Deutschland. Kapitel 2 beleuchtet den Status quo der Kreisstruktur in Mecklenburg-Vorpommern vor der Reform, wobei die Herausforderungen des demografischen Wandels und die finanzielle Situation der Landkreise im Vordergrund stehen. Kapitel 3 präsentiert vier idealtypische Reformoptionen für Kreisgebietsreformen und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Kapitel 4 analysiert den Prozess der Regionalkreisbildung in Mecklenburg-Vorpommern, das Scheitern der Reform und die Gründe für das Urteil des Landesverfassungsgerichts. Der Fokus liegt dabei auf dem Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe.
Schlüsselwörter
Kreisgebietsreform, Regionalkreise, Mecklenburg-Vorpommern, kommunale Selbstverwaltung, Verwaltungsmodernisierung, demografischer Wandel, Effizienz, Effektivität, Bürgernähe, Urteil des Landesverfassungsgerichts.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Bildung von Regionalkreisen in Mecklenburg-Vorpommern?
Das Landesverfassungsgericht erklärte das Gesetz 2007 für verfassungswidrig, da es gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht verstieß und Alternativen nicht ausreichend geprüft wurden.
Was war das Ziel der Kreisgebietsreform 2006?
Das Hauptziel war die Schaffung effizienterer Verwaltungsstrukturen als Reaktion auf den demografischen Wandel und finanzielle Herausforderungen.
Welche Reformmodelle wurden diskutiert?
Es wurden vier Modelle betrachtet: Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ), Punktmodell, Paarmodell und das Regionalmodell (Großkreise).
Welche Rolle spielt die Bürgernähe bei Gebietsreformen?
Bürgernähe ist ein Wesensmerkmal der demokratischen Entscheidungsfindung. Kritiker bemängelten, dass Großkreise die Distanz zwischen Bürger und Verwaltung zu stark vergrößern.
Was ist das "Regionalmodell" in der Verwaltungsreform?
Das Regionalmodell sieht die Verschmelzung mehrerer kleiner Landkreise zu sehr großen Verwaltungseinheiten vor, um Skaleneffekte zu nutzen.
- Citar trabajo
- Ricardo Hoffmann (Autor), 2015, Die Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern (2006/2011). Der gescheiterte Versuch der Bildung von Regionalkreisen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354610