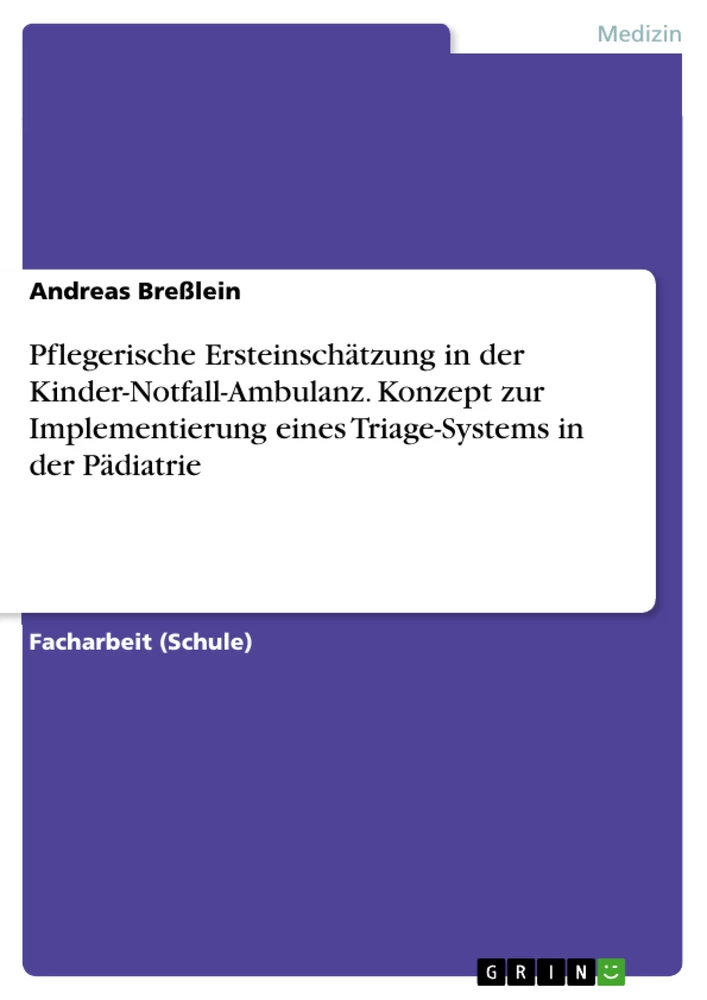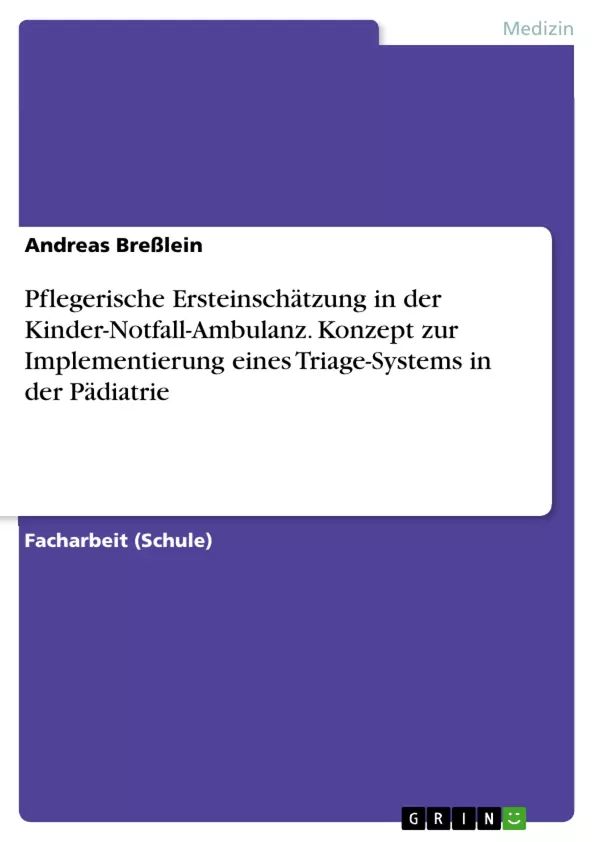Wird ein Kind krank, sind die unmittelbaren Bezugspersonen - in unterschiedlicher Ausprägung, je nach Schwere und individueller Wahrnehmung der Erkrankung - zunächst besorgt. Sie suchen mit ihrem Kind ärztliche Hilfe auf, erwarten Zuwendung, professionelles Handeln, eine schnelle Diagnose und zeitnahe Behandlung und Linderung der Beschwerden.
Der Erstkontakt zwischen dem erkrankten Kind und der Kinder- und Jugendmedizin (und somit auch und - wie sich zeigen wird - primär der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) findet in Deutschland außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten der niedergelassenen Kinderärztinnen in aller Regel im Aufnahmebereich des nächst liegenden Krankenhauses statt, oft in der inneren oder chirurgischen Aufnahme eines kleinen Krankenhauses, oder - bei günstiger Wohnsituation bzw. kurzem Anfahrtsweg - in einer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit dazugehörigem Aufnahmebereich, der pädiatrischen Aufnahme bzw. Notfall-Ambulanz.
Nach Erledigung der Aufnahmeformalitäten werden Kind und Eltern gebeten, im Wartebereich Platz zu nehmen, womit die eingangs erwähnten Erwartungen allerdings noch nicht ansatzweise erfüllt sind: Wenngleich das „Warten“ im „Er-Warten“ steckt, führen doch als unangemessen lang empfundene Wartezeiten zu gesteigerter Besorgnis, Nachfragen, Unmut und letztlich auch zu Beschwerden. Im ungünstigsten Fall verlassen die Eltern mit ihrem Kind ohne Arztkontakt die Notfall-Ambulanz.
Der Verfasser ist Kinderkrankenpfleger und arbeitet als Praxisanleiter und stellvertretende Stationsleitung auf einer Kinderstation mit angeschlossener pädiatrischer Aufnahme / Notfall-Ambulanz. Mit dieser Facharbeit beschreibt er, wie durch die Implementierung eines standardisierten Systems der pflegerischen Ersteinschätzung und Erfassung der Behandlungsdringlichkeit zu sinnvoll aufeinander abgestimmten transparenten Handlungsabläufen beigetragen werden soll. Er möchte ferner sicherstellen, dass durch festgelegte Kriterien ein sofortiges Behandeln schwerst erkrankter Kinder erfolgt, zugleich aber auch den Wartenden Respekt und Empathie entgegengebracht wird.
Mit der Implementierung seines Konzeptes möchte er mittels Einbindung aller Beteiligten letztlich Sicherheit und Zufriedenheit im Mitarbeiterinnen-Team schaffen. Ziel dieser Facharbeit ist es, den Weg zur Implementierung des Manchester-Triage-Systems in der Pädiatrie zu begleiten, zu beschreiben und zu evaluieren.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 2 TRIAGE - ERSTEINSCHÄTZUNG IN DER NOTFALLAMBULANZ
- 2.1 Verschiedene Triage-Modelle
- 2.2 Das Manchester-Triage-System (MTS)
- 3 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EINE PROZESSOPTIMIERUNG
- 4 VORSTELLUNG DER EINRICHTUNG - DAS KLINIKUM
- 4.1 Qualitätsmanagement
- 4.2 Vorstellung eigener Bereich - Die Kinderklinik
- 4.2.1 Die Kinder- und Jugendstation
- 4.2.2 Die Kinder- Notfallambulanz
- 5 IST-ANALYSE
- 6 KONZEPTERSTELLUNG
- 6.1 Zielsetzung im Konzept
- 6.2 Maßnahmen im Konzept
- 6.2.1 Mitarbeiterinnen-Befragung
- 6.2.2 Qualitätszirkel
- 7 FÜHRUNGSAUFGABEN DER FLP
- 7.1 Motivation und Implementierung
- 7.2 Evaluation
- 8 FAZIT
- 9 LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der Implementierung eines standardisierten Triage-Systems in der pädiatrischen Notfallambulanz. Ziel ist es, einen transparenten und effizienten Prozess für die pflegerische Ersteinschätzung zu schaffen, der die Behandlungsdringlichkeit von erkrankten Kindern schnell und zuverlässig erfasst. Dadurch soll die Behandlung schwerstkranker Kinder priorisiert werden, während gleichzeitig Wartenden Respekt und Transparenz entgegengebracht werden. Das Konzept soll die Sicherheit und Zufriedenheit im Mitarbeiterteam verbessern.
- Pflegerische Ersteinschätzung in der Kinder-Notfall-Ambulanz
- Implementierung eines Triage-Systems
- Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement
- Motivation und Implementierung eines neuen Konzepts
- Evaluation des Triage-Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Facharbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung einer schnellen und zuverlässigen pflegerischen Ersteinschätzung in der Kinder-Notfall-Ambulanz hervorhebt. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff „Triage“ und stellt verschiedene Modelle der pflegerischen Ersteinschätzung vor, darunter das Manchester-Triage-System (MTS). Kapitel 3 befasst sich mit den Rahmenbedingungen für eine Prozessoptimierung, einschließlich der Anforderungen des Qualitätsmanagements und der gesetzlichen Grundlagen.
Kapitel 4 bietet einen Einblick in die Organisationsstruktur der Einrichtung, insbesondere in den pädiatrischen Wirkungsbereich. Kapitel 5 analysiert den Ist-Zustand in den Arbeitsabläufen und identifiziert vorhandene Probleme und Ressourcen. Kapitel 6 stellt das Konzept zur Implementierung des MTS vor, einschließlich der Zielsetzung und Maßnahmen wie Mitarbeiterbefragungen und Qualitätszirkel. Kapitel 7 behandelt die Führungsaufgaben der Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege (FLP) in Bezug auf Motivation, Implementierung und Evaluation des Konzepts. Die Facharbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und die Bedeutung der Implementierung des MTS für die Verbesserung der Patientenversorgung hervorhebt.
Schlüsselwörter
Triage, Pflegerische Ersteinschätzung, Kinder-Notfall-Ambulanz, Manchester-Triage-System (MTS), Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement, Motivation, Implementierung, Evaluation
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Manchester-Triage-System (MTS)?
Es ist ein standardisiertes System zur Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit in Notfallambulanzen, das Patienten nach festgelegten Kriterien Farbgruppen zuordnet.
Warum ist eine Triage in der Pädiatrie besonders wichtig?
Sie stellt sicher, dass schwerst erkrankte Kinder sofort behandelt werden, während gleichzeitig die Transparenz für wartende Eltern erhöht wird.
Wie verbessert das System die Zufriedenheit im Team?
Klare Handlungsabläufe und Kriterien reduzieren den Stress für das Pflegepersonal und schaffen Sicherheit bei der Priorisierung von Patienten.
Welche Rolle spielt das Qualitätsmanagement bei der Implementierung?
Die Einführung des MTS ist Teil einer Prozessoptimierung, die durch Qualitätszirkel und Mitarbeiterbefragungen begleitet und evaluiert wird.
Was passiert, wenn Eltern die Notfall-Ambulanz vorzeitig verlassen?
Das Konzept zielt darauf ab, genau dies zu verhindern, indem durch Triage eine zeitnahe Einschätzung erfolgt und Besorgnis durch Empathie und Information gemindert wird.
- Citation du texte
- Andreas Breßlein (Auteur), 2014, Pflegerische Ersteinschätzung in der Kinder-Notfall-Ambulanz. Konzept zur Implementierung eines Triage-Systems in der Pädiatrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354746