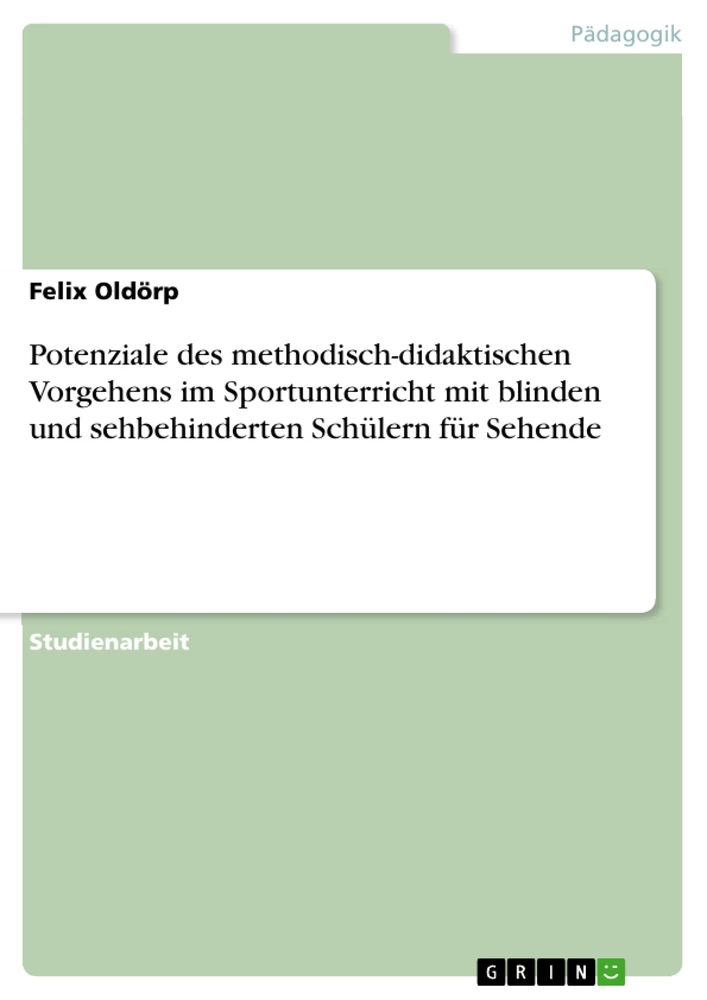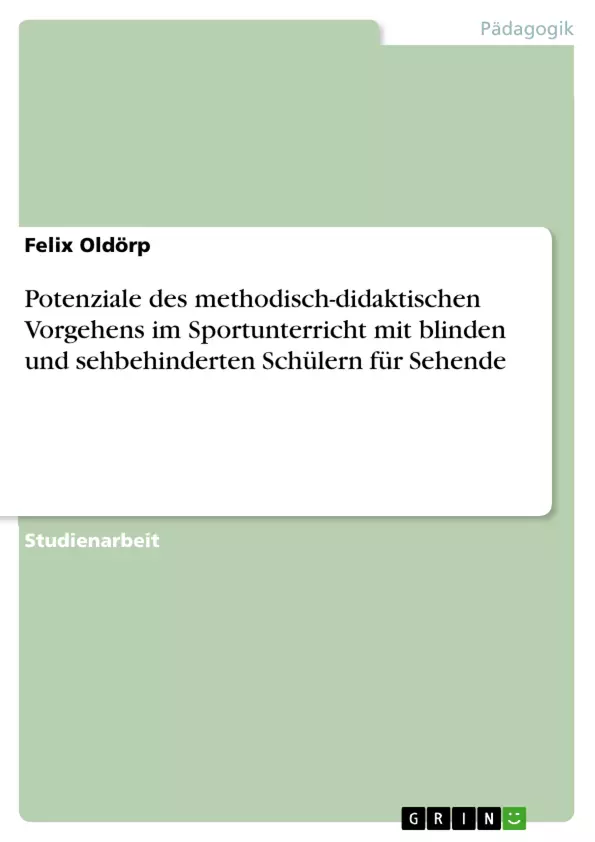Bewegung ist eine Grundlage für die Beschäftigung mit der (Um-)Welt. Im Sportunterricht mit Sehenden nehmen Bewegungsdemonstrationen sowie verbale Zusatzinformationen eine zentrale Rolle ein. In der Regel werden von den Schülerinnen und Schülern lückenhafte Instruktionen und Aufgabenstellungen der Lehrkraft oder fehlendes Vorwissen visuell kompensiert. Genauso wie Sprache liefert auch der Seheindruck kein objektives Abbild der Wirklichkeit und die (zum Teil zufällig) gewonnen Informationen aus der Bewegungsdemonstration werden abhängig von den Vorerfahrungen der Lernenden zu Bewegungsvorstellungen unterschiedlicher Qualität zusammengesetzt.
Blinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler weisen häufig Lücken in ihren Bewegungsvorstellungen auf, da sie in ihrer Entwicklung qualitativ und quantitativ weniger Bewegungserfahrungen sammeln konnten. Aber auch sehende Kinder und Jugendliche bewegen sich heutzutage immer weniger. Sie besitzen zwar z. T. implizit das Bewegungswissen durch Fernsehen und Computerspiele, haben jedoch keine oder wenige eigene Bewegungserfahrungen gemacht.
Auf dieser Grundlage und im Sinne eines inklusiven Schulsports versucht die Arbeit zu klären, ob das methodisch-didaktische Vorgehen im Sport- und Bewegungsunterricht mit blinden und sehbehinderten Menschen auf den Unterricht mit Sehenden übertragbar ist. Dazu werden in Kapitel 2 die Begriffe Blindheit und Sehbehinderung und die motorischen Besonderheiten der Zielgruppe näher erläutert. Kapitel 3 beschreibt methodisch-didaktische Überlegungen für den Sportunterricht mit sehenden und nicht-sehenden Schülern auf Grundlage eines sinn- und erfahrungsorientierten Sportunterrichts. Im letzten Kapitel folgt ein Resümee mit den gewonnen Erkenntnissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Blindheit und Sehbehinderung
- 2.1 Definition
- 2.2 Motorische Besonderheiten
- 3. Methodisch-didaktische Überlegungen für den Sportunterricht mit sehenden und nicht-sehenden Schülern
- 3.1 Eckpunkte eines sinn- und erfahrungsorientierten Sportunterrichts
- 3.2 Kritische Betrachtung des sinn- und erfahrungsorientierten Sportunterrichts
- 4. Zusammenfassung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Übertragbarkeit methodisch-didaktischer Vorgehensweisen im Sportunterricht mit blinden und sehbehinderten Menschen auf den Unterricht mit sehenden Schülern. Sie untersucht, ob ein sinn- und erfahrungsorientierter Sportunterricht, der auf die Bedürfnisse von sehgeschädigten Schülern zugeschnitten ist, auch für sehende Schüler gewinnbringend sein kann.
- Definition von Blindheit und Sehbehinderung
- Motorische Besonderheiten bei sehgeschädigten Menschen
- Eckpunkte eines sinn- und erfahrungsorientierten Sportunterrichts
- Kritische Betrachtung des sinn- und erfahrungsorientierten Sportunterrichts
- Übertragbarkeit der methodisch-didaktischen Vorgehensweisen auf den Unterricht mit sehenden Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz des Sportunterrichts für blinde und sehbehinderte Schüler im Kontext der Inklusion. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Definitionen von Blindheit und Sehbehinderung sowie den motorischen Besonderheiten der Zielgruppe. Kapitel 3 analysiert die Übertragbarkeit von methodisch-didaktischen Vorgehensweisen im Sportunterricht mit blinden und sehbehinderten Schülern auf den Unterricht mit sehenden Schülern.
Schlüsselwörter
Inklusion, Sportunterricht, Blindheit, Sehbehinderung, Motorik, methodisch-didaktische Überlegungen, sinn- und erfahrungsorientierter Sportunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Können Methoden aus dem Sportunterricht für Blinde auch Sehenden helfen?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die detaillierten methodisch-didaktischen Ansätze für Sehbehinderte die Bewegungsvorstellungen und Erfahrungen sehender Schüler verbessern können.
Was sind motorische Besonderheiten blinder Schüler?
Blinde Schüler weisen oft Lücken in der Bewegungserfahrung auf, da sie visuelle Informationen nicht zur Korrektur oder zum Lernen durch Nachahmung nutzen können.
Was ist ein sinn- und erfahrungsorientierter Sportunterricht?
Dieser Ansatz stellt das eigene Erleben und die Wahrnehmung des Körpers in den Vordergrund, statt sich nur auf die visuelle Demonstration von Bewegungen zu verlassen.
Warum ist visuelle Kompensation im Sportunterricht problematisch?
Sehende Schüler kompensieren oft lückenhafte Instruktionen visuell, was zu oberflächlichen Bewegungsvorstellungen führen kann, die durch taktile oder verbale Methoden vertieft werden könnten.
Welchen Beitrag leistet die Arbeit zum Thema Inklusion?
Sie zeigt auf, wie inklusiver Unterricht nicht nur Barrieren abbaut, sondern didaktische Mehrwerte für alle Schülergruppen schafft.
- Quote paper
- Felix Oldörp (Author), 2016, Potenziale des methodisch-didaktischen Vorgehens im Sportunterricht mit blinden und sehbehinderten Schülern für Sehende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354794