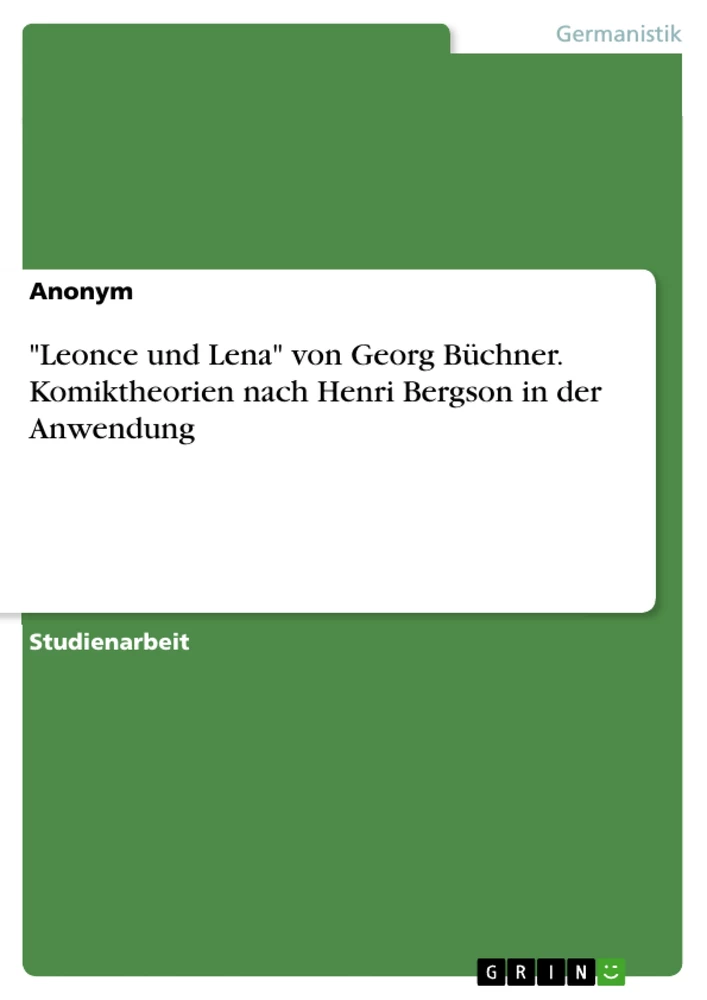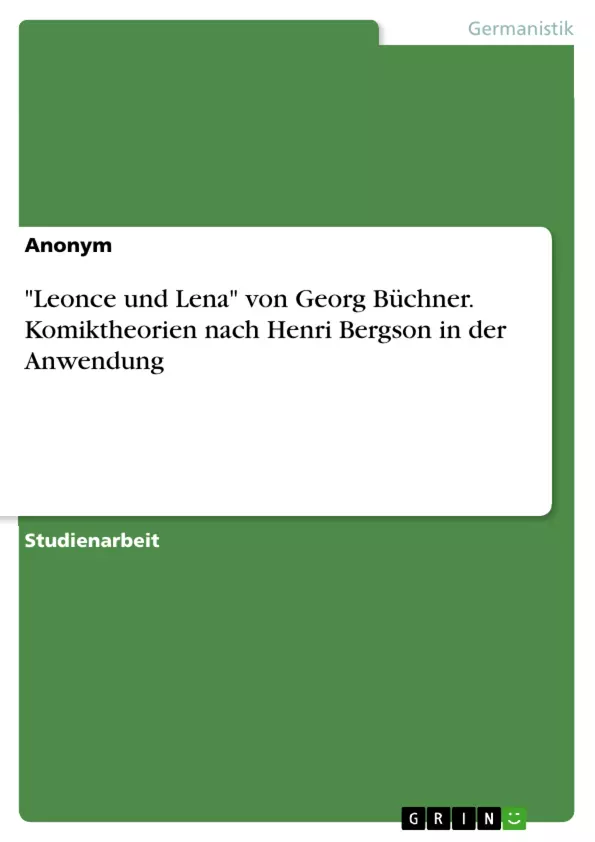In dieser Hausarbeit soll das Lustspiel „Leonce und Lena“ von Georg Büchner basierend auf Henri Bergsons komiktheoretischem Essay „Le Rire“ analysiert werden. Hierzu soll im ersten Teil der Arbeit Bergsons Komik der Mechanik erläutert werden. Im Anschluss sollen ausgewählte Figuren aus dem Lustspiel „Leonce und Lena“ nach Bergsons Theorie der Charakterkomik durchleuchtet werden. Dabei schließt die Analyse insofern auch die Komik der Formen und Bewegungen und die Situations- und Wortkomik mit ein, als das Verfahren der Komödie nur eine rein äußerliche Betrachtung seiner Charaktere zulässt und diese Komiken in ihrer Summe erst den komischen Charakter bilden. Hierbei soll jedoch keine kritische Auseinandersetzung mit Bergson stattfinden, sondern seine Lachtheorie lediglich praktisch angewendet werden.
In Leonce und Lena versucht Georg Büchner, eine Affenkomödie darzustellen. Lange polarisierte das Lustspiel die Büchner-Forschung und spaltete die Rezeption in eine idealistische (Melancholie, Langeweile) und materialistische (sozial-politische Satire) Kammer auf. Hinzu kam schließlich in jüngeren Jahren eine intensive "Intertextualitätsforschung". Eine komiktheoretische Untersuchung wurde lange nicht in Erwägung gezogen. Dabei eröffnet solch eine Betrachtung neue Perspektiven und kann zwischen den drei Richtungen vermitteln, wie es beispielsweise Matthias Morgenroth in seiner Monographie "Formen und Funktionen des Komischen in Büchners ‚Leonce und Lena‘" gelingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bergsons Komik der Mechanik
- Situations- und Wortkomik
- Charakterkomik
- Charakterkomik im Automatenstaat Popo
- König Peter, der "sieht, was nicht mehr ist, […] sagt, was nicht mehr paßt"
- Das Volk
- Die Bauern – Verwandlung in ein Ding
- Die Subalternen – Etwas Mechanisches überdeckt etwas Lebendiges
- Leonce, der Träumer
- Valerio, der Lebendige
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, das Lustspiel Leonce und Lena von Georg Büchner aus der Perspektive der Komiktheorie von Henri Bergson zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Komik der Mechanik, die Situations- und Wortkomik sowie die Charakterkomik, um die komischen Aspekte des Stücks zu beleuchten und die Charaktere anhand von Bergsons Theorien zu untersuchen.
- Bergsons Komik der Mechanik und ihre Anwendung auf Leonce und Lena
- Die Darstellung von Charakterkomik im Automatenstaat Popo
- Die Rolle von Situations- und Wortkomik in der Charakterisierung
- Die Mechanisierung von Figuren und die Darstellung des Lebendigen
- Die Funktion des Lachens in der sozialen Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Lustspiel Leonce und Lena vor und skizziert die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen es in der Büchner-Forschung betrachtet wurde. Sie führt die Komiktheorie von Henri Bergson als theoretisches Fundament der Analyse ein.
Im zweiten Kapitel wird Bergsons Komik der Mechanik erläutert. Bergson argumentiert, dass das Komische entsteht, wenn das Lebendige durch mechanisches Verhalten ersetzt wird. Die Gesellschaft verlangt nach Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit; wer diese Flexibilität verliert, erscheint mechanisch und damit komisch.
Kapitel drei beschäftigt sich mit der Charakterkomik im Automatenstaat Popo. Es werden die Figuren König Peter, das Volk (Bauern und Subalternen) sowie Leonce und Valerio anhand von Bergsons Theorie der Charakterkomik analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Komiktheorie von Henri Bergson, Georg Büchners Lustspiel Leonce und Lena, Charakterkomik, Situations- und Wortkomik, Mechanisierung, Lebendigkeit, soziale Interaktion und die Funktion des Lachens.
Häufig gestellte Fragen
Welche Komiktheorie vertritt Henri Bergson?
Bergson sieht die Ursache des Komischen in der "Mechanisierung des Lebendigen". Lachen ist eine soziale Reaktion auf Menschen, die sich starr, unaufmerksam oder wie Automaten verhalten.
Wie wird Bergsons Theorie auf "Leonce und Lena" angewendet?
Die Arbeit analysiert, wie die Figuren im "Automatenstaat Popo" (z. B. König Peter) mechanische Züge aufweisen, was sie nach Bergsons Definition komisch macht.
Was ist Charakterkomik laut Bergson?
Charakterkomik entsteht, wenn eine Person so sehr in ihren eigenen Gewohnheiten oder Fixierungen gefangen ist, dass sie die Realität um sich herum mechanisch ausblendet.
Warum wird der Staat Popo als "Automatenstaat" bezeichnet?
In Büchners Stück agieren viele Figuren, insbesondere der Hofstaat und die Untertanen, wie programmierte Puppen ohne echte Lebendigkeit, was eine politische Satire darstellt.
Welche Rolle spielt Valerio im Stück?
Im Gegensatz zu den erstarrten Figuren wird Valerio oft als "der Lebendige" interpretiert, der durch seinen Witz und seine Flexibilität einen Gegenpol zur mechanischen Welt bildet.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2013, "Leonce und Lena" von Georg Büchner. Komiktheorien nach Henri Bergson in der Anwendung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355978