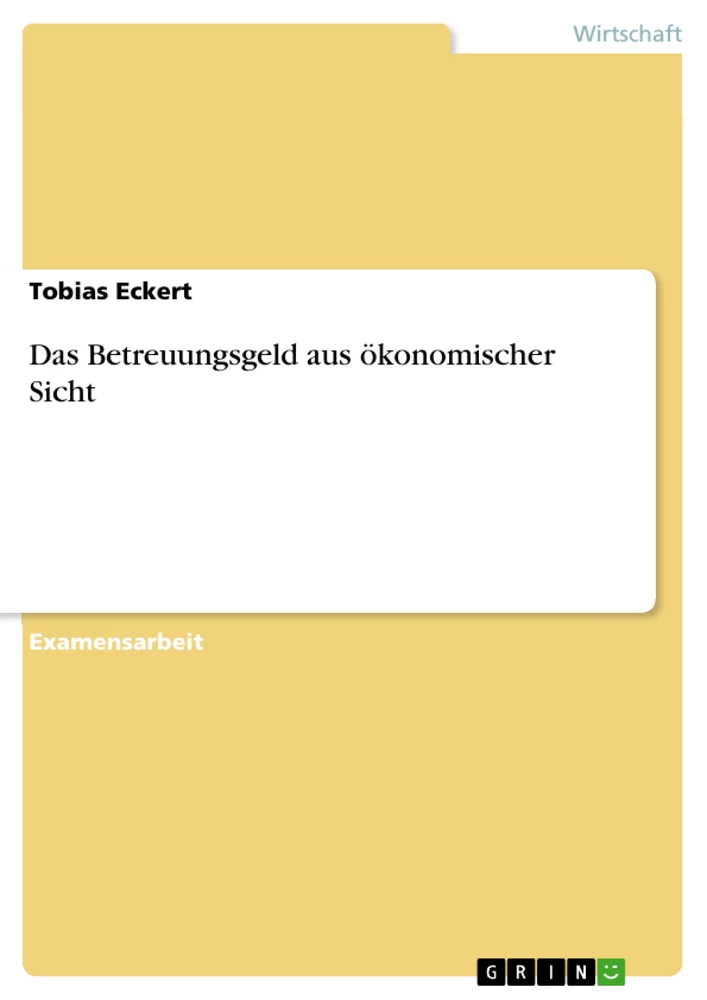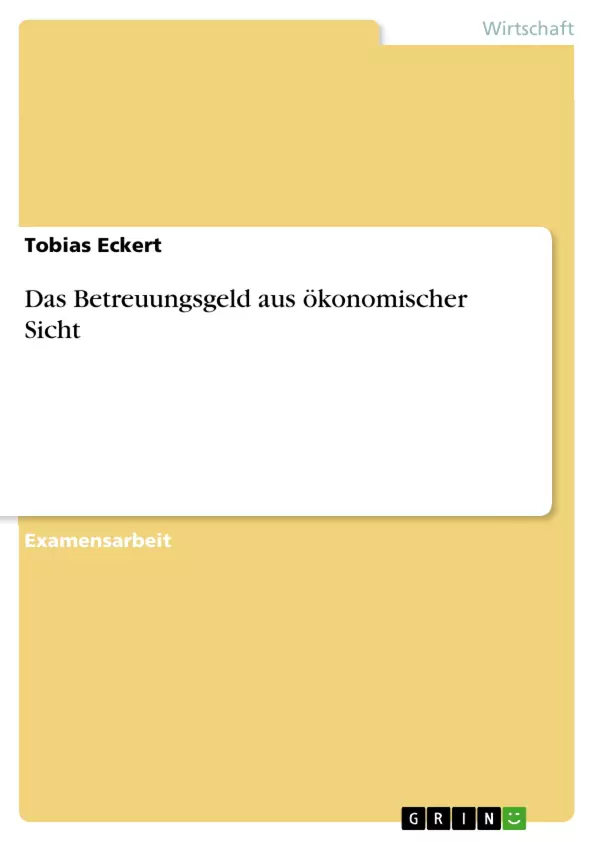Herdprämie. In 0,15 Sekunden findet www.google.de ca. 90.900 Treffer zu diesem Suchbegriff. Hinter ihm verbirgt sich, wenig schmeichelhaft für die kontrovers diskutierte familienpolitische Maßnahme, das seit August 2013 an jene Eltern gezahlte Betreuungsgeld, die ihre Kinder unter drei Jahren nicht in eine staatlich geförderte Betreuungseinrichtung schicken, sondern diese eigenverantwortlich privat betreuen.
Die vorliegende Arbeit zeichnet zunächst die politische Entstehung des Betreuungsgeldes nach und erläutert im Anschluss, was die familienpolitische Maßnahme leistet, beinhaltet und bezweckt: Wer bekommt sie? Wie hoch ist sie? Welche Ziele verfolgt die Politik damit? Im nächsten Schritt sollen einige der zahlreichen, kontroversen Debatten um das Betreuungsgeld dargelegt und erläutert werden, wobei der Schwerpunkt auf der ökonomischen Perspektive der Diskussion um die umstrittene Transferzahlung liegt. Dabei sollen Fragen wie die folgenden näher beleuchtet werden: Stellt das Betreuungsgeld einen familienpolitischen Rückschritt dar? Wie fördert man die kindliche Entwicklung effektiv? Was wünscht sich die Mehrheit der Eltern in Deutschland in Bezug auf die Betreuungssituation ihrer Kinder tatsächlich? Dazu werden diverse Meinungen erörtert, die sowohl für als auch gegen ein Betreuungsgeld sprechen. Ziel dieser Darlegung ist es, dass sich der Leser eine eigene, fundierte Meinung zum Thema Betreuungsgeld in Deutschland bilden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Betreuungsgeld als familienpolitische Maßnahme in Deutschland
- 2.1. Entstehung und Entwicklung
- 2.2. Definition, Zielgruppe und Ziele des Betreuungsgeldes
- 3. Das Betreuungsgeld im Diskurs
- 3.1. Aus familienpolitischer Sicht
- 3.2. Aus verfassungsrechtlicher Sicht
- 3.3. Aus entwicklungspsychologischer Sicht
- 3.4. Aus ökonomischer Sicht
- 3.4.1. Mikroökonomische Sicht
- 3.4.2. Makroökonomische Sicht
- 4. Die Betreuungsgelder in den skandinavischen Ländern im Vergleich mit Deutschland
- 4.1. Ausgestaltung des Betreuungsgeldes in Norwegen und Schweden
- 4.2. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Regelungen im Vergleich mit dem deutschen Betreuungsgeld
- 5. Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes in Deutschland
- 5.1. Prognose vor der Umsetzung der familienpolitischen Maßnahme
- 5.2. Entwicklungen seit der Einführung
- 6. Alternative Auszahlmöglichkeiten für ein Betreuungsgeld
- 7. Bundesverfassungsgerichts-Urteil vom 21.07.2015
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Betreuungsgeld als familienpolitische Maßnahme in Deutschland aus ökonomischer Sicht. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Betreuungsgeldes nachzuvollziehen, seine Definition, Zielgruppe und Ziele zu erläutern sowie die kontroversen Debatten um die Maßnahme zu analysieren. Dabei liegt der Fokus auf der ökonomischen Perspektive, indem Fragen nach den Auswirkungen auf die Familien, die kindliche Entwicklung und die Volkswirtschaft untersucht werden. Die Arbeit betrachtet auch die Umsetzung des Betreuungsgeldes in skandinavischen Ländern und untersucht, ob alternative Auszahlmöglichkeiten für das Betreuungsgeld denkbar sind. Schließlich wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld beleuchtet.
- Ökonomische Auswirkungen des Betreuungsgeldes auf Familien
- Einfluss des Betreuungsgeldes auf die kindliche Entwicklung
- Makroökonomische Auswirkungen des Betreuungsgeldes
- Vergleich des Betreuungsgeldes in Deutschland mit skandinavischen Ländern
- Alternative Auszahlmöglichkeiten für das Betreuungsgeld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Betreuungsgeld als familienpolitische Maßnahme vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die Entstehung und Entwicklung des Betreuungsgeldes in Deutschland sowie seine Definition, Zielgruppe und Ziele. Kapitel 3 beleuchtet die Diskussion um das Betreuungsgeld aus verschiedenen Perspektiven, darunter die familienpolitische, verfassungsrechtliche, entwicklungspsychologische und ökonomische Sicht. Kapitel 4 vergleicht die Betreuungsgelder in den skandinavischen Ländern mit dem deutschen Betreuungsgeld. Kapitel 5 untersucht die Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes in Deutschland. Kapitel 6 diskutiert alternative Auszahlmöglichkeiten für das Betreuungsgeld. Kapitel 7 fasst das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld zusammen. Die Schlussbetrachtung zieht ein Fazit aus der Untersuchung und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Betreuungsgeld, Familienpolitik, Mikroökonomie, Makroökonomie, Entwicklungspsychologie, Verfassungsrecht, Skandinavien, Deutschland, Alternative Auszahlmöglichkeiten, Bundesverfassungsgericht, Familienförderung, Kinderbetreuung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Betreuungsgeld und wer erhält es?
Das Betreuungsgeld ist eine Transferzahlung für Eltern, die ihre Kinder unter drei Jahren nicht in einer staatlich geförderten Einrichtung, sondern privat betreuen.
Warum wird das Betreuungsgeld oft kritisch als „Herdprämie“ bezeichnet?
Der Begriff wird von Kritikern verwendet, die befürchten, dass die Zahlung Eltern (insbesondere Mütter) von der Erwerbstätigkeit abhält und einen familienpolitischen Rückschritt darstellt.
Welche ökonomischen Perspektiven werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl mikroökonomische Auswirkungen auf die Familien als auch makroökonomische Folgen für die gesamte Volkswirtschaft.
Wie schneidet Deutschland im Vergleich zu skandinavischen Ländern ab?
Die Arbeit vergleicht die deutsche Regelung mit den Systemen in Norwegen und Schweden, um Unterschiede in der Ausgestaltung und Zielsetzung aufzuzeigen.
Was geschah am 21.07.2015 im Zusammenhang mit dem Betreuungsgeld?
An diesem Tag verkündete das Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil zur Verfassungsmäßigkeit des Betreuungsgeldes, das in der Arbeit thematisiert wird.
- Quote paper
- Tobias Eckert (Author), 2015, Das Betreuungsgeld aus ökonomischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356620