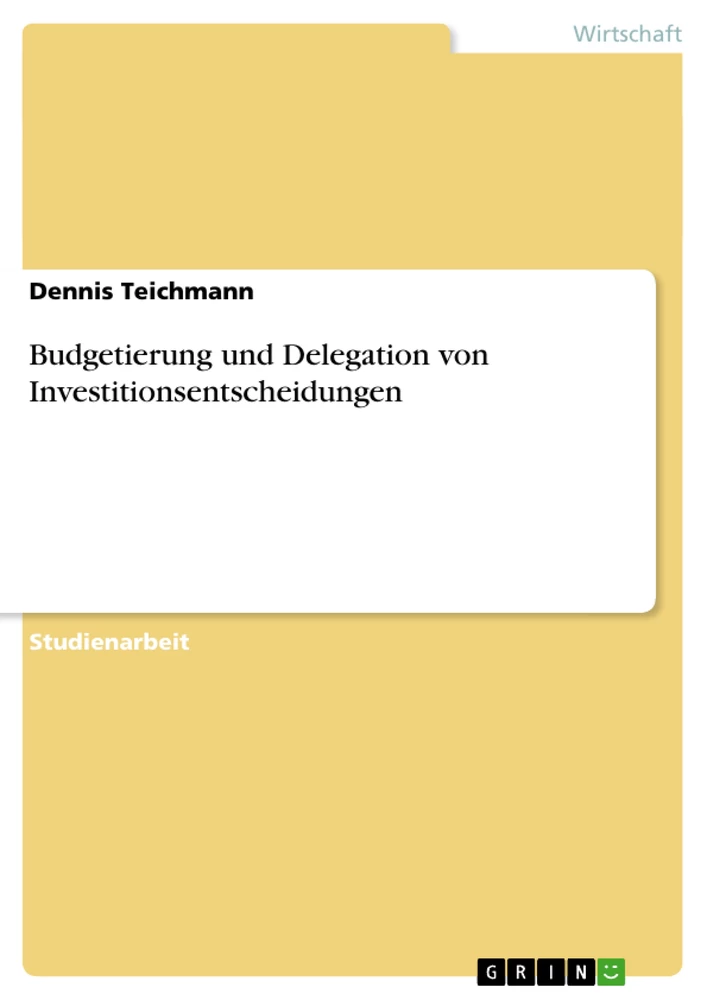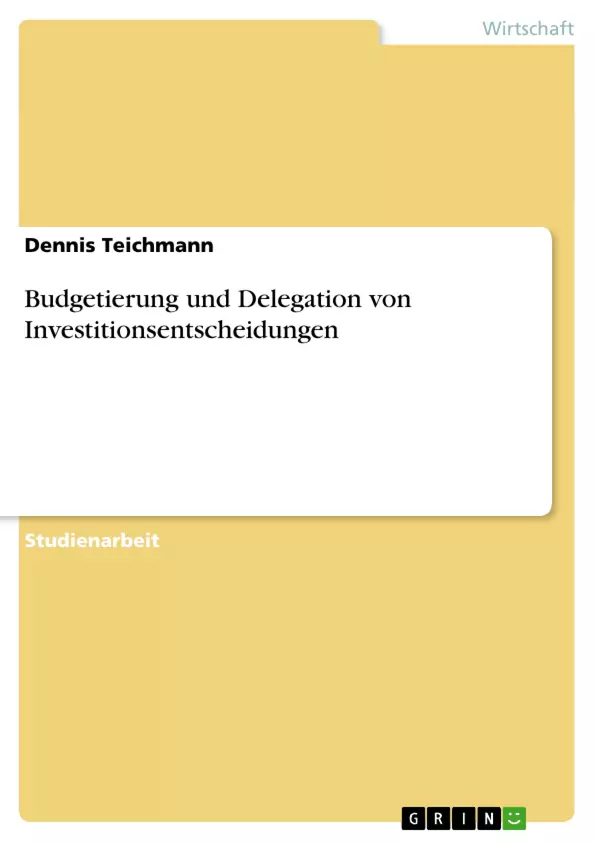Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie eine optimale Investitionspolitik zwischen der Unternehmensleitung und den jeweiligen Bereichsleitern mit Hilfe von Budgetierungsmechanismen unter Berücksichtigung von Anreizproblemen und Informationsasymmetrien gestaltet werden sollte. Als Schwerpunkt wird ein ausgewähltes wissenschaftliches Modell zu Überwachungsmechanismen in Investitionsbudgetierungssystemen vorgestellt und erläutert. In der frühen Betrachtung der Investitionsbudgetierung wurde lediglich von der Optimierung des Net Present Value (NPV), also des Barwerts der zukünftigen Zahlungsüberschüsse, mit der realitätsfernen Annahme, Informations- und Anreizprobleme nicht zu berücksichtigen, ausgegangen. 1 Mittlerweile hat es sich jedoch durchgesetzt, die Budgetierung von Investitionsentscheidungen insbesondere unter dem Aspekt von Informations- und Anreizdivergenzen zu untersuchen, um somit reale Zusammenhänge in Budgetierungsmodellen abzubilden. 2 Aufgabe des Investitionscontrollings in diesem Kontext ist es, das interne Principal-Agent-Problem zwischen Zentrale und Bereichsleiter mittels eines im Sinne der Gesamtunternehmung bestmöglichen Investitionsplans zu l ösen. 3 Dabei wird sich die Ausarbeitung im Folgenden insbesondere auf die Untersuchung der Wirkungsweise von Kontrollsystemen zur Gewährleistung einer wahrheitsgemäßen Berichterstattung des Bereichsleiters an die Zentrale konzentrieren. Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt: Abschnitt 2 betrachtet allgemein die Bedeutung und die Aufgaben des Investitionscontrolling und der Budgetierung. Kapitel 3 erläutert zunächst die optimale Kapitalallokation unter Vernachlässigung von Informationsasymmetrien und legt dann die Gründe für ein Abweichen vom bestmöglichen Investitionsplan durch das kombinierte Auftreten von Informations-und Anreizkonflikten dar. In vierten Abschnitt wird das Modell von HARRIS / RAVIV (Budgeting 1996) ausführlich vorgestellt, erläutert und empirisch untersucht. Im Rahmen dessen wird eine Beispielrechnung zur Veranschaulichung der Modellergebnisse präsentiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung in Kapitel 5. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- DIE BEDEUTUNG DES INVESTITIONSCONTROLLING UND DER BUDGETIERUNG
- INVESTITIONSCONTROLLING ALS TEILDISZIPLIN DES CONTROLLING
- BEDEUTUNG DER BUDGETIERUNG IM RAHMEN DES INVESTITIONSCONTROLLING
- DAS PROBLEM DER OPTIMALEN KAPITALALLOKATION FÜR INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN
- OPTIMALE KAPITALALLOKATION (FIRST-BEST-LÖSUNG)
- INFORMATIONS- UND ANREIZPROBLEME ZWISCHEN ZENTRALE UND BEREICHSLEITERN
- BUDGETIERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON INFORMATIONSASYMMETRIEN UND DIVERGIERENDEN PRÄFERENZEN
- ANNAHMEN DES MODELLS
- AUSWIRKUNGEN DES MODELLS AUF AUSGEWÄHLTE PARAMETER
- Ableitung der optimalen Überwachungswahrscheinlichkeit
- Entwicklung der optimalen Kapitalallokation
- Die Relevanz von Skaleneffekten und der primären Einschätzung der Zentrale über die Produktionstechnologien für die Modellstabilität
- VERANSCHAULICHUNG ANHAND EINER BEISPIELRECHNUNG
- EMPIRISCHER VERGLEICH DER MODELLAUSSAGEN MIT REALEN VERHALTENSWEISEN
- KRITISCHE BEURTEILUNG DER BUDGETIERUNGSMODELLE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Budgetgestaltung und der Delegation von Investitionsentscheidungen in Unternehmen. Sie analysiert die Bedeutung des Investitionscontrollings und der Budgetierung als Controllinginstrumente im Kontext von Informationsasymmetrien und divergierenden Präferenzen zwischen Zentrale und Bereichsleitern. Das zentrale Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das die optimale Kapitalallokation für Investitionsentscheidungen unter diesen Bedingungen beschreibt.
- Bedeutung des Investitionscontrollings und der Budgetierung
- Optimale Kapitalallokation unter Berücksichtigung von Informationsasymmetrien
- Entwicklung eines Modells zur optimalen Kapitalallokation
- Einfluss von Skaleneffekten und der primären Einschätzung der Zentrale auf die Modellstabilität
- Empirische Validierung der Modellergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Investitionscontrolling und Budgetierung. Dabei wird die Bedeutung dieser Instrumente im Rahmen des Gesamtcontrollings herausgestellt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Problem der optimalen Kapitalallokation für Investitionsentscheidungen. Es werden die Herausforderungen durch Informationsasymmetrien und divergierende Präferenzen zwischen Zentrale und Bereichsleitern beleuchtet. Im dritten Kapitel wird ein Modell zur Budgetierung unter Berücksichtigung von Informationsasymmetrien und divergierenden Präferenzen vorgestellt. Die Auswirkungen des Modells auf ausgewählte Parameter wie die Überwachungswahrscheinlichkeit und die Kapitalallokation werden untersucht. Das Kapitel schließt mit einer Beispielrechnung und einem empirischen Vergleich der Modellergebnisse mit realen Verhaltensweisen. Abschließend wird das Modell kritisch bewertet und die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Investitionscontrolling, Budgetierung, Kapitalallokation, Informationsasymmetrie, divergierende Präferenzen, Überwachungswahrscheinlichkeit, Skaleneffekte, Modellstabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptproblem bei delegierten Investitionsentscheidungen?
Das zentrale Problem ist das Principal-Agent-Verhältnis zwischen der Unternehmenszentrale und Bereichsleitern, das durch Informationsasymmetrien und divergierende Interessen geprägt ist.
Welches wissenschaftliche Modell wird in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit erläutert ausführlich das Modell von Harris und Raviv (1996) zur Investitionsbudgetierung.
Wie sichert das Management eine wahrheitsgemäße Berichterstattung?
Durch den Einsatz von Überwachungsmechanismen und Kontrollsystemen, deren optimale Wahrscheinlichkeit im Modell mathematisch abgeleitet wird.
Was versteht man unter der „First-Best-Lösung“?
Dies ist die optimale Kapitalallokation unter der (realitätsfernen) Annahme, dass keine Informations- oder Anreizprobleme existieren.
Welchen Einfluss haben Skaleneffekte auf die Budgetierung?
Die Arbeit untersucht, wie Skaleneffekte und die Einschätzung der Zentrale über Produktionstechnologien die Stabilität des Budgetierungsmodells beeinflussen.
- Citation du texte
- Dennis Teichmann (Auteur), 2002, Budgetierung und Delegation von Investitionsentscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35754