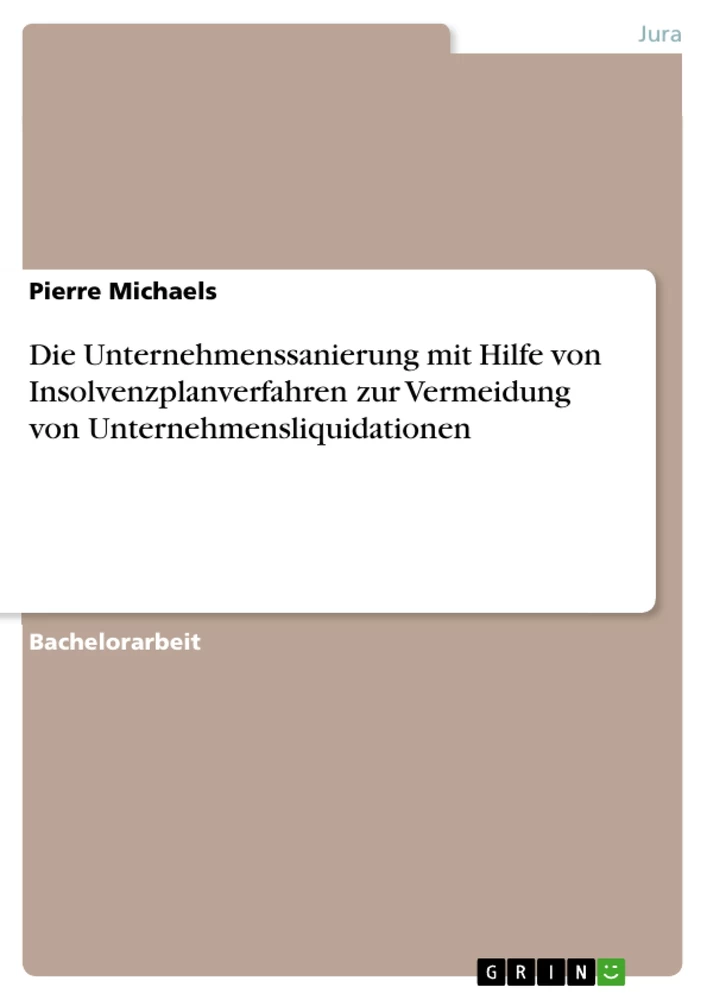Seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahre 1999 gibt es jährlich bis zu 35.000 Unternehmensinsolvenzen. Im Falle einer Unternehmenskrise, welche zu einer Anmeldung eines Insolvenzverfahrens führte, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Bewältigung des Problems. Einerseits die Durchführung einer Liquidation aller Vermögensgegenstände zur quotalen Befriedigung der Gläubigerforderungen oder andererseits eine Fortführung des Unternehmens mit gleichzeitiger Sanierung. Hierbei ist abzuwägen, ob ein Unternehmen überhaupt sanierungsfähig ist. Eine Fortführung des Unternehmens ist nur dann sinnvoller als eine Liquidation, wenn Gewinne erzielt werden können.
Eine wichtige Form der Unternehmensfortführung und somit eine Alternative zur klassischen Regelinsolvenz bildet das Insolvenzplanverfahren. Ein solches Insolvenzplanverfahren gibt den Vorlageberechtigten die Möglichkeit, Regelungen abseits der Insolvenzordnung zu treffen, um eine erfolgreiche Sanierung durchzuführen. Ziel dieser Regelung ist, die Privat- und Gläubigerautonomie zu stärken, indem eigenständig einvernehmliche Lösungen zur Insolvenzabwicklung getroffen werden können.
Oberstes Ziel des Insolvenzverfahrens ist immer die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger. Eine Unternehmenskrise kann jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. Dies kann aufgrund falscher Besetzungen von Führungspositionen, fehlerhafter Einschätzungen der Marktentwicklung oder durch Mängel bei Organisation und Planung erfolgen, um nur einige Wenige zu nennen. Aufgrund der Komplexität einer Unternehmenskrise und der zu großen Einschränkungen durch die Insolvenzordnung ist eine Abwicklung eines Insolvenzverfahrens im Rahmen der Vorschriften zur Regelinsolvenz nicht immer die optimale Möglichkeit zur bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger. Ein Insolvenzplanverfahren sorgt hingegen für die nötige Flexibilität und schafft eine gesetzliche Legitimierung für Abweichungen von den Vorgaben zur Regelinsolvenz. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Krise des Unternehmens
- 2.1 Definition und Merkmale einer Krise
- 2.2 Die vier Phasen einer Krise
- 2.3 Anzeichen einer Krise und die Möglichkeiten der Bewältigung
- 2.3.1 Sofortmaßnahmen zur Krisenbewältigung
- 2.3.2 Insolvenzverfahrensarten
- 3. Zweck des Insolvenzplanverfahrens und dessen praktische Entwicklung
- 4. Aufbau eines Insolvenzplans
- 4.1 Arten von Insolvenzplänen
- 4.2 Gesetzliche Formvorschriften
- 4.2.1 Der darstellende Teil
- 4.2.2 Der gestaltende Teil
- 4.2.2.1 Bildung von Gläubigergruppen
- 4.2.3 Der dokumentierende Teil
- 5. Ablauf des Insolvenzplanverfahrens
- 5.1 Planinitiativrecht
- 5.2 Die Bestellung des Insolvenzverwalters
- 5.3 Die Einhaltung der Frist zur Vorlage des Insolvenzplans
- 5.4 Voraussetzungen für die Annahme des Plans und Ablauf des Insolvenzplanverfahrens
- 5.4.1 Vorprüfung durch das zuständige Insolvenzgericht
- 5.4.2 Niederlegung des Insolvenzplans und Einholung von Stellungnahmen
- 5.4.3 Abstimmungs- und Erörterungstermin
- 5.4.3.1 Erörterung des Insolvenzplans und der Stimmrechte
- 5.4.3.2 Durchführung der Abstimmung
- 5.4.3.3 Zustimmung des Schuldners
- 5.5 Gerichtliche Bestätigung des Plans
- 5.6 Rechtswirkung des bestätigten Insolvenzplans
- 5.6.1 Persönlicher Geltungsbereich
- 5.6.2 Materiell-rechtliche Wirkung
- 5.6.3 Die Aufhebung des Insolvenzverfahrens
- 6. Die Sanierung mit Hilfe des Insolvenzplans
- 6.1 Definition der Sanierung
- 6.2 Analyse der Sanierungsfähigkeit
- 6.3 Maßnahmen der Sanierung
- 6.3.1 Finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen
- 6.3.1.1 Auflösen stiller Reserven
- 6.3.1.2 Gesellschafterdarlehen
- 6.3.1.3 Forderungsverzicht
- 6.3.1.4 Zuführung von Kapital
- 6.3.1.5 Factoring
- 6.3.1.6 Sale and lease back
- 6.3.2 Leistungswirtschaftliche Maßnahmen
- 6.3.2.1 Absatz
- 6.3.2.2 Beschaffung
- 6.3.2.3 Forschung und Entwicklung
- 6.3.2.4 Produktion
- 6.3.2.5 Personal
- 6.3.3 Einbeziehung der Sanierungsmaßnahmen in den Insolvenzplan
- 7. Fazit und Prognose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit der Unternehmenssanierung im Rahmen von Insolvenzplanverfahren und analysiert deren Potenzial zur Vermeidung von Unternehmensliquidationen. Ziel ist es, die Funktionsweise und die rechtlichen Grundlagen des Insolvenzplanverfahrens zu beleuchten und dessen Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis zu untersuchen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Insolvenzplanverfahrens
- Ablauf und Voraussetzungen des Insolvenzplanverfahrens
- Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Insolvenzplans
- Bewertung der Effektivität des Insolvenzplanverfahrens
- Herausforderungen und Chancen der Unternehmenssanierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über das Thema der Unternehmenssanierung und die Relevanz des Insolvenzplanverfahrens. Kapitel 2 definiert und beschreibt die Phasen einer Unternehmenskrise sowie die Anzeichen und Möglichkeiten der Bewältigung. Kapitel 3 erläutert den Zweck des Insolvenzplanverfahrens und dessen Entwicklung in der Praxis. Kapitel 4 analysiert den Aufbau eines Insolvenzplans, einschließlich der Arten von Insolvenzplänen und der gesetzlichen Formvorschriften. Kapitel 5 behandelt den Ablauf des Insolvenzplanverfahrens, von der Planinitiierung bis zur gerichtlichen Bestätigung. Kapitel 6 befasst sich mit der Sanierung mit Hilfe des Insolvenzplans, wobei verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Detail betrachtet werden. Das Fazit und die Prognose bieten abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Einschätzung der Zukunftsperspektiven des Insolvenzplanverfahrens.
Schlüsselwörter
Insolvenzplanverfahren, Unternehmenssanierung, Unternehmensliquidation, Gläubigergruppen, Sanierungsfähigkeit, Finanzwirtschaftliche Maßnahmen, Leistungswirtschaftliche Maßnahmen, Insolvenzrecht, Insolvenzordnung (InsO), Rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Vorteil eines Insolvenzplanverfahrens gegenüber der Liquidation?
Es ermöglicht die Fortführung und Sanierung des Unternehmens, was oft zu einer besseren Befriedigung der Gläubiger führt als der bloße Verkauf aller Vermögenswerte.
Wie ist ein Insolvenzplan gesetzlich aufgebaut?
Ein Plan besteht aus einem darstellenden Teil (Grundlagen), einem gestaltenden Teil (Rechtsänderungen) und einem dokumentierenden Teil.
Welche Phasen kennzeichnen eine Unternehmenskrise?
Die Arbeit beschreibt vier Phasen einer Krise, von ersten Anzeichen bis zur drohenden Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung.
Was sind leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen?
Dazu gehören Anpassungen in den Bereichen Absatz, Beschaffung, Produktion, Personal sowie Forschung und Entwicklung.
Wer darf einen Insolvenzplan initiieren?
Das Planinitiativrecht liegt beim Schuldner oder beim Insolvenzverwalter.
- Citar trabajo
- Pierre Michaels (Autor), 2016, Die Unternehmenssanierung mit Hilfe von Insolvenzplanverfahren zur Vermeidung von Unternehmensliquidationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358067