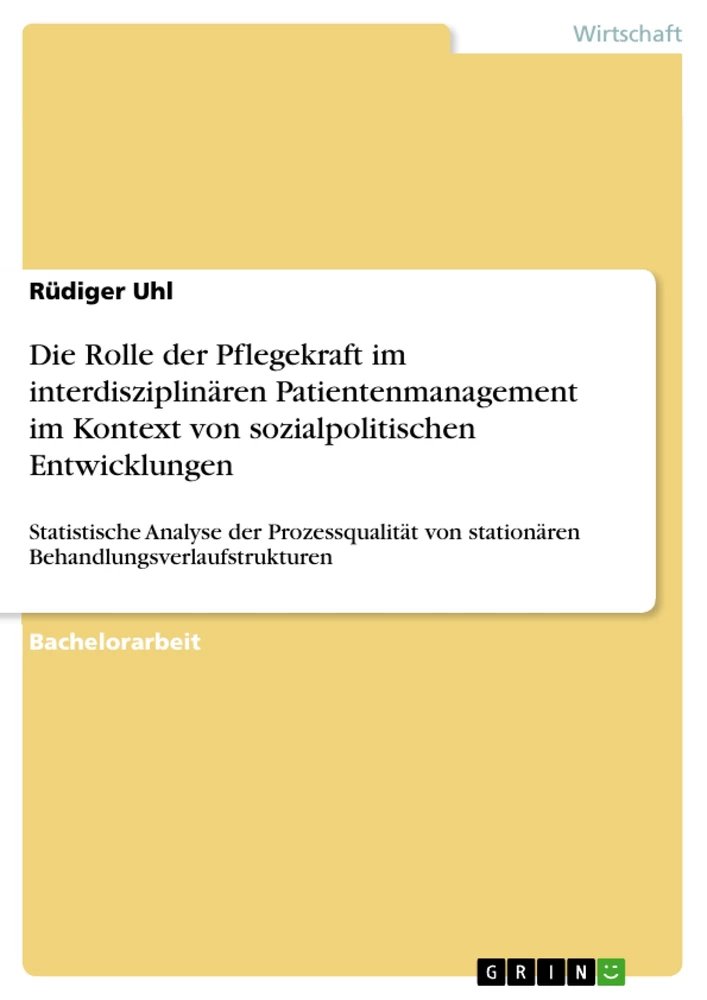Diese Bachelorarbeit analysiert anhand einer standardisierten Befragung von aktiven Pflegefachpersonen auf Normalstation erlebte und wahrgenommene Behandlungsverlauf-Strukturen unter Berücksichtigung der Bedeutung des interdisziplinären Prozessmanagements und der generellen Rolle und Bedeutung der Pflegefachperson im Behandlungsprozess.
Zunächst werden arbeitsrelevante Begriffe literaturgestützt definiert und somit voneinander abgegrenzt. Anschließend erfolgt eine Darstellung von relevanten gegenwärtigen sozialpolitischen Entwicklungen: im Gesundheitswesen ist es für das Management zu einer elementaren Aufgabe geworden, dem Patienten zusätzlich Kundeneigenschaften zuzusprechen. Daraus resultierend müssen sämtliche patientenrelevanten Arbeitsprozesse im stationären Krankenhausalltag vermehrt kundenorientiert gestaltet werden, um ein hohes Maß an Zufriedenheit im Rahmen des Krankheitsempfindens zu erzeugen. Dies geschieht unter sich fortlaufend verändernden Bedingungen für das Pflegefachpersonal wie zum Beispiel knappere Personalplanung, Einflüsse der DRG-Regelungen, vermehrte Betreuung von multimorbiden Patienten und zunehmenden Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben. Gleichzeitig strebt die Pflege eine Professionalisierung ihres Berufsbildes an und versucht, sich in den Prozessstrukturen im Krankenhausalltag klar von anderen Berufsgruppen abzugrenzen.
Die Prozessqualität der Behandlungsverlauf-Strukturen ist jedoch in jedem Fall das Ergebnis von interdisziplinärer Kooperation und Interaktion. In welchem Maße der Patient als Kunde davon profitiert ist abhängig vom Grad des erfolgreich geplanten und durchgeführten berufsgruppenübergreifenden Prozessmanagements. Alle am Behandlungsprozess beteiligten Akteure werden ebenso exemplarisch dargestellt wie auch die verschiedenen Aspekte der Verlaufsphasen.
Eine differenzierte Darstellung der erlebten und beobachteten Prozessumsetzung aus Sicht der Pflege erfolgt durch eine quantitative, deduktive Umfrage, die anonym durchgeführt wird. Sie soll Erfahrungswerte und Beobachtungen des Personals in den jeweiligen Phasen des Behandlungsverlaufs erfassen.
In der Darstellungs- und Auswertungsphase wird literaturgestützt herausgearbeitet , an welchen Stellen der Prozessgestaltung aus Sicht des Pflegefachpersonals Optimierungsbedarf besteht, welche konkrete Rolle dabei die Pflegefachperson hat und welchen Nutzen bzw. welche Auswirkung eine dargestellte Veränderung zur Folge haben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Definitionen und Grundlagen
- Prozessmanagement
- Qualitätsmanagement
- Schnittstellenmanagement
- Klinische Behandlungspfade
- Case Management
- Care Management
- Darstellung von sozialpolitischen Entwicklungen
- Wandel und Veränderungsbedarf in den Versorgungsstrukturen
- Veränderte Wahrnehmung der Patientenrolle
- Professionalisierungsbestreben der Pflege
- Stationärer Behandlungsprozess im Krankenhausalltag
- Beteiligte Berufsgruppen im Behandlungsprozess
- Aufnahmemanagement
- Behandlungsmanagement
- Entlassungs- und Überleitungsmanagement
- Evaluationsphase
- Zielsetzung der Evaluation
- Vorstellung der Mitarbeiterumfrage
- Initiierung und Durchführung der Umfrage
- Auswertung der Mitarbeiterumfrage
- Differenzierte Darstellung der allgemeinen Merkmale der erhobenen Daten und der Teilnehmer
- Darstellung der allgemeinen organisationsstrukturellen Informationen
- Darstellung der berufspolitischen Aspekte
- Darstellung der Prozessphase „Geplante Aufnahmesituation“
- Darstellung der Prozessphase „Stationäre Versorgung“
- Darstellung der Prozessphase „Entlassungssituation“
- Bewertung der Mitarbeiterumfrage
- Potentielle Einflussnahme der Pflegefachperson auf die Prozessqualität
- Die Rolle der Pflegefachperson im interdisziplinärem Kontext
- Zusammenfassung
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Prozesse im stationären Krankenhausalltag aus der Perspektive der Pflegefachperson. Ziel ist es, die Prozessqualität im Behandlungsverlauf unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren aus der Sicht der Pflegefachperson zu analysieren und zu evaluieren.
- Prozessoptimierung im Krankenhausalltag
- Rolle der Pflegefachperson im Behandlungsprozess
- Einflussfaktoren auf die Prozessqualität
- Evaluation und Analyse der Mitarbeiterumfrage
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Krankenhaus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit legt die grundlegenden Definitionen und Konzepte des Prozessmanagements, Qualitätsmanagements, Schnittstellenmanagements, klinischer Behandlungspfade, Case Managements und Care Managements dar. Im zweiten Kapitel werden die relevanten sozialpolitischen Entwicklungen im Gesundheitswesen beleuchtet, wie der Wandel in den Versorgungsstrukturen, die veränderte Patientenrolle und die Professionalisierung der Pflege.
Im dritten Kapitel wird der stationäre Behandlungsprozess im Krankenhausalltag beschrieben, wobei die beteiligten Berufsgruppen, das Aufnahmemanagement, das Behandlungsmanagement und das Entlassungs- und Überleitungsmanagement im Fokus stehen. Das vierte Kapitel widmet sich der Evaluationsphase, insbesondere der Zielsetzung der Evaluation und der Vorstellung der Mitarbeiterumfrage, die zur Datenerhebung eingesetzt wurde.
Das fünfte Kapitel analysiert die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage, wobei verschiedene Aspekte, wie die allgemeinen Merkmale der Daten und der Teilnehmer, organisationsstrukturelle Informationen, berufspolitische Aspekte und die Darstellung der einzelnen Prozessphasen, betrachtet werden. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage bewertet, wobei die potentielle Einflussnahme der Pflegefachperson auf die Prozessqualität und ihre Rolle im interdisziplinären Kontext im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Prozessmanagement, Qualitätsmanagement, stationärer Behandlungsprozess, Pflegefachperson, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Mitarbeiterumfrage, Evaluation, Einflussfaktoren auf die Prozessqualität und sozialpolitische Entwicklungen im Gesundheitswesen. Es werden Konzepte wie Case Management, Care Management und klinische Behandlungspfade behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Pflegekraft im interdisziplinären Management?
Pflegefachkräfte fungieren als zentrale Schnittstelle im Behandlungsverlauf. Die Arbeit untersucht ihre Bedeutung für die Prozessqualität und die Kooperation mit anderen Berufsgruppen im Krankenhaus.
Was versteht man unter der „Patientenrolle als Kunde“?
Durch sozialpolitische Entwicklungen werden Patienten zunehmend als Kunden wahrgenommen. Arbeitsprozesse müssen daher kundenorientierter gestaltet werden, um eine hohe Zufriedenheit zu gewährleisten.
Welchen Belastungen ist das Pflegepersonal aktuell ausgesetzt?
Zu den Belastungsfaktoren gehören knappe Personalplanung, DRG-Regelungen, die Zunahme multimorbider Patienten sowie wachsende Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben.
Was sind klinische Behandlungspfade?
Klinische Behandlungspfade sind standardisierte Prozessabläufe im Krankenhaus, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten über verschiedene Abteilungen hinweg sicherstellen sollen.
Wie wurde die Prozessqualität in dieser Arbeit evaluiert?
Es wurde eine quantitative, anonyme Befragung von aktiven Pflegefachpersonen auf Normalstationen durchgeführt, um deren Wahrnehmung der Behandlungsabläufe zu erfassen.
- Citar trabajo
- Rüdiger Uhl (Autor), 2016, Die Rolle der Pflegekraft im interdisziplinären Patientenmanagement im Kontext von sozialpolitischen Entwicklungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358935