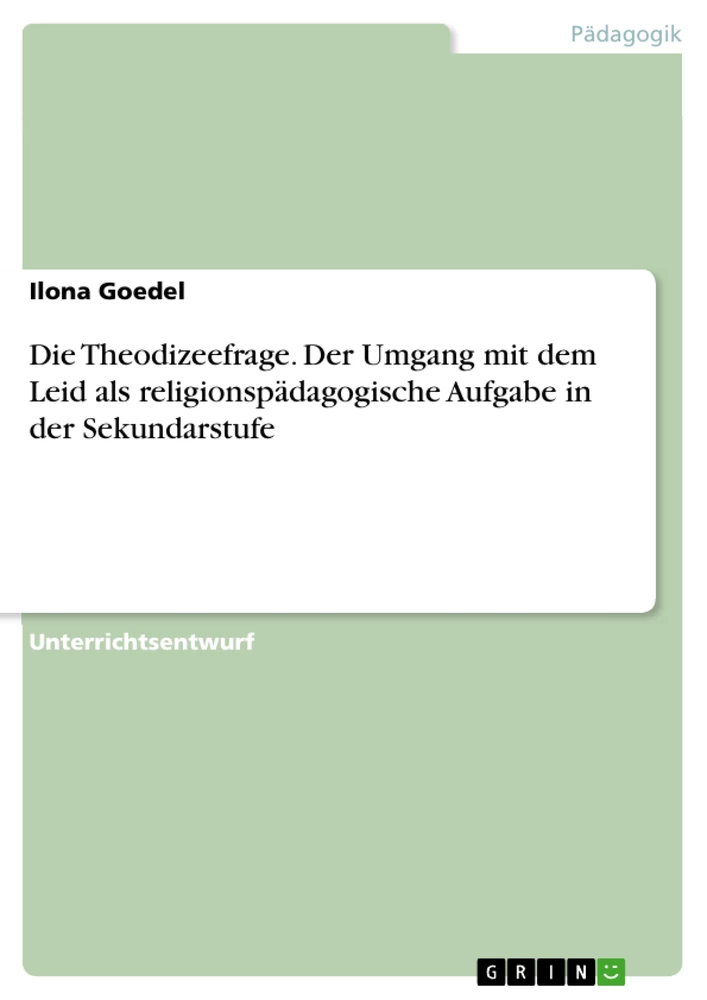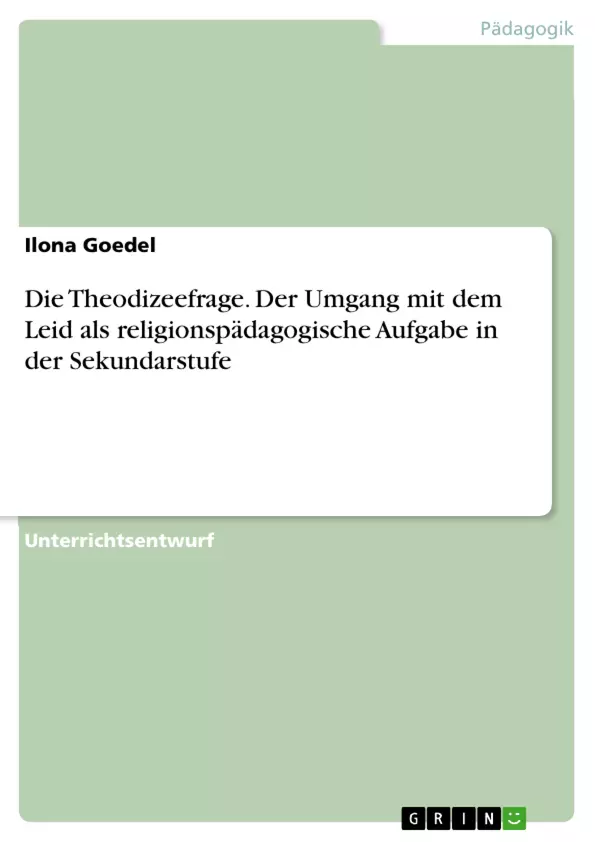In der vorliegenden Arbeit, als auch in der dazu konzipierten Unterrichtstunde soll das Gottesbild der Jugendlichen, am Beispiel der Frage nach dem Leid in der Welt, thematisiert und möglichst kompetenzorientiert behandelt werden. Da es eine Vielzahl von Leiderfahrungen gibt, beschränkt sich diese Arbeit ausschließlich auf das nicht (direkt) selbstverschuldete Leid, am Beispiel von
Naturkatastrophen.
Das selbstverschuldete und durch Menschen verursachte Leid, könnte in einem weiteren Schritt behandelt und thematisiert werden, wird im Weiteren jedoch außen vor gelassen. Anhand der Theodizee-Frage, welche im Mittelpunkt des Unterrichts steht, sollen Kompetenzen aufgebaut werden. Dieser Kompetenzerwerb konzentriert sich hierbei auf die aus dem Bildungsplan entnommenen personalen und sozialen, kommunikativen und reflexiven Kompetenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Schulsituation
- Lehrplanbezug
- Problemstellung
- Sachanalyse
- Die Theodizee
- Forschungen zum Gottesbild Jugendlicher
- Oser/ Gmünder
- Ziebertz/ Riegel
- Kompetenzen
- Definition
- Methoden
- Theologisch-religionspädagogischer Hauptteil
- Didaktische Erörterung
- Muss man alles wissen? (elementare Zugänge)
- Leiderfahrung bei Kindern und Jugendlichen (elementare Erfahrungen)
- Ein endloses Thema (elementare Strukturen)
- Gott erkennen (elementare Wahrheiten)
- Gott erklären (elementare Methoden)
- Reflexion des gehaltenen Unterrichts
- Anhang
- Kommentierter Unterrichtsverlauf
- Arbeitsblatt (Placement)
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Bildquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem Leid in der Welt und dem Umgang damit im Religionsunterricht. Im Fokus steht der Kompetenzerwerb der Schüler, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich mit der Theodizeefrage auseinanderzusetzen und ihre eigenen Ansichten zum Gottesbild zu reflektieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der christlichen Glaubenserziehung.
- Das Gottesbild Jugendlicher und die Theodizeefrage
- Die Bedeutung von Kompetenzerwerb im Religionsunterricht
- Didaktische Ansätze für den Umgang mit dem Leid im Unterricht
- Die Rolle des Leids in der christlichen Glaubenslehre
- Die Anwendung des Marchtaler Plans im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in die Thematik des Kompetenzerwerbs im Religionsunterricht anhand der Theodizeefrage ein. Es beschreibt die Schulsituation und den Lehrplanbezug sowie die Problemstellung. Die Sachanalyse beleuchtet den Begriff der Theodizee, erforscht die Gottesbilder Jugendlicher und definiert Kompetenzen. Der theologisch-religionspädagogische Hauptteil behandelt die didaktische Erörterung und analysiert verschiedene elementare Zugänge zum Thema. Die Reflexion des gehaltenen Unterrichts bietet einen Überblick über die Umsetzung der Unterrichtseinheit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind Theodizeefrage, Gottesbild, Leid, Kompetenzerwerb, Religionsunterricht, christliche Glaubenslehre, Marchtaler Plan, didaktische Ansätze, und elementare Zugänge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Theodizeefrage"?
Die Frage, wie ein gütiger und allmächtiger Gott das Leid in der Welt zulassen kann.
Welches Beispiel für Leid wird in der Arbeit genutzt?
Die Arbeit konzentriert sich auf nicht selbstverschuldetes Leid, konkret am Beispiel von Naturkatastrophen.
Was ist das Ziel des Religionsunterrichts in dieser Einheit?
Der Aufbau von personalen, sozialen und reflexiven Kompetenzen im Umgang mit existenziellen Fragen.
Wie sehen Jugendliche Gott im Angesicht von Leid?
Die Arbeit referiert Forschungen von Oser/Gmünder und Ziebertz über die Entwicklung des Gottesbildes bei jungen Menschen.
Was ist der "Marchtaler Plan"?
Ein reformpädagogisches Konzept für katholische Schulen, das in der Arbeit als didaktische Grundlage dient.
- Arbeit zitieren
- Ilona Goedel (Autor:in), 2016, Die Theodizeefrage. Der Umgang mit dem Leid als religionspädagogische Aufgabe in der Sekundarstufe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358964