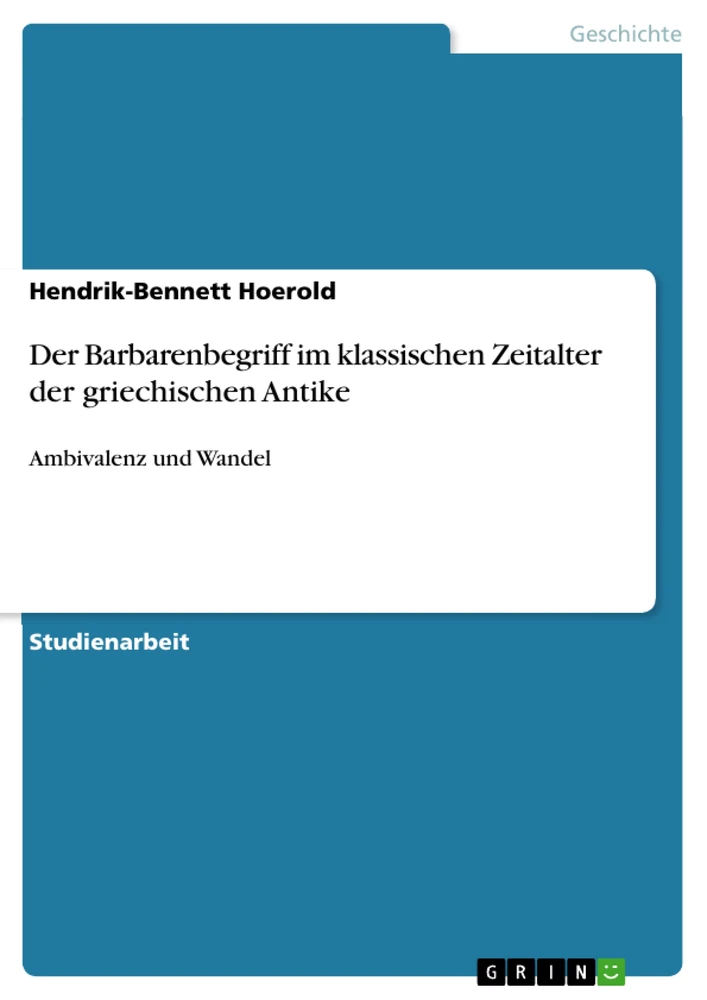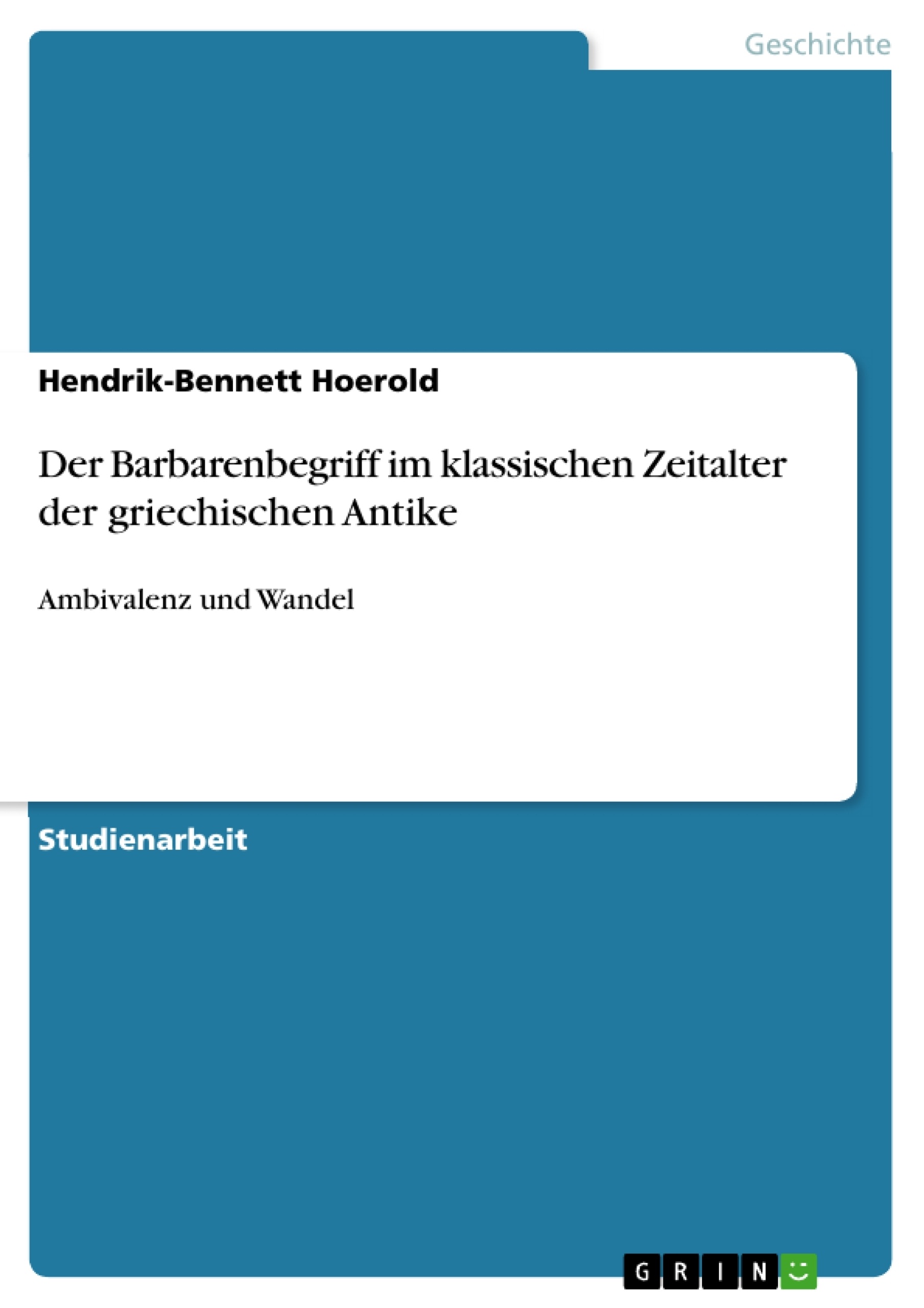Der Begriff des Barbaren ist im 21. Jahrhundert längst antiquiert und findet weder in seriöser Politik noch Wissenschaft eine ernstzunehmende Verwendung, um Menschen und Menschengruppen zu bezeichnen. Existent ist der Begriff dennoch in einer Assoziation, die das Wort "Barbar" als Sammelbegriff für Primitivität, Unmenschlichkeit und Kulturlosigkeit definiert.
Bereits um die Zeitenwende bezeichneten die Römer des frühen Kaiserreichs die Völker und Stämme westlich des Rheins, zusammengefasst in "Germanen", als barbarisch und wild. Stigmatisierungen anhand von Zugehörigkeitsmerkmalen waren demnach nicht ungewöhnlich. Sichtet man aber die Literatur über das Bild der "Fremden" in der Antike, so trifft man immer wieder auf die wichtige Bemerkung, es habe kein Rassismus existiert, so wie der Mensch nach neuzeitlichem Rassismusverständnis nach biologischen Merkmalen in "Rassen" eingeteilt wird. Das lässt vermuten, in der klassischen Zeit Athens eine aufgeklärte Gesellschaft zu sehen, frei von Rassismus.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Barbarenbegriff
- II.1. Der Barbarenbegriff vor Herodot
- II.2. Der Barbarenbegriff bei Herodot
- II.3. Die Darstellung des Fremden bei Herodot
- III. Das Selbstbild der Griechen
- IV. Die Kultur der Athener
- V. Der negative Barbarenbegriff
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Barbarenbegriffs im klassischen Zeitalter der griechischen Antike, wobei der Fokus auf der Ambivalenz und dem Wandel dieses Begriffs liegt. Es wird analysiert, wie das Bild des "Fremden" im Laufe der Zeit von einer anfänglich positiven bis neutralen Wahrnehmung hin zu einer negativen Besetzung des Barbarenbegriffs verschoben wurde.
- Die Bedeutung des Barbarenbegriffs in der frühen griechischen Literatur, insbesondere bei Homer.
- Herodots Darstellung der Barbaren in seinen "Historien" und die Frage nach seiner Haltung gegenüber "Fremden".
- Der Einfluss des athenischen Selbstbildes auf die Wahrnehmung des Barbarenbegriffs.
- Die Rolle politischer Zwänge und Lagen in der Entwicklung des Barbarenbegriffs.
- Die Entstehung der Antithetik von Hellenen und Barbaren im 5. Jahrhundert v. Chr.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Barbarenbegriffs ein und zeigt die zeitgenössische und antike Sichtweise auf den Begriff. Es wird die These aufgestellt, dass der Barbarenbegriff im Laufe des klassischen Zeitalters seine Negativierung erfuhr, und es wird der Fokus auf Herodot als zentralen Autor gelegt.
Kapitel II untersucht die Entwicklung des Barbarenbegriffs vor Herodot, beleuchtet die Verwendung des Begriffs in der Ilias und analysiert die frühgriechische Wahrnehmung von "Fremden" in der Ilias und der Odysee.
Kapitel II.2 beleuchtet Herodots "Historien" und stellt seine Darstellung der Barbaren in den ethnographischen Exkursen des Werkes dar.
Kapitel II.3 befasst sich mit der Darstellung des Fremden bei Herodot, analysiert seine ethnographischen Exkurse und untersucht die Frage nach der Ambivalenz in seiner Darstellung der Barbaren.
Kapitel III beleuchtet das Selbstbild der Griechen und untersucht die Frage, wie dieses Selbstbild die Wahrnehmung des Barbarenbegriffs beeinflusst hat.
Kapitel IV untersucht die Kultur der Athener und ihre Beziehung zu anderen Kulturen.
Schlüsselwörter
Der Barbarenbegriff, Herodot, Antike, "Historien", Ethnographie, Selbstbild, Hellenen, Ambivalenz, Fremdenfeindlichkeit, Kultur, Politische Zwänge, Zeitgenössische und antike Sichtweisen.
- Citar trabajo
- Hendrik-Bennett Hoerold (Autor), 2016, Der Barbarenbegriff im klassischen Zeitalter der griechischen Antike, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359297