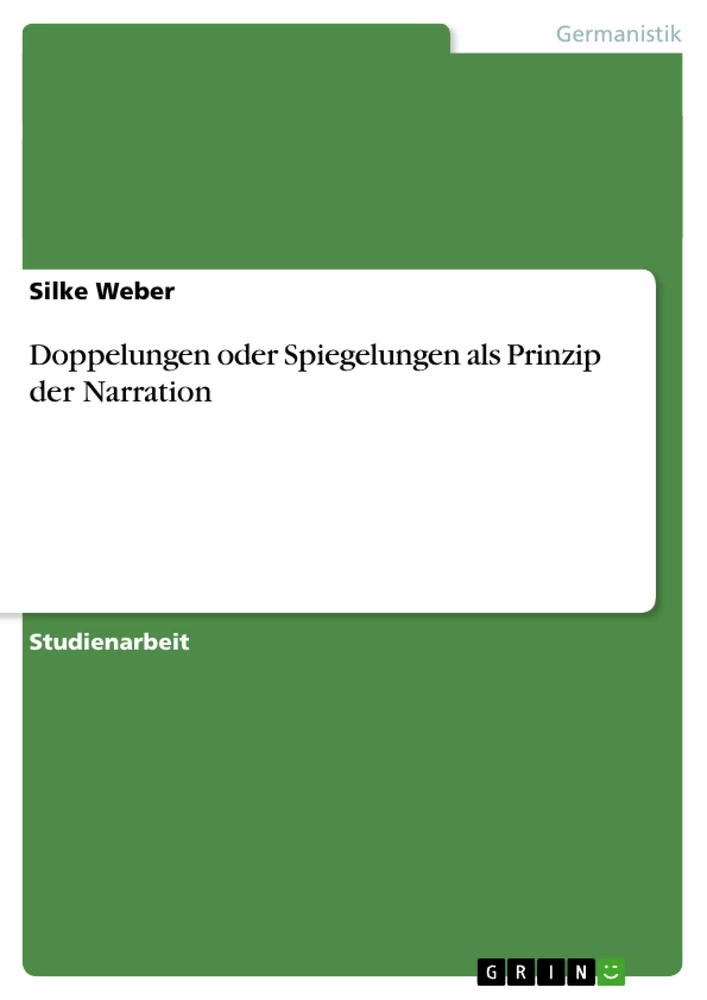In der vorliegenden Arbeit soll, entgegen dem Vorwurf, Konrads dichterischem Verfahren liege keine kompositorische Einheit zugrunde, dargestellt werden, dass sich durch eine konsequente Kette von Spiegelungen oder Doppelungen Zusammenhänge ergeben, die das Werk als Ganzes erscheinen lassen. Dabei soll in Konrads maere von hôhen triuwen neben verschiedenen Motiven vor allem der triuwe-Begriff exponiert werden. Weiterhin soll die Herausarbeitung der Kompositionskunst einen Hinweis auf das hohe Maß an intendierter Gestaltung geben. Während der erste Teil meiner Arbeit auf den stilistischen und strukturell-formalen Charakter des Engelhard eingeht, werden im zweiten Teil inhaltlich-formale Untersuchungen bestimmend sein. Konrad setzt in seinem Werk stilistisch bewusst Motivketten ein und arbeitet mit verschiedenen Bedeutungsebenen, um bestimmte Kausalzusammenhänge (die dem mittelalterlichen Gesellschaftsverständnis entsprächen) zu verschleiern. Somit kann er - seiner eigentlichen Intention getreu, nämlich der Hochhaltung der triuwe – sein Werk folgerichtig gestalten. Im inhaltlichen Teil sollen die verschiedenen Probehandlungen genauer beleuchtet werden, indem ich Motivverkettungen dieser beiden Handlungen aufzeige. Weiterhin werde ich die Themen Gleichheit und Differenz einbeziehen, indem ich auf bestimmte Differenzierungsstrategien eingehe und Motive der Gleichheit aufzeige. Dabei wird veranschaulicht, wie die triuwe, als Generalthema, in einem Wechselspiel von Gleichheit und Differenz wiederholt unter Beweis gestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale und inhaltliche Komposition des Engelhard
- Spiegelungen als narratives Prinzip
- Verschränkung und Steigerung als narratives Prinzip
- Die zwei Bedeutungsebenen
- Gleichheit und Differenz
- Das Gleichheitsparadigma
- Die Differenzkriterien
- Minnehandlung und Aussatzerkrankung
- 1. und 2. Freundschaftsprobe
- Isolation und Integration
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kompositorische Einheit des Engelhard von Konrad von Würzburg. Sie widerlegt den Vorwurf, dass dem Werk keine Einheitlichkeit zugrunde liegt, indem sie die durchgängige Verwendung von Spiegelungen und Doppelungen als narrative Prinzipien aufzeigt. Darüber hinaus wird der Begriff der triuwe im Kontext verschiedener Motive beleuchtet, um die kompositorische Kunst Konrads zu verdeutlichen.
- Das Prinzip der Spiegelung als organisierendes Element im Engelhard
- Die Rolle des Motivreims und der Verschränkung von Motiven
- Die Bedeutung der triuwe als zentrales Thema
- Die Analyse der Gleichheit und Differenz in den Probehandlungen
- Die Verbindung von Minne und triuwe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und widerlegt den Vorwurf der fehlenden Einheitlichkeit im Engelhard. Sie führt den Begriff der triuwe als zentrales Motiv ein und kündigt den Fokus auf formale und inhaltliche Analysen an.
Formale und inhaltliche Komposition des Engelhard
Dieser Abschnitt untersucht die formalen Strukturen des Engelhard, insbesondere die Verwendung von Spiegelungen und Doppelungen als narratives Prinzip. Er analysiert die vier Sequenzen des Werks und die Bedeutung von Kontrasten und Motivverknüpfungen.
Gleichheit und Differenz
Dieser Abschnitt betrachtet die Themen Gleichheit und Differenz in den Probehandlungen des Engelhard. Er analysiert das Gleichheitsparadigma, die Differenzierungsstrategien und die Bedeutung von Isolation und Integration.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Konrad von Würzburg, Engelhard, triuwe, Spiegelungen, Doppelungen, Motivverknüpfung, Gleichheit, Differenz, Probehandlung, Minnehandlung, Aussatzerkrankung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Konrad von Würzburgs „Engelhard“?
Das zentrale Thema ist der Begriff der „triuwe“ (Treue), die als moralischer Grundwert in verschiedenen Proben und Handlungssträngen unter Beweis gestellt wird.
Wie nutzt der Autor Spiegelungen als narratives Prinzip?
Durch eine Kette von Doppelungen und Spiegelungen verknüpft Konrad verschiedene Motive und Szenen, um dem Werk trotz epischer Breite eine kompositorische Einheit zu verleihen.
Welche Bedeutung haben Gleichheit und Differenz in der Erzählung?
Gleichheit wird oft durch das Äußere oder soziale Statusmotive thematisiert, während Differenzkriterien in den individuellen Freundschaftsproben die Tiefe der „triuwe“ offenbaren.
Wie hängen Minnehandlung und Aussatzerkrankung zusammen?
Diese Motive dienen als Katalysatoren für die Handlung, in denen die Treue der Protagonisten durch Isolation und Krankheit auf eine harte Probe gestellt wird.
Warum wird Konrad von Würzburgs Kompositionskunst hervorgehoben?
Entgegen älteren Vorwürfen der Strukturlosigkeit zeigt die Analyse, dass Konrad bewusst Motivketten und Bedeutungsebenen einsetzt, um kausale Zusammenhänge zu gestalten.
- Citation du texte
- Silke Weber (Auteur), 2004, Doppelungen oder Spiegelungen als Prinzip der Narration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36089