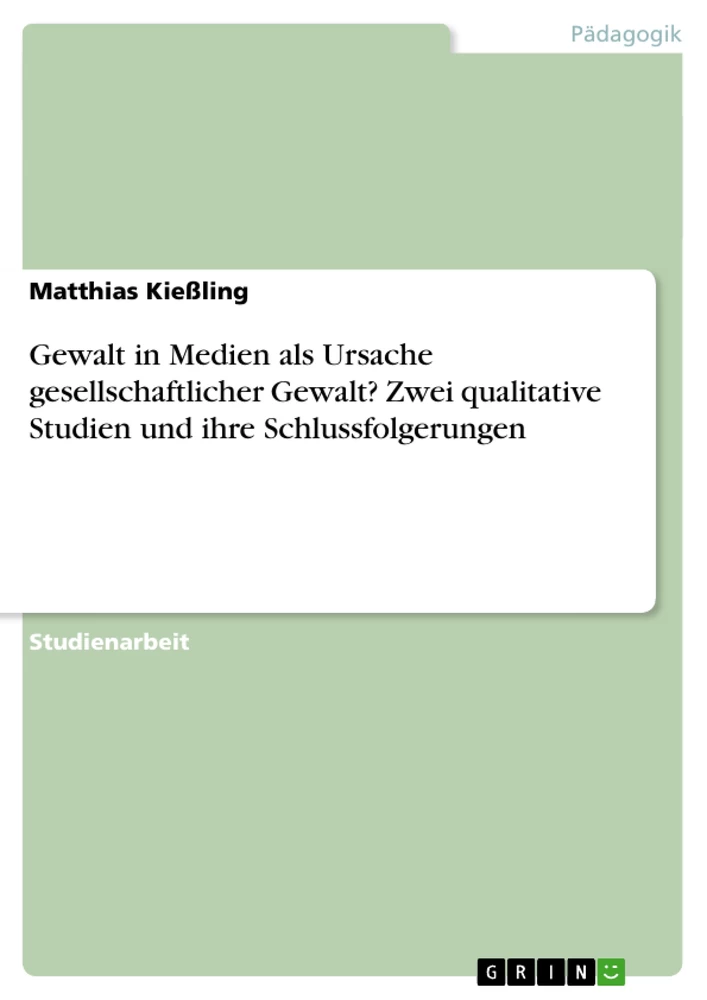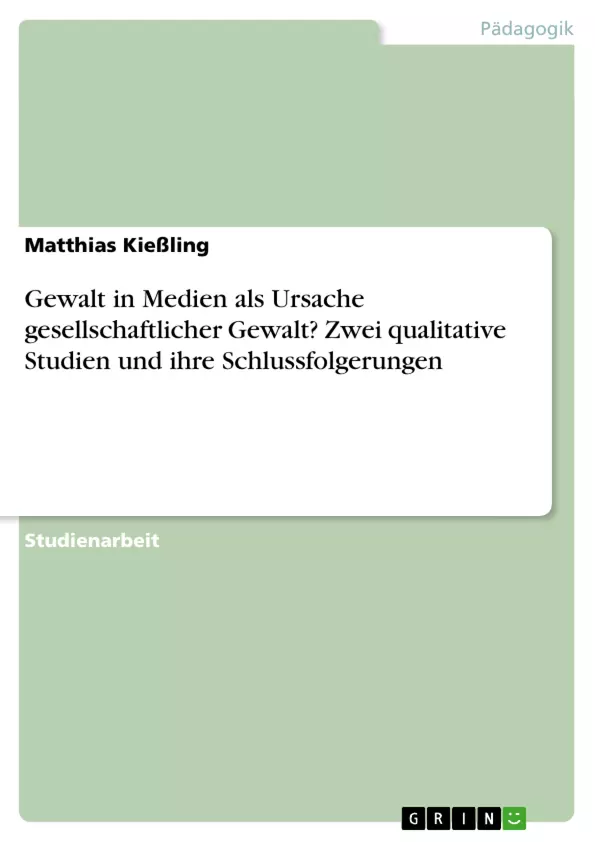Gewalt in den Medien ist ein Thema, welches immer dann breit diskutiert wird, wenn es zu besonders grausamen Akten physischer Gewaltanwendung gekommen ist. Dies war insbesondere nach dem Amoklauf von Erfurt zu beobachten, als der vielfache Mord eines Schülers an LehrerInnen, MitschülerInnen, einer Sekretärin und einem Polizisten überwiegend als Reaktion auf den übermäßigen Konsum gewaltverherrlichender Computerspiele beschrieben wurde. Doch auch weniger intensiv diskutierte Gewalttaten zeigen ähnliche Rezeptionsmuster:
Nach dem Mord an einem 17-jährigen Schüler im uckermärkischen Potzlow kam die Berliner Morgenpost vom 26.05.03 (Mielke, 2003) zu der Erkenntnis, dass sich das Leben und Handeln der rechtsradikalen Täter mit dem Film "American History X" vergleichen lässt. Denn genau wie im Film wurde das Opfer gezwungen, "in die Kante eines Bürgersteigs zu beißen", um "ihm einen tödlichen Tritt in den Nacken" (Mielke, 2003) zu versetzen. Diese Analyse, die gesellschaftliche Prozesse nicht beleuchten will, sondern Gewalt in der Realität immer mit Gewalt in den Medien in Verbindung bringt, indem sie diese aus jener ableitet, führt dazu, dass das Individuum von der Verantwortung für das eigene Handeln entlastet wird und endet konsequenterweise in Forderungen, bestimmte Ausformungen medialer Gewalt (zumin-dest für Jugendliche) zu verbieten, sprich den Jugendschutz zu stärken. Welche Ausformungen medialer Gewalt betroffen sein sollen, hängt dabei stark vom politischen oder gesellschaftlichen Standpunkt ab und kann von der Fernsehserie "die Simpsons" bis hin zum Computerspiel "Counterstrike" alles treffen, was als nicht akzeptabel für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen betrachtet wird.
Diese Arbeit wird sich der Frage widmen, wie Kinder und Jugendliche sowohl fiktionale, als auch nichtfiktionale Gewalt im Fernsehen rezipieren und ob sich vor dem Hintergrund der Ergebnisse moralisierende Verbotsdebatten als sinnvoll erweisen.
Kapitel 2 wird versuchen den Gewaltbegriff einzugrenzen, Kapitel 3 wird sich mit der Auswertung zweier qualitativer Studien beschäftigen und Kapitel 4 wird Raum für Schlussfolgerungen bieten. Auf eine Beschäftigung mit kommunikationswissenschaftlichen Medienwirkungstheorien werde ich in diesem Rahmen aus Platzgründen verzichten. Ich verweise an dieser Stelle auf G. Maletzkes (1988) kompakte Darstellung zur Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Gewaltbegriff
- 2.1 Personale Gewalt
- 2.2 Strukturelle Gewalt
- 2.3 Gewalt in den Medien
- 3. Gewalt und Medien aus der Sicht zweier Studien
- 3.1 Die qualitative Sozialforschung
- 3.2 Die Rezeption fiktionaler Gewalt
- 3.3 Die Rezeption nichtfiktionaler Gewalt
- 3.3 Vergleich der vorgestellten Studien
- 3.3.1 Gemeinsamkeiten
- 3.3.2 Unterschiede
- 4. Gewalt in Medien als Ursache gesellschaftlicher Gewalt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption von Gewalt in Medien, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht, wie fiktionale und nichtfiktionale Gewalt im Fernsehen wahrgenommen werden und ob sich vor dem Hintergrund der Ergebnisse moralische Verbotsdebatten rechtfertigen lassen. Die Arbeit analysiert zwei qualitative Studien und ihre Schlussfolgerungen.
- Der Gewaltbegriff und seine unterschiedlichen Ausprägungen, insbesondere Personale und Strukturelle Gewalt.
- Die Rezeption von fiktionaler und nichtfiktionaler Gewalt in Medien.
- Die Auswirkungen von medialer Gewalt auf gesellschaftliche Gewalt.
- Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von moralischen Verbotsdebatten.
- Die Rolle von kommunikationswissenschaftlichen Medienwirkungstheorien.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung thematisiert die gesellschaftliche Debatte um Gewalt in Medien und führt das Beispiel des Amoklaufs von Erfurt an. Sie beleuchtet die Tendenz, Gewalt in der Realität mit Gewalt in den Medien zu verknüpfen, was zu einer Entlastung des Individuums von der Verantwortung für das eigene Handeln führt und zu Forderungen nach einem stärkeren Jugendschutz führt.
Kapitel 2: Der Gewaltbegriff
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Gewalt und unterscheidet zwischen Personaler und Struktureller Gewalt. Personale Gewalt beschreibt die beabsichtigte Schädigung von Menschen oder Sachgegenständen durch eine andere Person. Strukturelle Gewalt hingegen ist in die gesellschaftlichen Strukturen eingebettet und führt zu Ungleichverteilung von Lebens- und Verwirklichungschancen.
Kapitel 3: Gewalt und Medien aus der Sicht zweier Studien
Kapitel 3 analysiert zwei qualitative Studien, die sich mit der Rezeption von fiktionaler und nichtfiktionaler Gewalt im Fernsehen befassen. Es werden die Forschungsmethoden, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen der Studien dargestellt. Es wird auch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Studien eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Gewaltbegriff, medialer Gewalt, Rezeption von Gewalt, qualitativer Sozialforschung, Jugendschutz und moralischen Verbotsdebatten. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse von zwei qualitativen Studien und setzt sich mit der Frage auseinander, ob Gewalt in Medien eine Ursache für gesellschaftliche Gewalt sein kann.
Häufig gestellte Fragen
Ist Gewalt in Medien eine Ursache für reale Gewalt?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und analysiert, ob die Verknüpfung von medialer und realer Gewalt zu kurz greift und das Individuum lediglich von eigener Verantwortung entlastet.
Was ist der Unterschied zwischen personaler und struktureller Gewalt?
Personale Gewalt ist die direkte Schädigung durch eine Person. Strukturelle Gewalt ist in gesellschaftliche Systeme eingebettet und äußert sich in ungleichen Lebenschancen.
Wie nehmen Kinder und Jugendliche Gewalt im Fernsehen wahr?
Die Rezeption unterscheidet sich stark zwischen fiktionaler Gewalt (z.B. Spielfilme) und nichtfiktionaler Gewalt (z.B. Nachrichten), was in zwei qualitativen Studien untersucht wurde.
Sind moralisierende Verbotsdebatten sinnvoll?
Die Arbeit hinterfragt, ob Verbote wie die Stärkung des Jugendschutzes allein ausreichen oder ob sie lediglich komplexe gesellschaftliche Prozesse ignorieren.
Welchen Einfluss hatte der Amoklauf von Erfurt auf die Debatte?
Der Amoklauf löste eine breite Diskussion über den Konsum gewaltverherrlichender Computerspiele und deren Wirkung auf Jugendliche aus.
Was ist das Ziel der qualitativen Sozialforschung in diesem Kontext?
Sie soll tiefergehende Einblicke in das Erleben und die Verarbeitung von Medieninhalten durch die Rezipienten ermöglichen, anstatt nur oberflächliche Wirkungszusammenhänge zu behaupten.
- Citation du texte
- Matthias Kießling (Auteur), 2003, Gewalt in Medien als Ursache gesellschaftlicher Gewalt? Zwei qualitative Studien und ihre Schlussfolgerungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36172