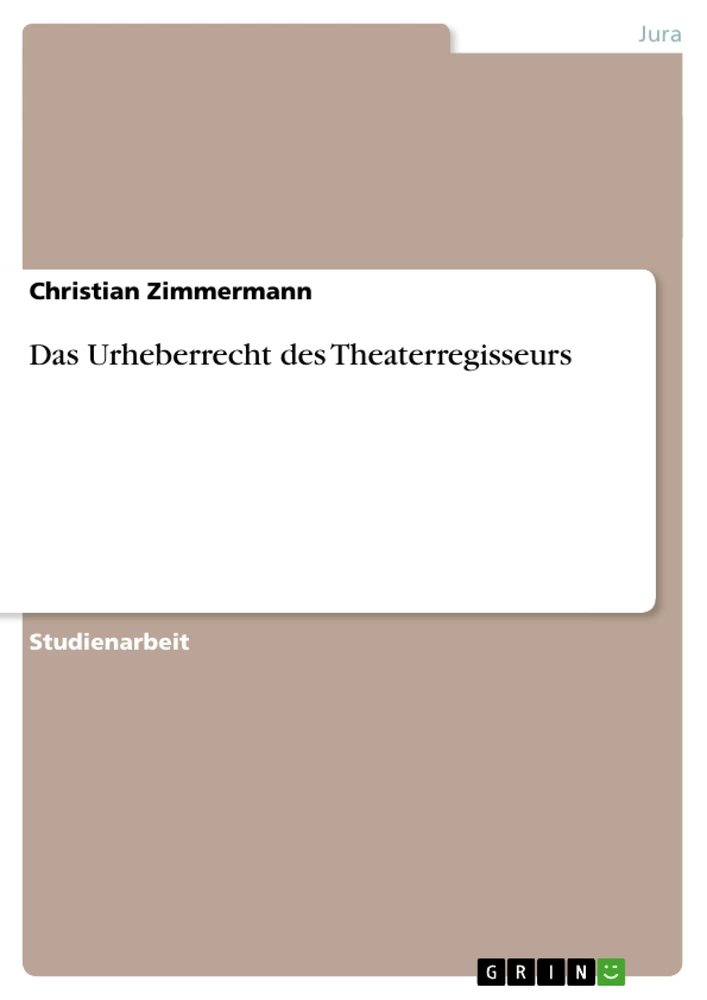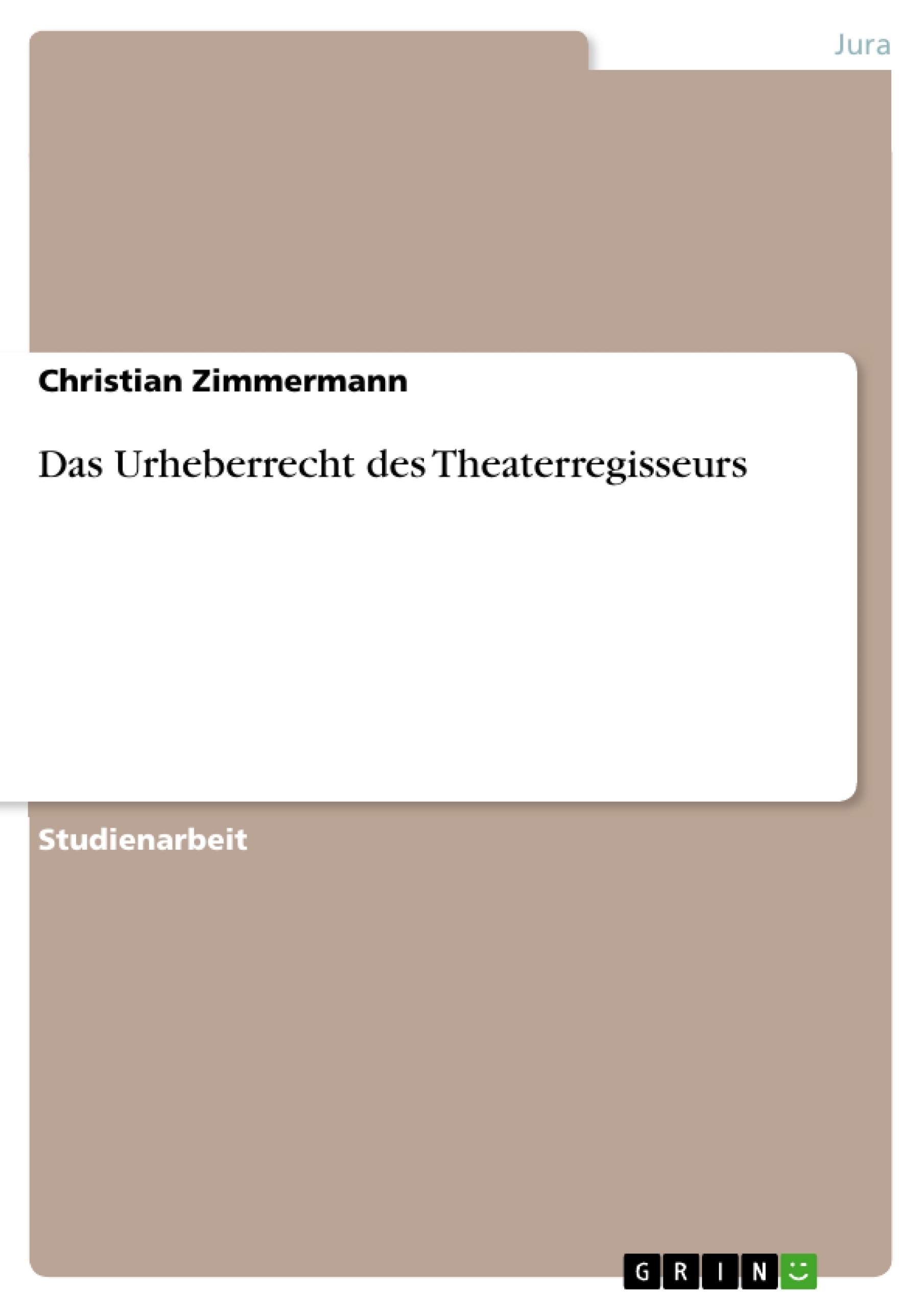Problemstellung
Das europäische Theater findet seinen Ursprung in Griechenland. Schon 500-400 v. Chr. führten die Griechen aus Dionysoskult sakrale Spiele auf. Über die Jahrhunderte entwickelte sich diese kulturelle Institution fort, so dass in England 1585 n. Chr. Berufsensembles diskutiert wurden. Noch heute erfreut sich das Theater großer Beliebtheit. Der Theaterregisseur ist jedoch nicht Kind der ersten Stunde des Theaters, sondern fand erst viel später den Weg zur Bühne und stieg auf zu einer der wichtigsten Positionen im Theaterbetrieb. Aber nicht nur in seiner eigentlichen Funktion, sondern auch aus juristischer Sicht stellt der Regisseur eine Besonderheit dar. Während man sich beim Autor darüber einig ist, dass er als Urheber zu behandeln ist, und die Schauspieler nach einhelliger Ansicht ausübende Künstler sind, ist die urheberrechtliche Einordnung des Theaterregisseurs seit mindestens einem Jahrhundert umstritten. 1 Weder Gesetzgebung noch Rechtsprechung konnten bisher einen eindeutigen Akzent auf ein Lösung legen. Das ist nicht verwunderlich, denn dass die juristische Handhabung der Kunst sehr schwierig ist, lernt der Student schon in den ersten Semestern, wenn es darum geht, die Kunst im Sinne des Grundgesetzes zu definieren. Bis heute verwendet das Bundesverfassungsgericht mehrere Kunstbegriffe nebeneinander, die sich auch ergänzen können. 2
Die Kunst, die der Regisseur vollbringt, ist die Inszenierung eines Theaterstückes. Ob der Regisseur für diese Leistung urheberrechtlichen Schutz genießt, ist nicht eindeutig geklärt. Diese Unklarheit liegt in der Tatsache begründet, dass das inszenierte Stück regelmäßig auf der Leistung eines Autors fußt. Die schwer zu klärende Frage ist also, wie eine Inszenierung und damit der Theaterregisseur urheberrechtlich zu qualifizieren ist. Die vorliegende Arbeit wird nach einer historischen Einleitung der urheberrechtlichen Stellung des Theaterregisseurs die Frage behandeln, wie die Inszenierung und damit die urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs heute zu qualifizieren ist. Daraufhin wird der Schutz, den der Theaterregisseur genießt, dargestellt, um die Arbeit in einem Fazit münden zu lassen.
---------
1 Grunert ZUM 2001, 213.
2 Pieroth/ Schlink § 14, 610 f.
Inhaltsverzeichnis
- A. Problemstellung
- B. Der Theaterregisseur in der historischen Entwicklung
- I.) Vor Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes
- II.) Nach Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes
- C. Die urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs
- I.) Ausübender Künstler, § 73 UrhG
- II.) Urheber, § 7 UrhG
- 1.) Das Werk
- a) Schöpfung
- b) Geistiger Gehalt
- c) Wahrnehmbare Formgestaltung
- d) Individualität
- 1.) Das Werk
- III.) Kritische Bewertung des Sachstandes
- 1.) Die Nähe zum Übersetzer
- 2.) Die Nähe zum Filmregisseur
- D. Die Rechte des Theaterregisseurs an der Inszenierung
- I.) Der Theaterregisseur als selbständiger Mitarbeiter
- 1.) Veröffentlichungsrecht, § 12 UrhG
- 2.) Namensnennungsrecht, § 13 UrhG
- 3.) Schutz vor Änderungen der Inszenierung
- 4.) Verbreitungsrecht, § 17 UrhG
- 5.) Rechte der öffentlichen Wiedergabe, § 19 UrhG
- 6.) Senderecht, § 20 UrhG
- 7.) Zugangsrecht, § 25 UrhG
- 8.) Rückrufsrecht, § 41, 42 UrhG
- 9.) Ertragsbeteiligung, § 32 UrhG
- II.) Der Theaterregisseur als unselbständiger Mitarbeiter
- 1.) Pflichtwerke
- 2.) Urheberpersönlichkeitsrechte
- I.) Der Theaterregisseur als selbständiger Mitarbeiter
- E. Fazit
- a) Veröffentlichungsrecht
- b) Namensnennungsrecht und Anerkennung der Urheberschaft
- c) Änderungs- und Entstellungsverbot
- d) Rückrufsrechte
- e) Zugangsrecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs. Ziel ist es, die Rechte des Regisseurs an seiner Inszenierung zu klären und die verschiedenen Aspekte seines rechtlichen Schutzes zu beleuchten, sowohl im Hinblick auf seine Rolle als selbständiger als auch als unselbständiger Mitarbeiter.
- Historisches Verständnis der urheberrechtlichen Entwicklung bezüglich des Theaterregisseurs
- Analyse der urheberrechtlichen Einordnung des Theaterregisseurs (Urheber vs. ausübender Künstler)
- Untersuchung der Schutzrechte des Theaterregisseurs an seiner Inszenierung
- Vergleich der rechtlichen Situation des Theaterregisseurs mit anderen Berufsgruppen (z.B. Übersetzer, Filmregisseur)
- Bewertung des aktuellen Sachstandes und seiner kritischen Punkte
Zusammenfassung der Kapitel
A. Problemstellung: Die Problemstellung der Arbeit liegt in der Klärung der komplexen urheberrechtlichen Situation des Theaterregisseurs und der Definition seiner Rechte an der Inszenierung. Es werden die Schwierigkeiten bei der Einordnung des Regisseurs als Urheber oder ausübender Künstler herausgestellt und die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der verschiedenen Rechtsaspekte aufgezeigt.
B. Der Theaterregisseur in der historischen Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der urheberrechtlichen Anerkennung des Theaterregisseurs, indem es die Situation vor und nach Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes vergleicht. Es zeigt die historische Entwicklung des Verständnisses von Regiearbeit auf und wie sich die rechtliche Einordnung im Laufe der Zeit verändert hat, und legt den Grundstein für die spätere Analyse der aktuellen Rechtslage.
C. Die urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs: Dieses Kapitel analysiert die urheberrechtliche Einordnung des Theaterregisseurs, wobei die verschiedenen Aspekte seiner Rolle als ausübender Künstler (§ 73 UrhG) und als Urheber (§ 7 UrhG) im Detail untersucht werden. Es wird eingehend auf die Kriterien für die Urheberschaft eingegangen (Schöpfung, geistiger Gehalt, wahrnehmbare Formgestaltung, Individualität) und die Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Kriterien auf die Regiearbeit erörtert. Die kritische Bewertung des Sachstandes umfasst einen Vergleich mit ähnlichen Berufsgruppen wie Übersetzer und Filmregisseure.
D. Die Rechte des Theaterregisseurs an der Inszenierung: Dieses Kapitel behandelt die Rechte des Theaterregisseurs an seiner Inszenierung, differenziert nach seiner Position als selbständiger oder unselbständiger Mitarbeiter. Es werden die einzelnen Schutzrechte (Veröffentlichungsrecht, Namensnennungsrecht, Schutz vor Änderungen, Verbreitungsrecht, Rechte der öffentlichen Wiedergabe, Senderecht, Zugangsrecht, Rückrufsrecht, Ertragsbeteiligung) ausführlich erläutert und ihre Bedeutung im Kontext der Theaterproduktion dargelegt. Der Unterschied zwischen Pflichtwerken und der Wahrnehmung von Urheberpersönlichkeitsrechten wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Theaterregisseur, Urheberrecht, Urheber, ausübender Künstler, Inszenierung, § 7 UrhG, § 73 UrhG, Schöpfung, geistiger Gehalt, Rechte, Veröffentlichungsrecht, Namensnennungsrecht, Änderungsrecht, selbständiger Mitarbeiter, unselbständiger Mitarbeiter, Pflichtwerk, Urheberpersönlichkeitsrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs und klärt dessen Rechte an der Inszenierung. Sie beleuchtet die verschiedenen Aspekte des rechtlichen Schutzes, sowohl für selbständige als auch unselbständige Mitarbeiter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Urheberrechts in Bezug auf den Theaterregisseur, seine Einordnung als Urheber oder ausübender Künstler, die Analyse seiner Schutzrechte (z.B. Veröffentlichungsrecht, Namensnennungsrecht, Schutz vor Änderungen), einen Vergleich mit ähnlichen Berufsgruppen (Übersetzer, Filmregisseur) und eine kritische Bewertung des aktuellen Sachstands.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Hauptteile gegliedert: Problemstellung, historische Entwicklung des Theaterregisseurs im Urheberrecht, urheberrechtliche Stellung des Theaterregisseurs (Urheber vs. ausübender Künstler), Rechte des Theaterregisseurs an der Inszenierung (selbständig/unselbständig) und ein Fazit. Jeder Teil ist weiter untergliedert in Unterkapitel und Punkte, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Rechte des Theaterregisseurs an seiner Inszenierung zu klären und die verschiedenen Aspekte seines rechtlichen Schutzes zu beleuchten. Sie soll ein umfassendes Verständnis der komplexen urheberrechtlichen Situation des Theaterregisseurs vermitteln.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Theaterregisseur, Urheberrecht, Urheber, ausübender Künstler, Inszenierung, § 7 UrhG, § 73 UrhG, Schöpfung, geistiger Gehalt, Rechte, Veröffentlichungsrecht, Namensnennungsrecht, Änderungsrecht, selbständiger Mitarbeiter, unselbständiger Mitarbeiter, Pflichtwerk, Urheberpersönlichkeitsrechte.
Wie wird der Theaterregisseur urheberrechtlich eingeordnet?
Die Arbeit analysiert die Einordnung des Theaterregisseurs als Urheber (§ 7 UrhG) oder ausübender Künstler (§ 73 UrhG). Es werden die Kriterien für die Urheberschaft (Schöpfung, geistiger Gehalt, wahrnehmbare Formgestaltung, Individualität) auf die Regiearbeit angewendet und die Schwierigkeiten dabei erörtert.
Welche Rechte hat der Theaterregisseur an seiner Inszenierung?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Rechte des Theaterregisseurs an seiner Inszenierung, unterscheidet zwischen selbständigen und unselbständigen Mitarbeitern und erläutert Schutzrechte wie Veröffentlichungsrecht, Namensnennungsrecht, Schutz vor Änderungen, Verbreitungsrecht, Rechte der öffentlichen Wiedergabe, Senderecht, Zugangsrecht, Rückrufsrecht und Ertragsbeteiligung.
Wie unterscheidet sich die Situation des Theaterregisseurs von anderen Berufsgruppen?
Die Arbeit vergleicht die rechtliche Situation des Theaterregisseurs mit der von Übersetzern und Filmregisseuren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die spezifischen Herausforderungen der urheberrechtlichen Einordnung der Regiearbeit zu beleuchten.
Welche kritischen Punkte werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit bewertet kritisch den aktuellen Sachstand und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Anwendung der urheberrechtlichen Bestimmungen auf die Arbeit des Theaterregisseurs. Sie hebt Problemfelder hervor und zeigt Entwicklungsbedarf auf.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Problemstellung, historische Entwicklung, urheberrechtliche Stellung, Rechte an der Inszenierung), welche die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
- Citation du texte
- Christian Zimmermann (Auteur), 2005, Das Urheberrecht des Theaterregisseurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36266