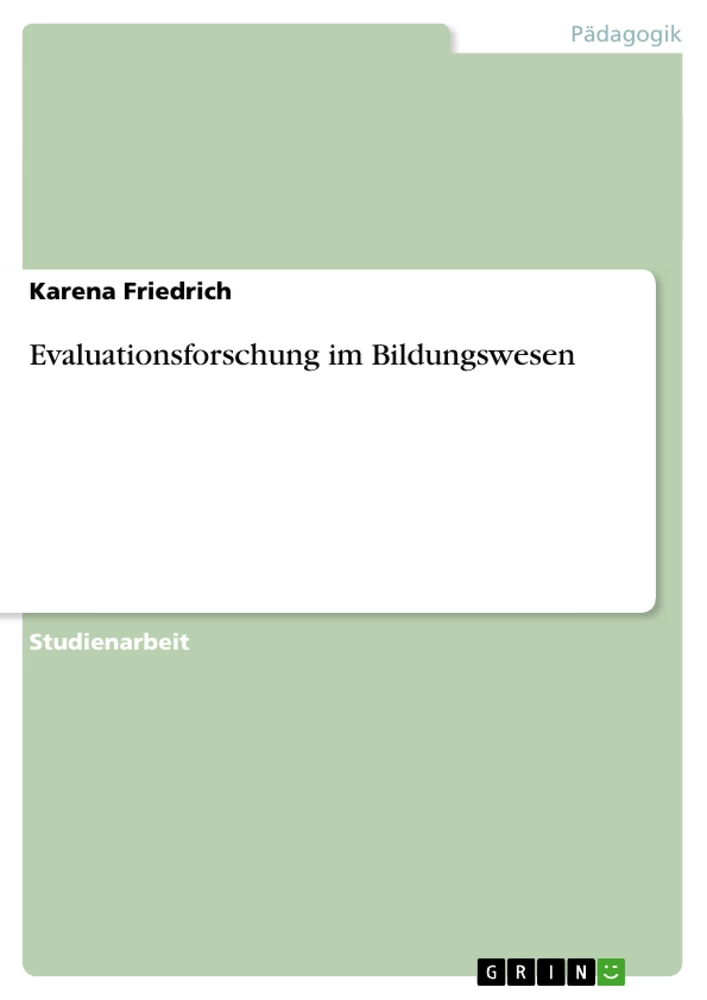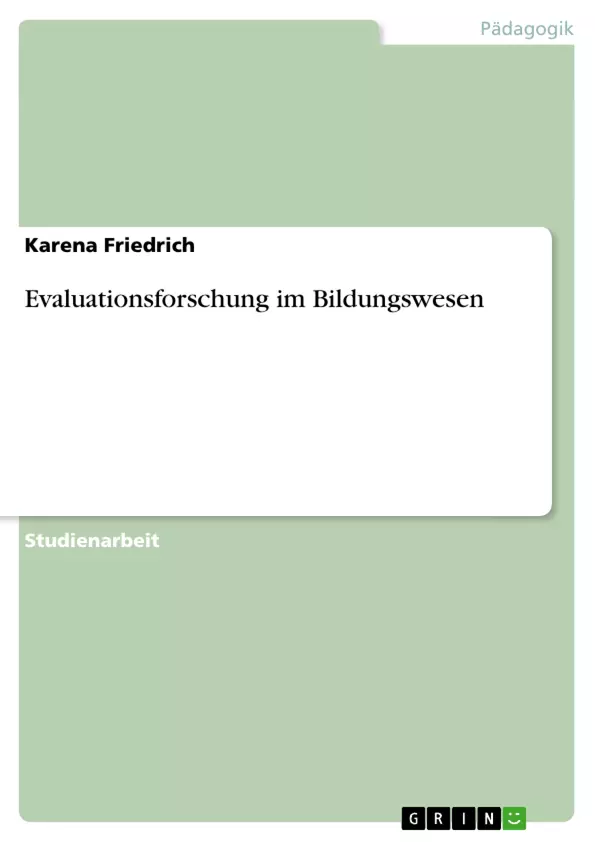Einführung
Der Ruf nach Evaluation des deutschen Bildungssystems und darauf aufbauender Qualitätssicherung, oder in diesem Zusammenhang passender, Qualitätsverbesserung ist spätestens seit der jüngsten Veröffentlichung der PISA-Studie 20001 wieder verstärkt zu hören. Das schlechte Abschneiden deutscher SchülerInnen2 hatte eine Art Schockwirkung sowohl auf Verantwortliche in Regierung, Kultusministerien und Schulen als auch auf Lehrer und Eltern. Offensichtlich liegt die Qualität der Lehr-Lern-Betriebe weit hinter denen vieler anderer Länder. Die Frage drängt sich auf, warum das so ist.
An diesem Punkt kann die Evaluationsforschung ansetzen. Sie hat speziell im Bereich des Bildungs- und Erziehungswesens die Aufgabe, pädagogische Maßnahmen, Programme und Handlungen wissenschaftlich zu beschreiben, zu bewerten und anhand dessen eine Empfehlung zur Qualitätssicherung und/oder Verbesserung zu geben. Diese Hausarbeit soll dazu einen Überblick über Evaluationsforschung und ihre verwendeten Methoden geben. Die theoretisch erläuterten Kenntnisse werden zudem exemplarisch am Beispiel eines konkreten, praktischen Beispiels veranschaulicht (MSL-Materialgestütztes Selbstgesteuertes Lernen). Die Arbeit beginnt mit dem zweiten Kapitel und einer kurzen Einführung in die Entstehung der Evaluationsforschung, um deren Relevanz für pädagogische Felder aufzuzeigen. Im dritten Kapitel werden die für die Evaluationsforschung wichtigsten Forschungsmethoden vorgestellt. Der Aufmerksamkeit liegt dabei hauptsächlich auf der qualitativen Sozialforschung. Es werden die wichtigsten wissenschaftstheoretischen Positionen und Methoden erläutert, die der qualitativen Sozialforschung zugrunde liegen. Zusätzlich wird auf die Frage eingegangen, ob und wie sich qualitative und quantitative Ansätze sinnvoll kombinieren lassen.
Im vierten Kapitel werden wichtige Aspekte der Evaluationsforschung3 behandelt und dabei verschiedene Modelle und der wissenschaftliche Ablauf einer Evaluation vorgestellt. Ausgehend von diesen theoretischen Erläuterungen wird im fünften Kapitel anhand eines einfachen, praktischen Beispiels der mögliche Ablauf einer Evaluation exemplarisch aufgezeigt. Abschließend folgt das Schlusswort mit einer persönliche Einschätzung zur Relevanz von Evaluation im deutschen Bildungssystem.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Entstehung der Evaluationsforschung
- Qualitative und quantitative Sozialforschung im Vergleich
- Wissenschaftstheoretische Positionen zur qualitativen Sozialforschung
- Qualitative Methoden
- Quantitative Methoden
- Möglichkeiten und Vorteile einer Kombination
- Evaluationsforschung im Überblick
- Voraussetzungen und Ziele einer Evaluation
- Evaluationsobjekte und -bereiche
- Verschiedene Evaluationsmodelle
- Ablauf einer Evaluation
- Gegenstandsbestimmung
- Informationssammlung
- Ergebniseinspeisung
- Probleme einer Evaluation
- Evaluation einer innovativen Lehrmethode
- Das Projekt „MSL“
- Die Evaluation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Evaluationsforschung im Bildungswesen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Entstehung, die Methoden und den Ablauf von Evaluationen zu geben. Darüber hinaus soll das Konzept der Evaluation anhand eines konkreten Beispiels veranschaulicht werden.
- Entstehung und Entwicklung der Evaluationsforschung
- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden im Vergleich
- Verschiedene Modelle und Ansätze der Evaluationsforschung
- Der Ablauf einer Evaluation
- Praxisbezogene Anwendung der Evaluationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Entstehung der Evaluationsforschung, die ihren Ursprung in den USA der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hat. Im zweiten Kapitel werden die Entwicklungsphasen der Evaluationsforschung in den USA beleuchtet, wobei der Fokus auf der zunehmenden Bedeutung von Evaluation für die Qualitätssicherung im Bildungswesen liegt.
Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Forschungsmethoden für die Evaluationsforschung vorgestellt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der qualitativen Sozialforschung, die sich durch ihre interpretative und verstehensorientierte Herangehensweise auszeichnet.
Kapitel 4 befasst sich mit den zentralen Aspekten der Evaluationsforschung und stellt verschiedene Evaluationsmodelle vor, die unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele berücksichtigen. Auch der wissenschaftliche Ablauf einer Evaluation wird in diesem Kapitel detailliert beschrieben.
Das fünfte Kapitel stellt anhand eines konkreten Praxisbeispiels (MSL-Materialgestütztes Selbstgesteuertes Lernen) den möglichen Ablauf einer Evaluation dar.
Schlüsselwörter
Evaluationsforschung, Bildungswesen, Qualitätssicherung, qualitative Sozialforschung, quantitative Sozialforschung, Evaluationsmodelle, Evaluationsprozess, Praxisbeispiel, MSL-Materialgestütztes Selbstgesteuertes Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe der Evaluationsforschung im Bildungswesen?
Sie beschreibt und bewertet pädagogische Maßnahmen wissenschaftlich, um Empfehlungen zur Qualitätssicherung und Verbesserung (z.B. nach dem PISA-Schock) zu geben.
Was ist der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Evaluation?
Qualitative Methoden sind verstehensorientiert und interpretativ, während quantitative Methoden auf Messung, Statistik und Verallgemeinerbarkeit setzen.
Wie sieht ein typischer Ablauf einer Evaluation aus?
Der Prozess umfasst die Gegenstandsbestimmung, die Informationssammlung, die Analyse und schließlich die Rückspeisung der Ergebnisse in die Praxis.
Was ist das "MSL"-Projekt?
MSL steht für "Materialgestütztes Selbstgesteuertes Lernen" und dient in dieser Arbeit als Praxisbeispiel für die Evaluation einer innovativen Lehrmethode.
Warum wurde Evaluation nach der PISA-Studie 2000 so wichtig?
Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler führte zu einem Ruf nach systematischer Qualitätskontrolle, um die Ursachen für Leistungsdefizite zu finden.
- Citation du texte
- Karena Friedrich (Auteur), 2003, Evaluationsforschung im Bildungswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36331