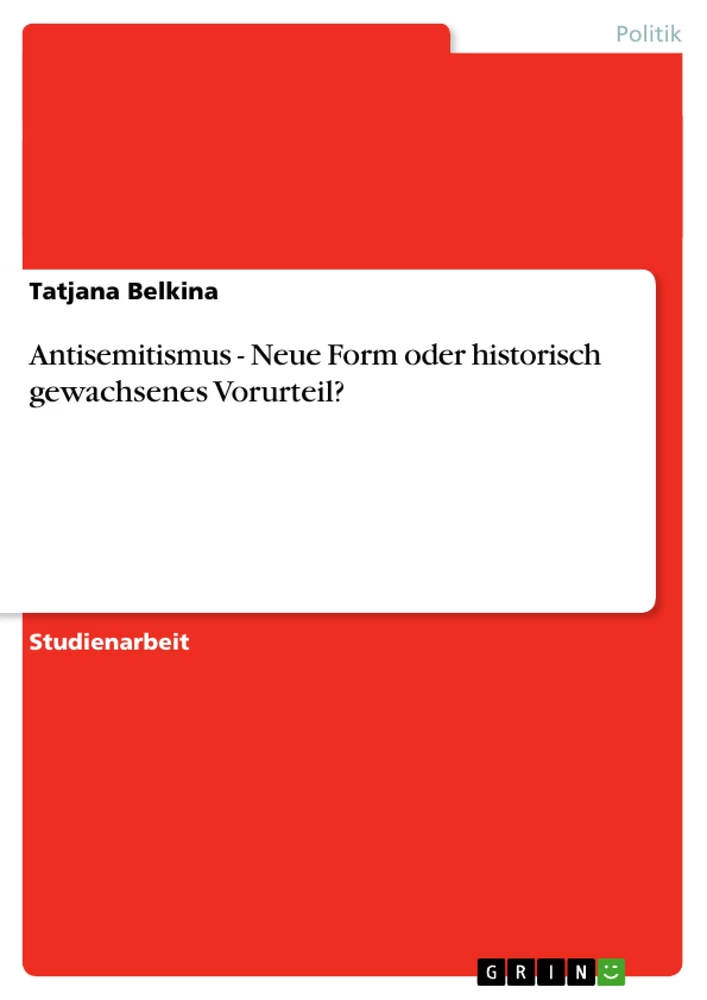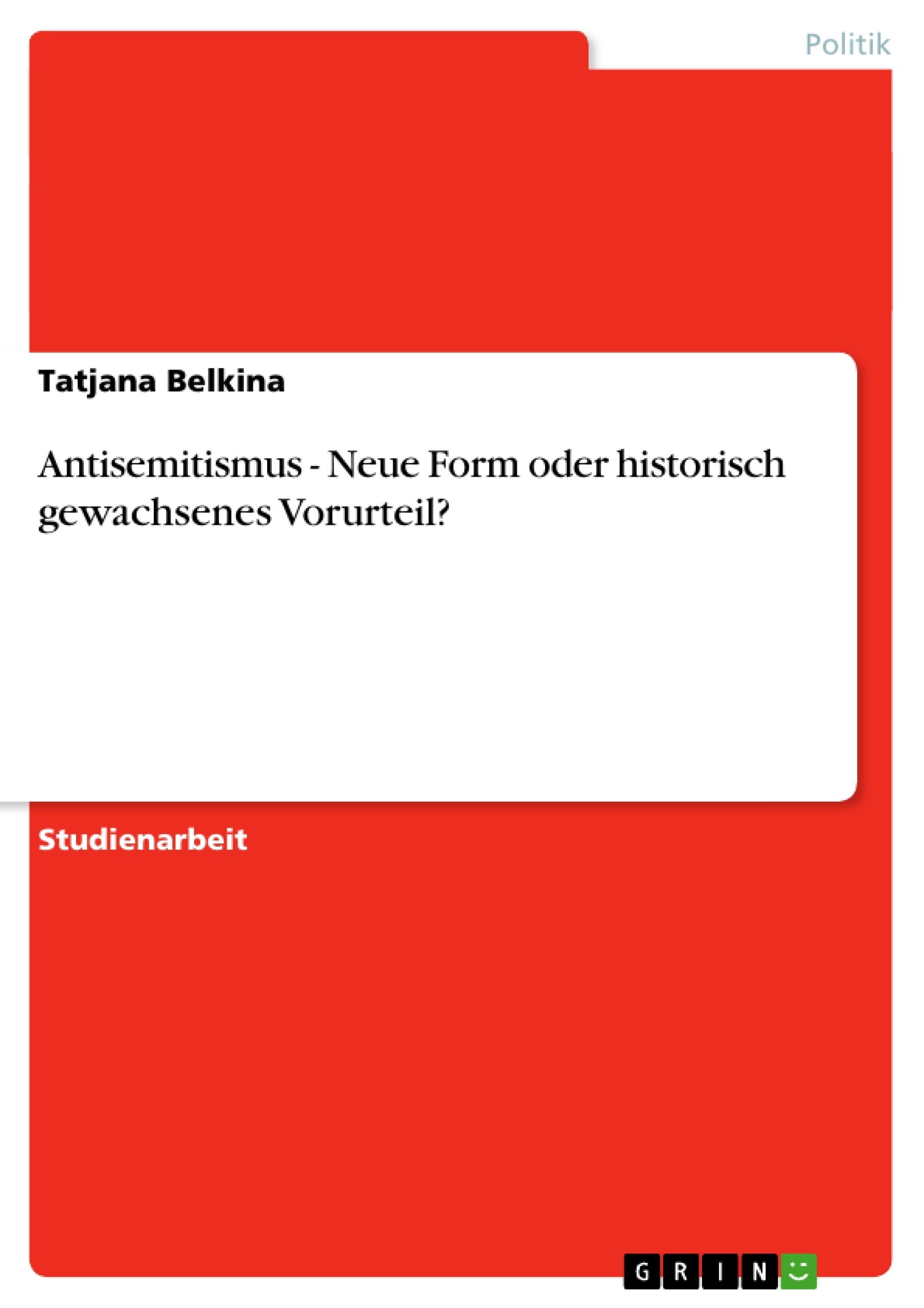2003 hat die Europäische Kommission eine Umfrage unter 7500 Europäern durchgeführt, dessen Ergebnis wie folgt lautete: „Israel ist die größte Gefahr für den Weltfrieden - Israel, das ist ein explosives Gemisch aus jüdischer Aggressivität, jüdischer Arroganz, jüdischer moralischer Erpressung und jüdischem Finassieren“ (Vgl.: „Altes Gift im neuen Europa“ in: „Die Zeit“ 11.12.2003, Nr. 51). Die nach dem Zweiten Weltkrieg durch strenge gesellschaftliche Tabus unterdrückten Stereotype sind nach 60 Jahren wieder aufgetaucht. Im folgenden Forschungsbericht soll untersucht werden, in wieweit Israelkritik legitim ist, ohne dass diese als eine antisemitische Äußerung aufgefasst wird. Wo verläuft die Grenze zwischen der Kritik an der israelischen Politik und Judenhass, gefärbt von einem antizionistischen Schatten? Ist diese Art von Antisemitismus, d.h. Israelkritik, als eine „neue“ Form des Antisemitismus anzusehen oder ist es der „alte“ Antisemitismus, welcher sich nur hinter der aktuellen politischen Debatte versteckt? Diese Fragen sollen untersucht und mit statistischen Daten untermauert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Theorie
- Operationalisierung - Was ist Antisemitismus?
- Klassischer Antisemitismus
- Sekundärer Antisemitismus
- Antizionismus
- Entstehung des Antisemitismus
- Antisemitismus im Mittelalter
- Antisemitismus in der frühen Neuzeit
- Antisemitismus in der Gegenwart
- Werner Bergmanns Theorie des „neuen“ Antisemitismus
- Zwischenfazit
- Die quantitative Analyse
- Die statistische Grundlage
- Die Faktorenanalyse
- Zusammengefasste Faktorenanalyse
- Zwischenfazit
- Die statistische Hypothesenprüfung
- Die Aufstellung der Hypothesen
- Zwischenfazit
- Theorie und Praxis – Zusammenfassung und Auswertung
- Kritik am Fragebogen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimität von Israelkritik und deren Abgrenzung zu antisemitischen Äußerungen. Sie beleuchtet die Frage, wo die Grenze zwischen Kritik an der israelischen Politik und Judenhass verläuft und ob der aktuelle Antisemitismus als "neue" oder lediglich als "alte" Form hinter neuer politischer Debatte versteckt anzusehen ist. Dies wird anhand statistischer Daten aus dem GMF-Survey 2004 untersucht.
- Definition und Abgrenzung von Antisemitismus (klassisch, sekundär, Antizionismus)
- Historische Entwicklung des Antisemitismus
- Werner Bergmanns Theorie des "neuen" Antisemitismus
- Quantitative Analyse von Israelkritik und antisemitischen Einstellungen
- Zusammenhang zwischen der politischen Lage Israels und antisemitischen Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Hintergrund der Arbeit, ausgehend von einer EU-Umfrage, die die Wiederauftauchung antisemitischer Stereotype nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt. Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Abgrenzung legitimer Israelkritik von Antisemitismus. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil (A) mit der Darstellung der Geschichte des Antisemitismus und Werner Bergmanns Theorie des „neuen“ Antisemitismus, und einen quantitativen Teil (B) mit der Auswertung des GMF-Surveys 2004. Das Ziel ist die Untersuchung des „neuen Antisemitismus“ und der „judenbezogenen Antiisraelhaltung“.
Definition und Theorie: Dieses Kapitel definiert Antisemitismus anhand der Definitionen von Hans Marr und Hannah Arendt. Es gliedert die Judenfeindschaft in drei historische Phasen (Mittelalter, frühe Neuzeit, Gegenwart) und analysiert verschiedene Facetten des Antisemitismus. Es wird zwischen klassischem Antisemitismus (basierend auf negativen Stereotypen), sekundärem Antisemitismus (Verharmlosung oder Leugnung des Holocaust), und Antizionismus (Gegnerschaft zum Staat Israel) unterschieden. Die Definitionen werden kritisch beleuchtet und in einen theoretischen Kontext eingebettet. Der Zusammenhang zwischen diesen Formen des Antisemitismus wird untersucht.
Entstehung des Antisemitismus: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Antisemitismus über verschiedene Epochen, beginnend mit dem Mittelalter, der frühen Neuzeit und schließlich der Gegenwart. Es analysiert die spezifischen Manifestationen des Antisemitismus in den jeweiligen historischen Kontexten und erläutert die anhaltenden Auswirkungen dieser historischen Entwicklungen auf das heutige Verständnis und die Wahrnehmung von Antisemitismus. Die Epochen werden mit ihren jeweils besonderen Charakteristika und den Wurzeln des heutigen Antisemitismus dargestellt.
Die quantitative Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise und die statistische Analyse der Daten des GMF-Surveys 2004. Es wird erläutert, wie die Daten erhoben und aufbereitet wurden. Die Faktorenanalyse und die statistische Hypothesentestung werden detailliert beschrieben, um ein fundiertes Verständnis der Analysemethoden zu ermöglichen und die Transparenz der Forschungsarbeit sicherzustellen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der angewandten statistischen Methoden und ihrer Anwendung auf die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Israelkritik, Antizionismus, klassischer Antisemitismus, sekundärer Antisemitismus, Werner Bergmann, Holocaust, GMF-Survey 2004, quantitative Analyse, historische Entwicklung, Stereotype, Judenfeindschaft, Israel, Weltfrieden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Legitime Israelkritik vs. Antisemitismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Abgrenzung zwischen legitimer Israelkritik und antisemitischen Äußerungen. Sie fragt, wo die Grenze zwischen Kritik an der israelischen Politik und Judenhass verläuft und ob der aktuelle Antisemitismus als "neu" oder "alt" einzustufen ist. Die Analyse basiert auf Daten des GMF-Surveys 2004.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine theoretische Auseinandersetzung mit der Definition und den verschiedenen Formen des Antisemitismus (klassisch, sekundär, Antizionismus), seiner historischen Entwicklung (Mittelalter, frühe Neuzeit, Gegenwart) sowie Werner Bergmanns Theorie des "neuen" Antisemitismus. Der quantitative Teil analysiert Daten des GMF-Surveys 2004, um den Zusammenhang zwischen Israelkritik und antisemitischen Einstellungen zu untersuchen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit quantitativen Methoden. Im quantitativen Teil wird der GMF-Survey 2004 mittels Faktorenanalyse und statistischer Hypothesentests ausgewertet. Die angewandten statistischen Methoden werden detailliert beschrieben.
Wie wird Antisemitismus definiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Definitionen von Hans Marr und Hannah Arendt und unterscheidet zwischen klassischem Antisemitismus (basierend auf negativen Stereotypen), sekundärem Antisemitismus (Verharmlosung oder Leugnung des Holocaust) und Antizionismus (Gegnerschaft zum Staat Israel). Die Definitionen werden kritisch diskutiert und in einen theoretischen Kontext eingeordnet.
Welche Rolle spielt die historische Entwicklung des Antisemitismus?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Antisemitismus vom Mittelalter über die frühe Neuzeit bis in die Gegenwart. Sie analysiert die spezifischen Manifestationen in den jeweiligen Epochen und deren Auswirkungen auf das heutige Verständnis von Antisemitismus.
Was ist Werner Bergmanns Theorie des "neuen" Antisemitismus?
Die Arbeit behandelt und diskutiert die Theorie des "neuen" Antisemitismus von Werner Bergmann im Kontext der aktuellen Debatte um Israelkritik und Antisemitismus. Sie untersucht die Frage, ob der aktuelle Antisemitismus als eine neue oder lediglich als eine alte Form hinter einer neuen politischen Debatte versteckt anzusehen ist.
Welche Daten werden verwendet?
Die quantitative Analyse basiert auf Daten des GMF-Surveys 2004. Die methodische Vorgehensweise bei der Datenaufbereitung und -analyse wird detailliert erläutert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Israelkritik und antisemitischen Einstellungen, unter Berücksichtigung der Definitionen und der historischen Entwicklung des Antisemitismus, sowie unter Bezugnahme auf die Theorie des „neuen Antisemitismus“. Die konkreten Schlussfolgerungen ergeben sich aus der quantitativen Analyse des GMF-Surveys 2004.
Gibt es eine Kritik am verwendeten Fragebogen?
Ja, die Arbeit enthält einen Abschnitt mit Kritikpunkten zum verwendeten Fragebogen des GMF-Surveys 2004.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Antisemitismus, Israelkritik, Antizionismus, klassischer Antisemitismus, sekundärer Antisemitismus, Werner Bergmann, Holocaust, GMF-Survey 2004, quantitative Analyse, historische Entwicklung, Stereotype, Judenfeindschaft, Israel, Weltfrieden.
- Citation du texte
- Tatjana Belkina (Auteur), 2004, Antisemitismus - Neue Form oder historisch gewachsenes Vorurteil?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36514