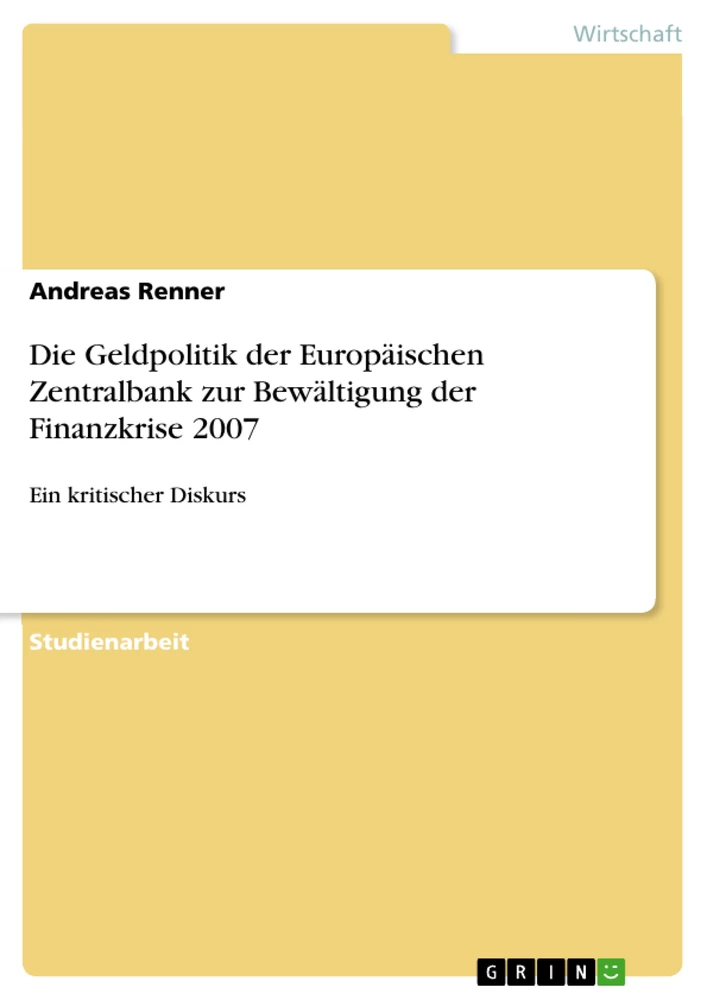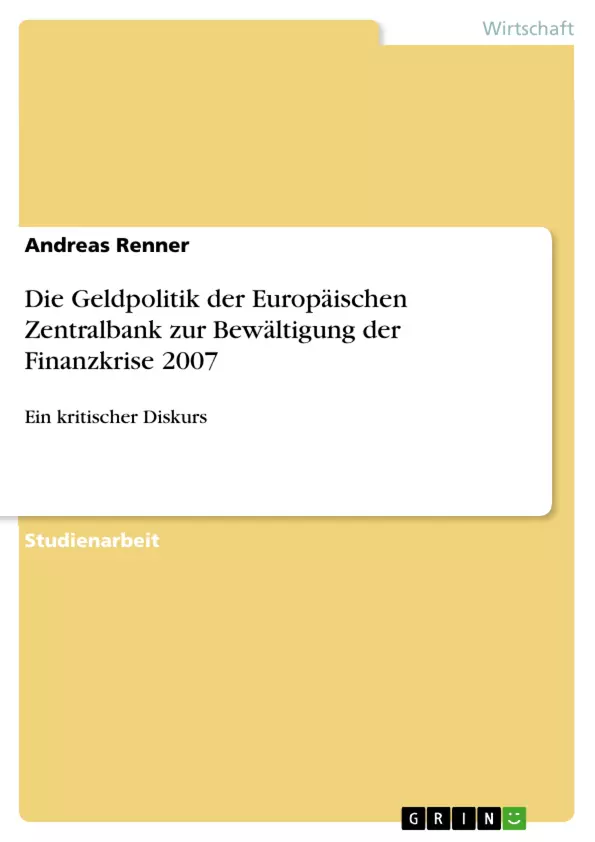The financial crisis 2007 and its effects for the European economy and countries force the European Central Bank to intervene by monetary measures. To reach the primary goal, which is maintaining price stability by a Harmonized Index of Consumer Prices near but below two percent, the Central Bank utilizes some contentious policies like the Outright Monetary Transactions and the Asset-Purchase Program, in particular in the financial market.
The author delineated the main interventions of the ECB since October 2008. Furthermore, the writer used the IS-LM-Model to demonstrate the abstract impact of expansive monetary policy. Finally, he expanded on the main points of criticism, which were the allegation of clientele politics against the European Central Bank and the possible violation of its mandate due to the Outright Monetary Transactions. For this, the author outlined the arguments of both sides. Concluding, the author assessed, involving the current economic situation in the European system, that the monetary policy of the ECB supported the recovery of the financial sector and the members of the EU.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Zielvorstellung mit Eingrenzung des Themas und Definitionen
- Zielvorstellung mit Eingrenzung des Themas
- Definitionen
- Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank
- Quantitative Lockerung
- Die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank zur Bewältigung der Finanzkrise 2007
- Der Schock und seine Ursachen
- Die Gegenmaßnahmen der Europäischen Zentralbank
- Expansive Geldpolitik im IS-LM-Modell
- Diskurs über die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank in der Finanzkrise
- Kritische Bewertung hinsichtlich Effektivität und Zielgruppe der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank
- Deutsche Kritikpunkte am OMT-Programm der Europäischen Zentralbank
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) während der Finanzkrise 2007 und deren Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Die Arbeit untersucht die Maßnahmen der EZB, insbesondere die Outright Monetary Transactions (OMT) und das Asset-Purchase Program (APP), um die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Kritikpunkte an der EZB-Politik und deren Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems beleuchtet.
- Analyse der geldpolitischen Maßnahmen der EZB während der Finanzkrise 2007
- Bewertung der Effektivität der EZB-Politik zur Bewältigung der Finanzkrise
- Untersuchung der Kritikpunkte an der EZB-Politik
- Diskussion der Auswirkungen der EZB-Politik auf die europäische Wirtschaft und das Finanzsystem
- Beurteilung der Rolle der EZB als Garant für Preisstabilität im Euroraum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und erläutert die Relevanz der Geldpolitik der EZB im Kontext der Finanzkrise 2007. Die Arbeit beleuchtet die Ziele der EZB und die Herausforderungen, denen sie während der Finanzkrise gegenüberstand.
Zielvorstellung mit Eingrenzung des Themas und Definitionen: Dieses Kapitel definiert die Zielvorstellung der Arbeit und grenzt das Thema ein. Es werden wichtige Begriffe wie Geldmarktpolitik, Quantitative Lockerung und Preisstabilität erläutert.
Die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank zur Bewältigung der Finanzkrise 2007: Dieses Kapitel analysiert die geldpolitischen Maßnahmen der EZB während der Finanzkrise 2007. Es werden die Ursachen des Schocks, die Gegenmaßnahmen der EZB und die Auswirkungen der expansiven Geldpolitik im IS-LM-Modell beleuchtet.
Diskurs über die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank in der Finanzkrise: Dieses Kapitel diskutiert die Kritikpunkte an der Geldpolitik der EZB während der Finanzkrise. Es werden die Effektivität der Maßnahmen, die Zielgruppe der Politik und die Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems untersucht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Geldpolitik der EZB, der Finanzkrise 2007, der Preisstabilität, der Outright Monetary Transactions (OMT), dem Asset-Purchase Program (APP), der expansiven Geldpolitik, der IS-LM-Modell, der Kritik an der EZB-Politik und den Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz der EZB-Politik für die Stabilität des Finanzsystems und die Bewältigung der Finanzkrise.
Häufig gestellte Fragen
Was war das primäre Ziel der EZB während der Finanzkrise 2007?
Das Hauptziel der Europäischen Zentralbank ist die Gewährleistung der Preisstabilität, definiert als eine Inflationsrate des HVPI von nahe, aber unter zwei Prozent.
Was sind Outright Monetary Transactions (OMT)?
OMT ist ein Programm der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen kriselnder Euro-Staaten am Sekundärmarkt, um die Zinsen zu senken und die Stabilität des Euro-Währungsgebiets zu sichern.
Wie wird expansive Geldpolitik im IS-LM-Modell dargestellt?
Im IS-LM-Modell führt eine Erhöhung der Geldmenge zu einer Verschiebung der LM-Kurve nach rechts, was ceteris paribus die Zinsen senkt und das Volkseinkommen kurzfristig steigert.
Welche Kritikpunkte gibt es an der EZB-Politik?
Kritisiert wurden unter anderem eine vermeintliche Klientelpolitik, die Überschreitung des Mandats durch Staatsfinanzierung sowie potenzielle Risiken für die Unabhängigkeit der Zentralbank.
Was versteht man unter Quantitativer Lockerung (QE)?
Quantitative Lockerung bezeichnet den großflächigen Ankauf von Vermögenswerten (meist Anleihen) durch die Zentralbank, um die Geldmenge zu erhöhen und die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln, wenn herkömmliche Zinssenkungen nicht mehr ausreichen.
- Arbeit zitieren
- Andreas Renner (Autor:in), 2016, Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zur Bewältigung der Finanzkrise 2007, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365722