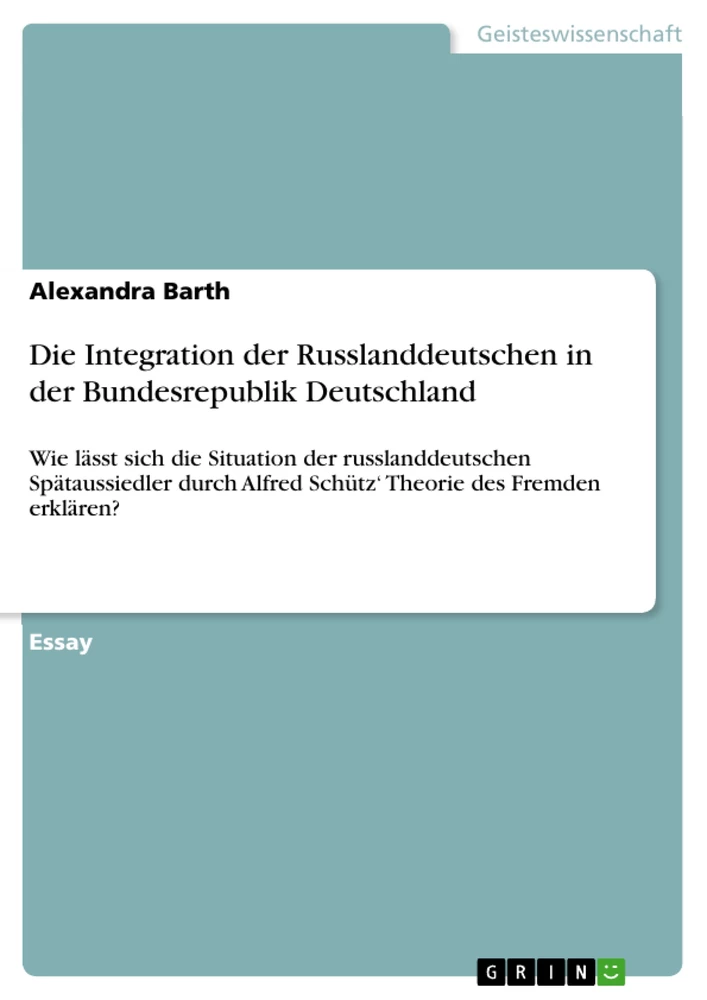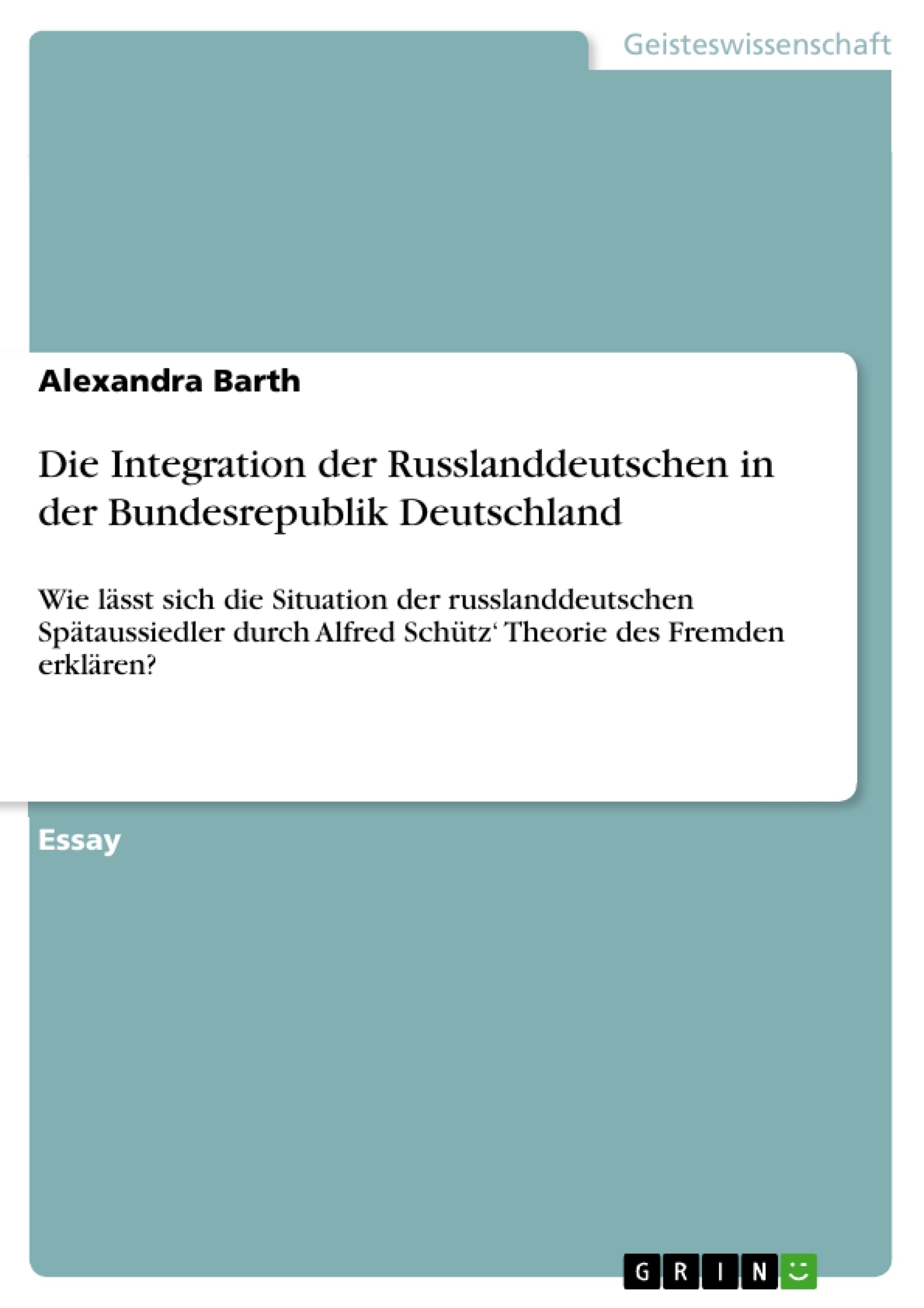Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Alfred Schütz‘ Theorie des Fremden eingegangen, um die Situation der russlanddeutschen Spätaussiedler in der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren und der Frage nachzugehen, inwieweit sie als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes Artikel 116 trotzdem als Fremde in der deutschen Gesellschaft auftreten und dem Begriff „marginal man“, was als ein „kultureller Bastard an der Grenze von zwei verschiedenen Mustern des Gruppenlebens, der nicht weiß, wohin er gehört“ verstanden wird, entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung zur Fragestellung...
- 2. Bezug auf Schütz' Theorie des Fremden
- 2.1. Die Theorie des Fremden .......
- 2.2. Spätaussiedler aus der früheren Sowjetunion: Geschichte und neue Entwicklungen einer Einwanderungsbewegung...
- 2.3. Der Status der Russlanddeutschen laut Schütz' Theorie des Fremden........
- 3. Erläuterung der Erkenntnisziele, Arbeitsdefinitionen und Arbeitshypothesen.
- 3.1. Die qualitative empirische Forschung.
- 3.1.1. Das problemzentrierte Interview.
- 3.1.2. Die Leitfragen für das Interview.
- 3.1. Die qualitative empirische Forschung.
- 4. Reflexion erwartbarer Befunde der qualitativen empirischen Forschung anhand vom problemzentrierten Interview.
- 5. Arbeitsplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation russlanddeutscher Spätaussiedler in der Bundesrepublik Deutschland und analysiert, inwieweit sie trotz ihrer deutschen Staatsbürgerschaft als „Fremde“ in der deutschen Gesellschaft auftreten. Dazu wird die Theorie des Fremden von Alfred Schütz herangezogen, um die spezifischen Herausforderungen der Integration russlanddeutscher Spätaussiedler zu beleuchten.
- Die Integration russlanddeutscher Spätaussiedler in die deutsche Gesellschaft
- Die Anwendung von Alfred Schütz' Theorie des Fremden auf die Situation der Spätaussiedler
- Die Rolle von kulturellen Unterschieden und Sprachbarrieren bei der Integration
- Die Herausforderungen, die sich aus dem Status als „marginal man“ ergeben
- Die Bedeutung von Identität und Zugehörigkeit für die Integrationserfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Hinführung zur Fragestellung: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik der Integration von Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland. Es beleuchtet die demografischen Veränderungen und die Herausforderungen des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen im deutschen Kontext.
- Kapitel 2: Bezug auf Schütz' Theorie des Fremden: Dieses Kapitel stellt die Theorie des Fremden von Alfred Schütz vor und untersucht die relevanten Aspekte für die Analyse der Situation von Spätaussiedlern. Die Theorie wird in ihren historischen Kontext eingebettet und auf die spezifischen Herausforderungen von Migranten in einer fremden Kultur übertragen.
- Kapitel 3: Erläuterung der Erkenntnisziele, Arbeitsdefinitionen und Arbeitshypothesen: Dieses Kapitel erläutert die Forschungsmethode der Arbeit und beschreibt die qualitativen Interviews als Datenerhebungsmethode. Es definiert die wichtigsten Begriffe und formuliert die Arbeitshypothesen.
- Kapitel 4: Reflexion erwartbarer Befunde der qualitativen empirischen Forschung anhand vom problemzentrierten Interview: Dieses Kapitel thematisiert die erwarteten Ergebnisse der durchgeführten Interviews und analysiert die möglichen Erkenntnisse im Hinblick auf die Integration russlanddeutscher Spätaussiedler.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Russlanddeutsche, Spätaussiedler, Integration, Fremdheit, Alfred Schütz, Theorie des Fremden, marginal man, Identität, Kultur, Sprachbarrieren, qualitative Forschung, problemzentrierte Interviews.
Häufig gestellte Fragen
Wie wendet die Arbeit Alfred Schütz' Theorie des Fremden an?
Die Theorie dient dazu, die Situation russlanddeutscher Spätaussiedler zu analysieren, die trotz deutscher Staatsangehörigkeit oft kulturelle Barrieren erleben und sich in der deutschen Gesellschaft fremd fühlen.
Was bedeutet der Begriff „marginal man“ in diesem Kontext?
Ein „marginal man“ ist ein „kultureller Bastard“ an der Grenze zweier Lebensmuster. Er gehört weder der alten noch der neuen Gruppe vollständig an und befindet sich in einem Identitätskonflikt.
Warum werden Russlanddeutsche oft als „Fremde“ wahrgenommen?
Trotz rechtlicher Gleichstellung durch das Grundgesetz (Art. 116) führen kulturelle Unterschiede, Sozialisation in der Sowjetunion und Sprachbarrieren zu einer Wahrnehmung als Außenseiter.
Welche Forschungsmethode wurde in der Arbeit genutzt?
Es wurde eine qualitative empirische Forschung mittels problemzentrierter Interviews durchgeführt, um die individuellen Integrationserfahrungen der Spätaussiedler zu erfassen.
Was sind die zentralen Herausforderungen bei der Integration von Spätaussiedlern?
Zu den Haupthindernissen zählen der Verlust der alten Heimatidentität, der Aufbau einer neuen Zugehörigkeit in Deutschland sowie der Umgang mit Vorurteilen der Mehrheitsgesellschaft.
- Citar trabajo
- Alexandra Barth (Autor), 2017, Die Integration der Russlanddeutschen in der Bundesrepublik Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366014