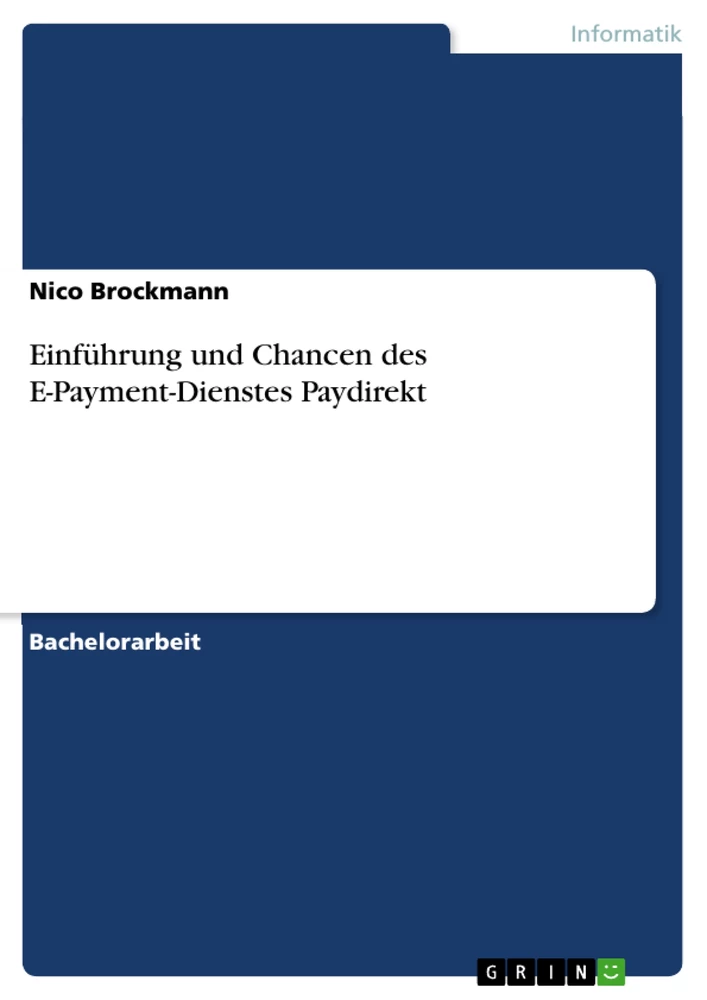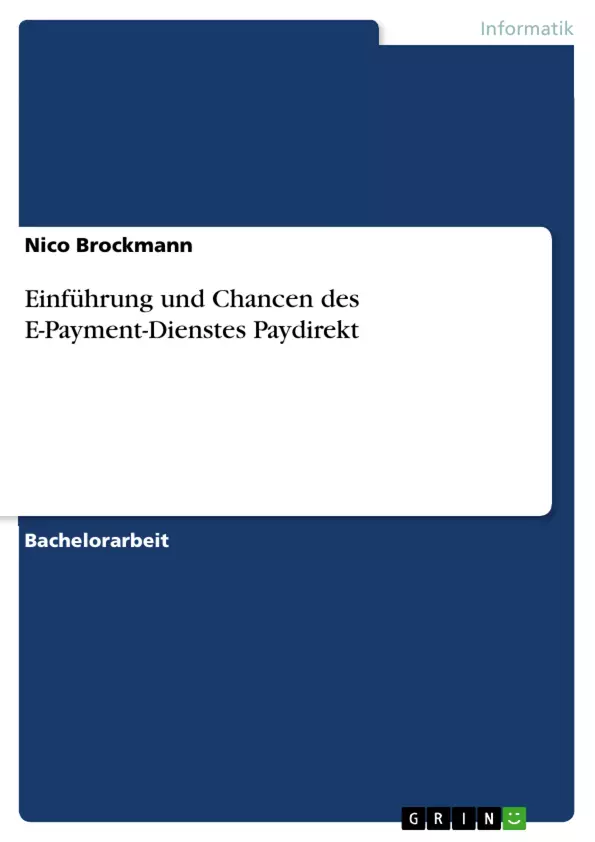Das Ziel dieser Arbeit ist es die Chancen des Online-Bezahlverfahrens paydirekt auf dem Markt der elektronischen Zahlungssysteme zu bewerten. Dazu wird zunächst eine Analyse der Kundenanforderungen an Zahlungssysteme basierend auf einer Onlineumfrage durchgeführt. Davon ausgehend folgt eine Nutzwertanalyse ausgewählter klassischer und elektronischer Verfahren, mit dem Ziel die individuellen Stärken und Schwächen dieser herauszuarbeiten. Dabei konnte sich keine der betrachteten Bezahl-Alternativen erheblich von den Übrigen herausheben. Weiterhin liefert die Analyse die Erkenntnis, dass paydirekt konkurrenzfähig ist und über Potential verfügt sich im Onlinehandel zu etablieren. Die Verbreitung gestaltet sich jedoch aufgrund des vorliegenden Netzwerkeffektes von Zahlungssystemen als kompliziertes und langwieriges Vorhaben. Abschließend liefert der Autor Handlungsempfehlungen, um dieses Bestreben weiter zu forcieren und den Kundenutzen des Dienstes zu stärken.
Um sich dem dynamischen Markt anzupassen und ihre eigene Wettbewerbsposition zu festigen, sind die Banken angehalten auf den Wandel zu reagieren und ihre Dienstleistungen an den geänderten Anforderungen und neuen Wettbewerbern auszurichten. Diese Arbeit basiert auf Untersuchungen innerhalb der Finanz Informatik GmbH & Co. KG (nachfolgend Finanz Informatik), dem IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Angebot der Finanzinformatik reicht von der Entwicklung und Bereitstellung von IT-Anwendungen, Netzwerken, technischer Infrastruktur und Rechenzentrumsbetrieb bis zur Beratung und Schulung der Sparkassenmitarbeiter. Insgesamt verwaltet das Unternehmen 122 Millionen Konten. Auf dem System werden jährlich über 102 Milliarden Transaktionen getätigt. Gemessen an diesen Zahlen ist die Finanz Informatik einer der größten IT-Finanzdienstleister Europas.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Grundlagen
- 2.1 Ökonomische Transaktionen
- 2.2 Disruptive Innovationen
- 2.2.1 Geschäftsmodell
- 2.2.2 Innovation
- 2.2.3 Auswirkung der Innovationen auf Geschäftsmodelle
- 3 Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce
- 3.1 Entstehung des Geschäftsmodells Electronic Commerce
- 3.1.1 Internet als Motor für neue Geschäftsmodelle
- 3.1.2 Entwicklung des Electronic-Commerce in Deutschland
- 3.2 Electronic Payment als Geschäftsmodell
- 3.2.1 Kategorien von Electronic-Payment Systemen
- 3.2.2 Anforderungen an Zahlungssysteme
- 3.2.2.1 Gemeinsame Anforderungen
- 3.2.2.2 Anforderungen im Zielkonflikt
- 3.3 Populäre Zahlungssysteme im Electronic-Commerce
- 3.3.1 Klassische Zahlungssysteme
- 3.3.2 Electronic-Payment-Zahlungssysteme
- 3.3.3 Überblick
- 3.4 Aktuelle Trends im Zahlungsverkehr
- 3.1 Entstehung des Geschäftsmodells Electronic Commerce
- 4 Vorstellung des elektronischen Zahlungssystems paydirekt
- 4.1 Transaktionsprozess
- 4.2 Problematik bei der Einführung eines Zahlungsverfahrens
- 5 Empirische Untersuchung der Kundenanforderungen an E-Payment-Verfahren
- 5.1 Vorstellung des Fragebogens
- 5.2 Analyse der demographischen Daten der Umfrageteilnehmer
- 5.3 Auswertung der Umfrage
- 6 Nutzwertanalyse ausgewählter Zahlungsverfahren
- 6.1 Vorgehensweise und Bewertung der Methode
- 6.2 Durchführung der Analyse
- 6.2.1 Festlegung der Entscheidungsalternativen
- 6.2.2 Bestimmung der Zielkriterien
- 6.2.3 Gewichtung der Zielkriterien
- 6.2.4 Bestimmung des Teilnutzwertes
- 6.2.5 Ermittlung des Gesamtnutzwertes
- 6.2.6 Vorteilsbewertung der Alternativen
- 7 Resümee und Ausblick
- 7.1 Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen
- 7.2 Stärken und Schwächen von paydirekt
- 7.3 Handlungsempfehlung zur Etablierung des Dienstes
- 8 Disruptives Potential von E-Payment-Verfahren
- 8.1 Fazit
- 8.2 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit bewertet die Marktfähigkeit des Online-Bezahlverfahrens paydirekt. Ziel ist die Analyse von Kundenanforderungen und die Nutzwertanalyse verschiedener Zahlungssysteme, um die Stärken und Schwächen von paydirekt im Vergleich herauszustellen. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Etablierung von paydirekt im Kontext von Netzwerkeffekten.
- Analyse der Kundenanforderungen an Zahlungssysteme
- Vergleichende Nutzwertanalyse verschiedener Zahlungssysteme
- Bewertung des Marktpotentials von paydirekt
- Herausforderungen der Einführung neuer Zahlungssysteme
- Handlungsempfehlungen zur Stärkung von paydirekt
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Chancen von paydirekt auf dem Markt der elektronischen Zahlungssysteme zu bewerten. Die Vorgehensweise wird skizziert, die eine Analyse der Kundenanforderungen, eine Nutzwertanalyse ausgewählter Verfahren und die Ableitung von Handlungsempfehlungen umfasst. Die Bedeutung der Untersuchung im Kontext des wachsenden Online-Handels und des Wettbewerbs im Bereich der E-Payment-Systeme wird hervorgehoben.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden ökonomische Transaktionen und disruptive Innovationen im Allgemeinen, sowie deren Auswirkung auf Geschäftsmodelle erläutert. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce und Electronic Payment als Geschäftsmodell, inklusive der Kategorisierung verschiedener Systeme. Das Kapitel dient der Einordnung von paydirekt in den bestehenden Markt und liefert das notwendige theoretische Rüstzeug für die folgenden Kapitel.
3 Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce, insbesondere in Deutschland. Es analysiert das Geschäftsmodell Electronic Payment und kategorisiert verschiedene E-Payment-Systeme. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschreibung der Anforderungen an Zahlungssysteme, sowohl gemeinsame als auch solche, die im Zielkonflikt stehen. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Markt und die relevanten Trends im Zahlungsverkehr, bevor im nächsten Kapitel paydirekt im Detail vorgestellt wird.
4 Vorstellung des elektronischen Zahlungssystems paydirekt: Dieses Kapitel präsentiert das elektronische Zahlungssystem paydirekt. Der Transaktionsprozess wird detailliert beschrieben und die Herausforderungen bei der Einführung eines neuen Zahlungsverfahrens werden beleuchtet. Der Abschnitt liefert die notwendigen Informationen über paydirekt, um die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und der Nutzwertanalyse in den folgenden Kapiteln einzuordnen und zu verstehen.
5 Empirische Untersuchung der Kundenanforderungen an E-Payment-Verfahren: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung präsentiert, die die Kundenanforderungen an E-Payment-Verfahren ermittelt. Die Methodik der Untersuchung (z.B. Fragebogen) wird erläutert, die demographischen Daten der Teilnehmer analysiert und die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet. Diese Daten bilden die Basis für die Nutzwertanalyse im folgenden Kapitel.
6 Nutzwertanalyse ausgewählter Zahlungsverfahren: Dieses Kapitel präsentiert eine Nutzwertanalyse ausgewählter Zahlungsverfahren, inklusive paydirekt. Die Vorgehensweise und die Bewertung der Methode werden detailliert beschrieben. Die Analyse umfasst die Festlegung der Entscheidungsalternativen, die Bestimmung und Gewichtung der Zielkriterien, die Bestimmung des Teilnutzwertes und die Ermittlung des Gesamtnutzwertes. Das Ergebnis dieser Analyse liefert wichtige Erkenntnisse über die relativen Stärken und Schwächen der verschiedenen Zahlungssysteme.
7 Resümee und Ausblick: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und leitet daraus Schlussfolgerungen ab. Die Stärken und Schwächen von paydirekt werden im Detail analysiert und Handlungsempfehlungen für die Etablierung des Dienstes werden formuliert. Dieser Abschnitt ist essentiell für die Beurteilung der Chancen und Herausforderungen von paydirekt.
Schlüsselwörter
paydirekt, E-Payment, Electronic Payment, Online-Bezahlverfahren, Nutzwertanalyse, Kundenanforderungen, Netzwerkeffekte, Online-Handel, Marktpotential, disruptive Innovationen, Zahlungsverkehr.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bewertung der Marktfähigkeit von paydirekt
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit bewertet die Marktfähigkeit des Online-Bezahlverfahrens paydirekt. Sie analysiert Kundenanforderungen, vergleicht verschiedene Zahlungssysteme mittels Nutzwertanalyse und untersucht die Herausforderungen bei der Etablierung von paydirekt im Kontext von Netzwerkeffekten.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Kundenanforderungen an Zahlungssysteme, vergleicht verschiedene Systeme mittels Nutzwertanalyse, bewertet das Marktpotential von paydirekt, untersucht die Herausforderungen bei der Einführung neuer Zahlungssysteme und formuliert Handlungsempfehlungen zur Stärkung von paydirekt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse von Kundenanforderungen an Zahlungssysteme, einer vergleichenden Nutzwertanalyse verschiedener Zahlungssysteme, der Bewertung des Marktpotentials von paydirekt, den Herausforderungen der Einführung neuer Zahlungssysteme und Handlungsempfehlungen zur Stärkung von paydirekt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Grundlagen (ökonomische Transaktionen, disruptive Innovationen), Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce, Vorstellung von paydirekt, empirische Untersuchung der Kundenanforderungen, Nutzwertanalyse ausgewählter Zahlungsverfahren, Resümee und Ausblick, sowie ein Kapitel zum disruptiven Potential von E-Payment-Verfahren.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit, die Vorgehensweise (Analyse der Kundenanforderungen, Nutzwertanalyse, Handlungsempfehlungen) und hebt die Bedeutung der Untersuchung im Kontext des wachsenden Online-Handels und des Wettbewerbs im Bereich der E-Payment-Systeme hervor.
Welche Grundlagen werden im zweiten Kapitel behandelt?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen: ökonomische Transaktionen, disruptive Innovationen und deren Auswirkung auf Geschäftsmodelle, Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce und Electronic Payment, inklusive der Kategorisierung verschiedener Systeme.
Was wird im Kapitel zur Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce behandelt?
Kapitel 3 analysiert die Entstehung und Entwicklung des Electronic Commerce, insbesondere in Deutschland, das Geschäftsmodell Electronic Payment, kategorisiert verschiedene E-Payment-Systeme und beschreibt die Anforderungen an Zahlungssysteme (gemeinsame und solche im Zielkonflikt).
Wie wird paydirekt in der Arbeit vorgestellt?
Kapitel 4 präsentiert das Zahlungssystem paydirekt, beschreibt detailliert den Transaktionsprozess und beleuchtet die Herausforderungen bei der Einführung eines neuen Zahlungsverfahrens.
Wie werden die Kundenanforderungen untersucht?
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu Kundenanforderungen an E-Payment-Verfahren. Es erläutert die Methodik (z.B. Fragebogen), analysiert demographische Daten und wertet die Umfrageergebnisse aus.
Wie funktioniert die Nutzwertanalyse?
Kapitel 6 führt eine Nutzwertanalyse ausgewählter Zahlungsverfahren (inklusive paydirekt) durch. Es beschreibt die Vorgehensweise, die Festlegung der Entscheidungsalternativen, die Bestimmung und Gewichtung der Zielkriterien, die Bestimmung des Teilnutzwertes und die Ermittlung des Gesamtnutzwertes.
Was enthält das Resümee und der Ausblick?
Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen, leitet Schlussfolgerungen ab, analysiert Stärken und Schwächen von paydirekt und formuliert Handlungsempfehlungen zur Etablierung des Dienstes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
paydirekt, E-Payment, Electronic Payment, Online-Bezahlverfahren, Nutzwertanalyse, Kundenanforderungen, Netzwerkeffekte, Online-Handel, Marktpotential, disruptive Innovationen, Zahlungsverkehr.
- Quote paper
- Nico Brockmann (Author), 2017, Einführung und Chancen des E-Payment-Dienstes Paydirekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366100