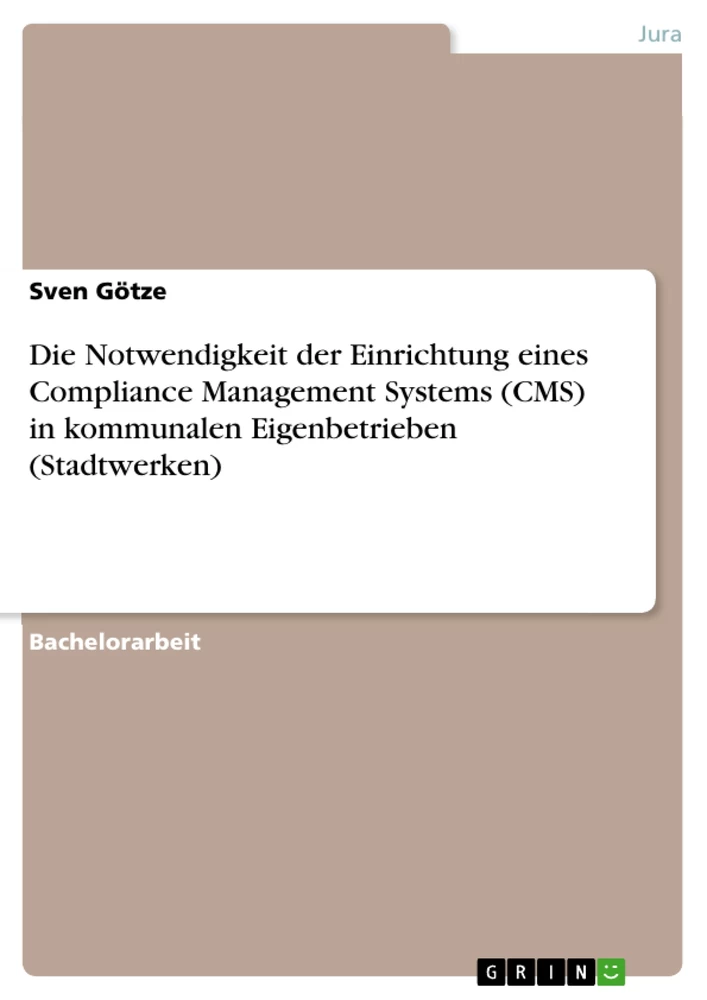Regeln werden aufgestellt, damit Gesellschaften funktionieren und Unternehmen in einem lauteren Wettbewerb stehen können. Das diese folglich eingehalten werden müssen, dürfte selbstverständlich sein. Im Wirtschaftsleben hat sich hierzu der Begriff Compliance herausgebildet, welcher wörtlich übersetzt zu-nächst nichts anderes bedeutet, als Regeln zu befolgen. Seit den 1990er Jahren findet dieser Terminus sukzessiven Niederschlag im deutschen Sprachgebrauch, Unternehmen entwickeln seither entsprechende Strukturen. Die Verwendung der Begrifflichkeit hat verschiedene Ursachen: Einerseits trägt die fortschreitende Globalisierung kontinuierlich zur Anglisierung unserer Sprache bei, andererseits werden in den stark reglementierten Sektoren das Bank- und Versicherungswesens sämtliche Maßnahmen der Gesetzestreue unter Compliance subsumiert.
Um alle Regeln zu befolgen, bedarf es vor allem für Unternehmen einer Systematik, um dies sicherzustellen. Diesen Gedanken verfolgt ein Compliance Management System (CMS), indem es Prozesse und Auslöser für Maßnahmen definiert. Schließlich können nur die Regeln eingehalten werden, welche bekannt sind. Die stete Wandlung der Regulierung im Wirtschaftsleben und der Ansprüche von Stakeholdern sowie Aufsichtsgremien machen es erforderlich, auf Veränderungen kurzfristig reagieren zu können. Durch ein CMS soll Regelverstößen („Non-Compliance“) vorgebeugt werden und, soweit dies nicht erfolgreich ist, diese erkannt und bearbeitet werden. Der Umfang der Regeln bestimmt sich nach gesetzlichen und sonstigen Vorgaben, die ein Unternehmen zu erfüllen hat und stellen somit das für die Organisation geltende Recht dar.
Vor allem kommunalen Unternehmen, welche sich aufgrund ihres Geschäftszwecks nicht ausschließlich im freien Wettbewerb betätigen (können), muss viel an der Reputation gelegen sein. In den Geschäftsfeldern der Daseinsvorsorge haben die Unternehmen eine besondere Verantwortung inne, welche sich in einem gesteigerten Vertrauen seitens der Öffentlichkeit äußert.
Dennoch mangelt es in öffentlichen Unternehmen oftmals an einem allgemeinen Bewusstsein für die Thematik Compliance. Teilweise wird sie als „Modethema“ abgewertet oder es herrscht ein hohes Maß an Unsicherheit vor, wie mit dieser umzugehen ist. Diese problematische Situation spiegelt sich auch im privaten Sektor wider. So hatten einer Studie zufolge im Jahr 2013 nur ca. 74% der befragten Unternehmen Compliance-Programme etabliert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- A Einleitung
- B Hintergrund und Abgrenzung von Compliance
- Ursprung und Entwicklung in Deutschland
- II Compliance Management System
- III Zwischenfazit 1: Zielstellung
- C Die Notwendigkeit von Compliance in kommunalen Stadtwerken
- Kommunalwirtschaft
- Daseinsvorsorge als zentraler Gegenstand
- Rechtsgrundlagen
- Eigenbetriebe als Form der kommunalwirtschaftlichen Betätigung
- Zweck
- Betriebsführung
- Organe
- Verwaltung und Personalwirtschaft
- Kontrolle
- Stadtwerke
- Pflicht zur Einführung von Compliance-Systemen
- Rechtspflichten
- Ordnungswidrigkeitsrecht
- Kommunalrecht
- Wettbewerbsrecht
- Gesellschaftsrecht
- Analogie aus weiteren Rechtsgebieten
- Gesetzesentwürfe
- Verbandsstrafgesetzbuch
- Änderungsvorschlag zum OWIG des BUJ
- Compliance-Anreiz-Gesetz
- Rechtsprechung
- Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) AÖR
- Siemens AG
- Interne Richtlinien
- Betriebswirtschaftliche Aspekte
- Folgen von Non-Compliance im kommunalen Bereich
- Kommunale Wasserwerke Leipzig
- Messehallen Köln
- Zwischenfazit: Einführungspflicht
- III Compliance-Anforderungen kommunaler Stadtwerke
- Wettbewerbsrecht
- Kartellrecht
- Lauterkeitsrecht
- EU-Beihilfenrecht
- Vergaberecht
- Preisrecht
- Steuerrecht
- Arbeitsrecht
- Arbeitssicherheits/-schutzrecht
- Datenschutzrecht
- Umweltrecht
- IT-Recht
- Lizenzmanagement
- Elektronische Buchführung
- Telekommunikationsanlagen
- IT-Sicherheitsgesetz
- Strafrecht
- Korruption
- Amtsstraftaten
- Zwischenfazit
- Wettbewerbsrecht
- IV Ausgestaltung und Nutzen eines Compliance-Systems
- Verantwortlichkeit für Compliance
- Anwendbarkeit etablierter Standards
- TR CMS 101:2011 (TÜV Rheinland)
- Allgemeine Anforderungen
- Leitungsverantwortung
- Ressourcenmanagement
- Compliance-Prozesse
- Systemüberwachung
- Wertung
- IDW PS 980 (Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.)
- Compliance-Kultur
- Compliance-Ziele
- Compliance-Risiken
- Compliance-Programm
- Compliance-Organisation
- Compliance-Kommunikation
- Compliance-Überwachung und Verbesserung
- Wertung
- Hamburger Compliance-Modell
- Auditierungsverfahren
- Grundmodul 1: Allgemeines Compliance-Verständnis
- Zusatzmodul: Vergabeverfahren
- Wertung
- EN ISO 19600:2014
- TR CMS 101:2011 (TÜV Rheinland)
- Empfehlung für kommunale Eigenbetriebe/Stadtwerke
- D Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Notwendigkeit der Einrichtung eines Compliance Management Systems (CMS) in kommunalen Eigenbetrieben, insbesondere in Stadtwerken. Die Arbeit untersucht die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Gründe, die für die Einführung eines solchen Systems sprechen. Dabei werden die spezifischen Herausforderungen und Compliance-Anforderungen im Kontext der kommunalen Daseinsvorsorge beleuchtet.
- Rechtliche Grundlagen und Pflichten im Bereich von Compliance in kommunalen Eigenbetrieben
- Analyse der Compliance-Risiken in Stadtwerken, insbesondere im Kontext von Wettbewerbsrecht, Vergaberecht, Datenschutz und IT-Recht
- Bewertung verschiedener Compliance-Standards und deren Anwendbarkeit auf kommunale Eigenbetriebe
- Entwicklung von Empfehlungen für die Ausgestaltung eines effektiven CMS in Stadtwerken
- Bewertung der Vorteile und des Nutzens eines implementierten CMS für kommunale Eigenbetriebe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung der Arbeit darlegt. Im zweiten Kapitel wird der Hintergrund und die Abgrenzung von Compliance beleuchtet, wobei insbesondere der Ursprung und die Entwicklung von Compliance in Deutschland im Fokus stehen. Das dritte Kapitel widmet sich der Notwendigkeit von Compliance in kommunalen Stadtwerken. Hier werden die Rechtsgrundlagen, die spezifischen Anforderungen an Eigenbetriebe sowie die Pflicht zur Einführung von Compliance-Systemen beleuchtet. Es werden verschiedene Rechtsgebiete wie das Ordnungswidrigkeitsrecht, das Kommunalrecht, das Wettbewerbsrecht, das Gesellschaftsrecht und das Strafrecht analysiert. Das vierte Kapitel beleuchtet die Ausgestaltung und den Nutzen eines Compliance-Systems. Es werden verschiedene etablierte Standards wie der TR CMS 101:2011, der IDW PS 980, das Hamburger Compliance-Modell und die EN ISO 19600:2014 vorgestellt und bewertet. Abschließend werden Empfehlungen für die Implementierung eines effektiven CMS in kommunalen Eigenbetrieben/Stadtwerken gegeben.
Schlüsselwörter
Compliance Management System, kommunale Eigenbetriebe, Stadtwerke, Daseinsvorsorge, Rechtspflichten, Wettbewerbsrecht, Vergaberecht, Datenschutz, IT-Recht, Strafrecht, Korruption, TR CMS 101:2011, IDW PS 980, Hamburger Compliance-Modell, EN ISO 19600:2014.
- Kommunalwirtschaft
- Citation du texte
- Sven Götze (Auteur), 2016, Die Notwendigkeit der Einrichtung eines Compliance Management Systems (CMS) in kommunalen Eigenbetrieben (Stadtwerken), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367223