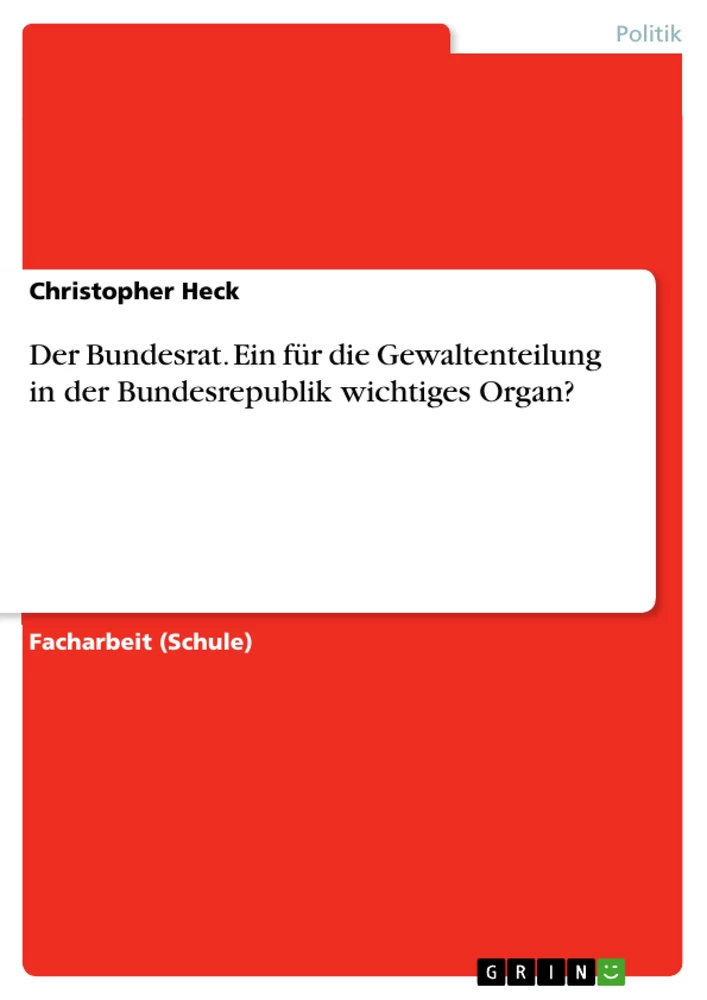Bei dieser Facharbeit handelt es sich um eine Semesterarbeit aus dem Fach Politikwissenschaften. Sie beschäftigt sich mit der Frage ob der Bundesrat ein für die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik wichtiges Organ ist. Dabei wird auf die Zusammensetzung des Bundesrates eingegangen und auf dessen Kompetenzen. Des weiteren wird ein Interview vom ehemaligem Bundesratspräsidenten Jens Böhrnsen's, in welchem er ebenfalls Stellung zur genannten Leitfrage nimmt, analysiert und hinsichtlich der Tragfähigkeit seiner Argumente untersucht. Schlussendlich wird ein begründetes Urteil zur Leitfrage gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Beschreiben Sie, wie sich die Mitglieder des Bundesrates zusammensetzen und erläutern Sie die Kompetenzen des Bundesrat als Verfassungsorgan.
- Erarbeiten Sie die Position Böhrnsens und untersuchen Sie anschließend die Art und Weise, wie Böhrnsen seine Position zur Leitfrage darlegt. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die angebliche Gefahr der Blockierung des Bundesrates und beurteilen Sie abschließend die Tragfähigkeit der Argumentation.
- Setzen Sie sich mit dem in der Leitfrage formulierten Problem auseinander und erarbeiten Sie zu diesem ein begründetes Urteil, berücksichtigen sie Böhrnsens Argumentation.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Textes besteht darin, die Rolle des Bundesrates in der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen und seine Bedeutung für die Gewaltenteilung zu beleuchten. Der Text analysiert die Zusammensetzung des Bundesrates, seine Kompetenzen und seine Funktionsweise, insbesondere im Kontext der vielfältigen Koalitionen in den Landesregierungen. Dabei wird die Gefahr der Blockierung des Bundesrates als zentrales Thema behandelt.
- Zusammensetzung und Kompetenzen des Bundesrates
- Die Gefahr der Blockierung des Bundesrates durch parteipolitische Interessen
- Die Bedeutung des Bundesrates für die Gewaltenteilung und die Interessenvertretung der Länder
- Kritik an Böhrnsens Argumentation zur Blockierung
- Bewertung des Bundesrates als Organ der Gewaltenteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Beschreiben Sie, wie sich die Mitglieder des Bundesrates zusammensetzen und erläutern Sie die Kompetenzen des Bundesrat als Verfassungsorgan.
Das Kapitel beschreibt die Zusammensetzung des Bundesrates, der aus Vertretern aller deutschen Bundesländer besteht. Die Anzahl der Vertreter jedes Landes richtet sich nach seiner Bevölkerungsgröße. Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Legislative, der direkt Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes hat. Seine Kompetenzen liegen in der Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung von Gesetzesvorlagen, die vom Bundestag initiiert werden. Der Bundesrat hat auch ein Initiativrecht für Gesetze, das ihm ermöglicht, Gesetzesvorlagen der Bundesregierung und dem Bundestag vorzulegen.
Erarbeiten Sie die Position Böhrnsens und untersuchen Sie anschließend die Art und Weise, wie Böhrnsen seine Position zur Leitfrage darlegt. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die angebliche Gefahr der Blockierung des Bundesrates und beurteilen Sie abschließend die Tragfähigkeit der Argumentation.
Dieses Kapitel untersucht die Position von Jens Böhrnsen, ehemaliger Präsident des Bundesrates, zur Gefahr der Blockierung des Bundesrates. Böhrnsen argumentiert, dass der Bundesrat aufgrund der vielfältigen Koalitionen in den Landesregierungen nie ruhig sein wird, da es immer Themen geben wird, die zu Diskussionen führen und eine Problemlösung erfordern. Er betont die Bedeutung der Landesinteressen und hält eine Blockade des Bundesrates für unwahrscheinlich. Der Text analysiert die Tragfähigkeit dieser Argumentation und zeigt Schwächen in Böhrnsens Argumentation auf.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Bundesrat, Gewaltenteilung, Landesinteressen, Blockade, Koalitionen, Parteipolitik, Legislative, Verfassungsorgan, Initiativrecht, Zustimmungsgesetze, Einspruchsgesetze, vertikale Gewaltenteilung, Jens Böhrnsen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Aufgabe hat der Bundesrat?
Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan, durch das die Bundesländer bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der EU mitwirken.
Wie setzen sich die Mitglieder des Bundesrates zusammen?
Er besteht aus Mitgliedern der Landesregierungen. Die Stimmenanzahl pro Land richtet sich nach der Einwohnerzahl (3 bis 6 Stimmen).
Was versteht man unter der „vertikalen Gewaltenteilung“?
Damit ist die Aufteilung der Staatsgewalt zwischen dem Bund und den einzelnen Gliedstaaten (Bundesländer) gemeint, wobei der Bundesrat das Bindeglied darstellt.
Besteht die Gefahr einer Blockade durch den Bundesrat?
Wenn im Bundesrat andere Mehrheitsverhältnisse herrschen als im Bundestag, kann es bei zustimmungsbedürftigen Gesetzen zu Verzögerungen oder Blockaden kommen, was oft politisch kritisiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen?
Zustimmungsgesetze können ohne den Bundesrat nicht zustande kommen. Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat zwar Veto einlegen, dieses kann aber vom Bundestag überstimmt werden.
- Citar trabajo
- Christopher Heck (Autor), 2016, Der Bundesrat. Ein für die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik wichtiges Organ?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367945