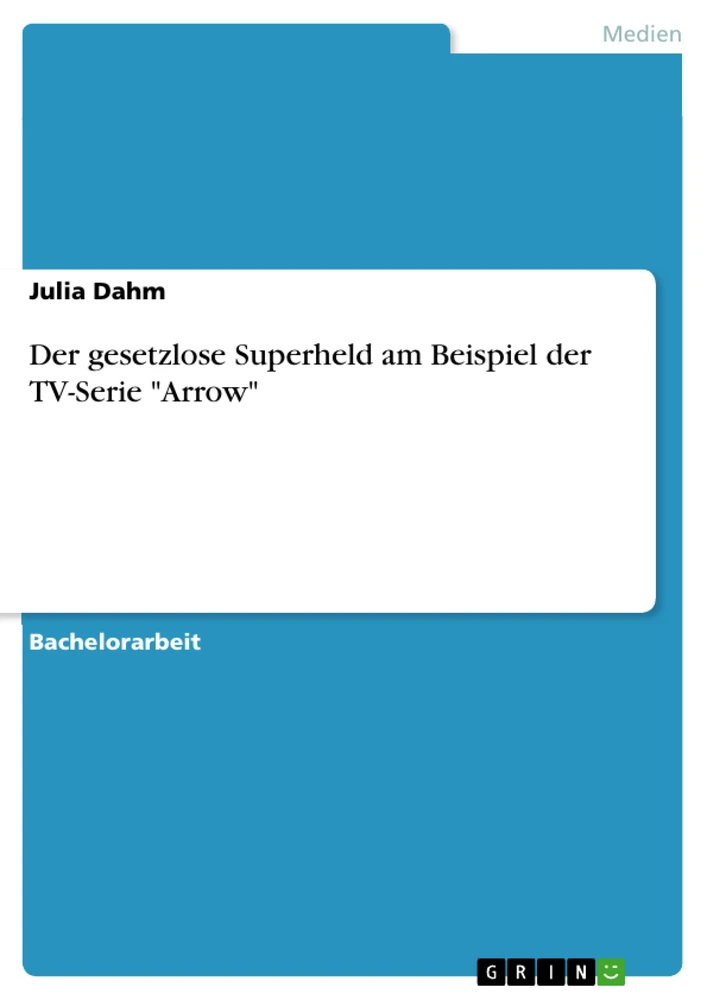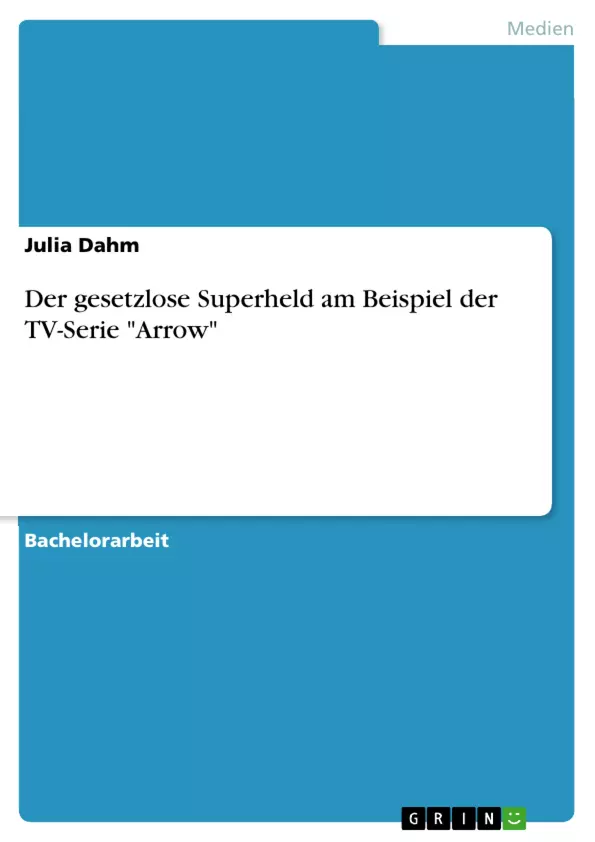Diese Arbeit thematisiert die Entwicklung des Charakters Oliver Queen über die ersten drei Staffeln der TV-Serie 'Arrow' hinweg. Dabei liegt der Fokus auf dem Heldenbild, welches durch Oliver und sein Alter Ego Arrow vermittelt wird und auf welche Vorbilder der letzten Jahrhunderte sich dieses stützt. Zusätzlich soll das Verhältnis zwischen dem Superhelden und der Gesellschaft, mit der er interagiert, dargestellt und analysiert werden. Dabei wird es vor allem wichtig sein, die Motivation des Helden zu untersuchen.
Außerdem soll die Arbeit thematisieren, welche typischen Eigenschaften eines Superhelden Arrow in sich vereint und wie diese mit dem Bild des Gesetzlosen korrespondieren. Bedeutend dafür ist der Ursprung seines Superheldendaseins, also seine origin story. Nicht relevant auf Grund des kurzen Rahmes dieser Arbeit wird ein Vergleich zwischen der Handlung des Comics, auf dem die Serie basiert, sein. Zudem werden nur Heldenvorbilder angesprochen, die für die spätere Analyse relevant sind, obwohl dem Superhelden generell noch ältere und antike Helden zu Grunde liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Helden und Heldengeschichten
- Die Vorgänger der Superhelden
- Der gesetzlose Held
- Outlaws und Vigilanten
- Das Superheldengenre
- Superhelden-Comics: Entstehung eines Genres
- Klassifizierung
- Die Serienfigur Arrow
- Die Pilotfolge
- Der gesetzlose „Kapuzenmann“
- Der heldenhafte „Arrow“
- Identitätskrise: „gebrochener Arrow“
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Charakters Oliver Queen über die ersten drei Staffeln der TV-Serie Arrow. Der Fokus liegt dabei auf dem Heldenbild, welches durch Oliver und sein Alter Ego Arrow vermittelt wird und auf welche Vorbilder der letzten Jahrhunderte sich dieses stützt. Zusätzlich soll das Verhältnis zwischen dem Superhelden und der Gesellschaft, mit der er interagiert, dargestellt und analysiert werden.
- Die Entwicklung des Heldenbildes von Oliver Queen und Arrow
- Die Beziehung zwischen Oliver Queen/Arrow und der Gesellschaft von Starling City
- Die Motivation des Helden: Rache und Selbstlosigkeit
- Typische Eigenschaften des Superhelden Arrow
- Die Korrelation zwischen Arrows Gesetzlosigkeit und seiner Superheldenidentität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Helden und Heldengeschichten in der Popkultur, insbesondere im Kontext der Superhelden. Es stellt die Entstehung des Superhelden-Genres dar und beleuchtet die Vorläufer des modernen Superhelden.
Kapitel zwei untersucht die Vorgänger des Superhelden, insbesondere den "gesetzlosen" Helden. Dabei wird auf die historische Figur des Robin Hood eingegangen und die Bedeutung von Vorbildern für die Wirkung von Heldenfiguren aufgezeigt.
Kapitel drei widmet sich dem Superheldengenre, seinen Entstehungsgeschichten und seiner Klassifizierung.
In Kapitel vier wird die Serienfigur Arrow im Detail analysiert, beginnend mit der Pilotfolge und der Entwicklung seiner Superheldenidentität.
Schlüsselwörter
Superheld, Heldenbild, Gesetzlosigkeit, Vigilant, Robin Hood, Arrow, TV-Serie, Comic, Motivation, Gesellschaft, Identitätskrise, Rache, Selbstlosigkeit, Superheldengenre.
Häufig gestellte Fragen
Welches Heldenbild vermittelt die Serie „Arrow“?
Die Serie zeigt die Entwicklung von Oliver Queen vom rachsüchtigen Vigilanten zum selbstlosen Superhelden, der als Gesetzloser agiert.
Was ist die „Origin Story“ von Arrow?
Die Geschichte seiner Strandung auf einer einsamen Insel, die ihn physisch und psychisch transformierte und seine Mission begründete.
Welche historischen Vorbilder hat Arrow?
Die Figur stützt sich stark auf das Bild des gesetzlosen Helden, insbesondere auf das Vorbild von Robin Hood.
Was unterscheidet einen Vigilanten von einem klassischen Superhelden?
Ein Vigilant übt Selbstjustiz außerhalb des Gesetzes aus, oft getrieben durch Rache, während ein Superheld meist ein moralisches Ideal verkörpert.
Was ist die zentrale Motivation von Oliver Queen?
Anfangs die Sühne für die Sünden seines Vaters und Rache, später der Schutz der Gesellschaft von Starling City.
- Quote paper
- Julia Dahm (Author), 2017, Der gesetzlose Superheld am Beispiel der TV-Serie "Arrow", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368145