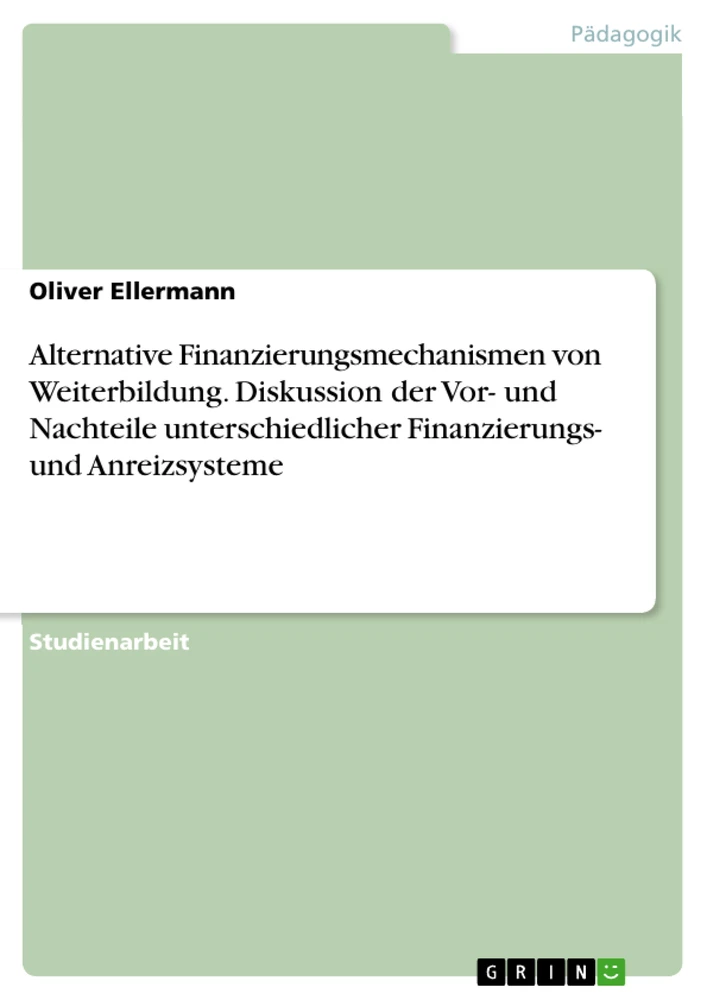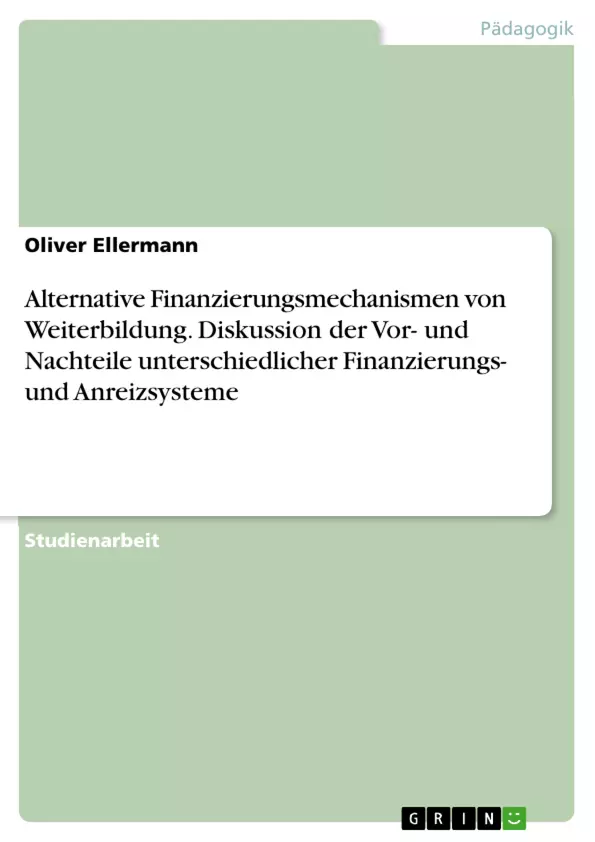Das benötige Wissen zur Bewältigung der Veränderungen in der Arbeits- und privaten Lebenswelt kann nicht allein in der ersten Ausbildungsphase erworben werden. Der bereits heute erhöhte Bedarf an Qualifikation und Kompetenzen verlangt das Einrichten eines Systems des Lebenslangen Lernens, basierend auf der Weiterbildung als Kernelement. Der Finanzierung der Weiterbildung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. „So führt die Weiterbildungsfinanzierung gleichsam die Anreize zusammen, die maßgeblich dafür sind, ob, in welchem Umfang und zu welcher Qualität ein gesellschaftlicher Akteur Weiterbildungsgelegenheiten anbietet, nachfragt und finanziert“.
Zur Steuerung von Weiterbildungsangeboten, zur Erhöhung der Weiterbildungsteilnahme und zur Optimierung von Weiterbildungserfolgen spielen finanzielle Überlegungen eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie innovative Programme und didaktische Konzepte.
Dabei ist die Weiterbildungsfinanzierung durch vier zentrale Segmente geprägt, denen die vielschichtigen Finanzierungsaktivitäten in Deutschland zugeordnet werden können: Staat (Bund, Länder und Kommunen), Bundesanstalt für Arbeit (BA), Individuen (d.h. die Nachfrager von Weiterbildungsmaßnahmen) und Betriebe. Obwohl das Weiterbildungsbudget in Deutschland faktisch unbekannt ist, kann zumindest festgehalten werden, dass eine Mischfinanzierung, bereitgestellt von diesen vier Finanziers, dominierend ist.
Die klassische Finanzierung von Bildung kann dabei angebots- oder nachfrageinduziert statt-finden, d.h. sie fördert die Bereitstellung oder die Inanspruchnahme von Weiterbildung (bzw. beides in Kombination). Öffentlich bildungsbedingte monetäre Transferzahlungen basieren auf den Elementen Kindergeld (Familienlasten- und Leistungsausgleich), Einzelgesetzen zur expliziten Bildungsförderung (z.B. BAföG, AFBG, BAB), SGB III (Finanzierung und Weiterbildung von Arbeitslosen) und der steuerlichen Abzugsfähigkeit individueller, bildungsbedingter Ausgaben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlegung
- 2.1 Lebenslanges Lernen und Weiterbildung
- 2.2 Finanzierung der Weiterbildung
- 2.3 Ziele der Weiterbildungsfinanzierung
- 3 Diskussion der Vor- und Nachteile alternativer Finanzierungsmechanismen: Abgleich der sieben Zielkriterien mit sechs Finanzierungsalternativen (FA mit Rückgriff auf monetäre Ressourcen)
- 3.1 Finanzierungsalternative „Individuelle Selbstfinanzierung“
- 3.1.1 Lebenslanges Lernen
- 3.1.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.1.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.1.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.1.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.1.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.1.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- 3.2 Finanzierungsalternative „Bildungskonten“
- 3.2.1 Lebenslanges Lernen
- 3.2.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.2.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.2.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.2.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.2.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.2.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- 3.3 Finanzierungsalternative „Einzelbetriebliche Finanzierung“
- 3.3.1 Lebenslanges Lernen
- 3.3.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.3.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.3.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.3.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.3.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.3.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- 3.4 Finanzierungsalternative „Bildungsfonds“
- 3.4.1 Lebenslanges Lernen
- 3.4.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.4.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.4.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.4.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.4.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.4.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- 3.5 Finanzierungsalternative „Staatliche Finanzierung“
- 3.5.1 Lebenslanges Lernen
- 3.5.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.5.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.5.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.5.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.5.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.5.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- 3.6 Finanzierungsalternative „Bildungsgutscheine“
- 3.6.1 Lebenslanges Lernen
- 3.6.2 Abbau von Benachteiligung
- 3.6.3 Wahlfreiheit bei Form und Inhalt
- 3.6.4 Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen
- 3.6.5 Unterstützung eines breiten Angebots
- 3.6.6 Erfüllung des Effizienzziels
- 3.6.7 Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung
- Lebenslanges Lernen und seine Finanzierung
- Alternative Finanzierungsmodelle (individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, betriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung, Bildungsgutscheine)
- Bewertung der Finanzierungsmodelle anhand von sieben Zielkriterien (Lebenslanges Lernen, Abbau von Benachteiligung, Wahlfreiheit, Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen, Unterstützung eines breiten Angebots, Effizienz, Verteilungsgerechtigkeit)
- Die Rolle des Staates in der Weiterbildungsfinanzierung
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht alternative Finanzierungsmechanismen für Weiterbildung in Deutschland. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungs- und Anreizsysteme zu diskutieren und zu bewerten.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die Notwendigkeit von lebenslangem Lernen und die zentrale Rolle der Weiterbildungsfinanzierung für die Gestaltung eines solchen Systems. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die verschiedenen Akteure (Staat, Betriebe, Individuen) und Finanzierungsformen in Deutschland. Die Arbeit kündigt die Analyse von sechs alternativen Finanzierungsmodellen an, die anhand von sieben definierten Zielkriterien bewertet werden.
2 Grundlegung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse. Es definiert den Begriff des lebenslangen Lernens und differenziert zwischen formalen, non-formalen und informellen Lernformen. Weiterhin wird der Finanzierungsbegriff umfassend erläutert, die Unterscheidung zwischen Angebots- und Nachfragefinanzierung dargestellt und die sieben Zielkriterien der Weiterbildungsfinanzierung (Lebenslanges Lernen, Abbau von Benachteiligung etc.) präzisiert.
3 Diskussion der Vor- und Nachteile alternativer Finanzierungsmechanismen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert sechs alternative Finanzierungsmodelle (individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, einzelbetriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung und Bildungsgutscheine) und bewertet sie im Detail anhand der zuvor definierten sieben Zielkriterien. Für jedes Modell werden die Vor- und Nachteile bezüglich der einzelnen Kriterien ausführlich diskutiert und mit Beispielen belegt.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Weiterbildungsfinanzierung, alternative Finanzierungsmechanismen, individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, betriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung, Bildungsgutscheine, Effizienz, Gerechtigkeit, Zielkriterien, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Alternative Finanzierungsmechanismen für Weiterbildung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert alternative Finanzierungsmechanismen für Weiterbildung in Deutschland. Es untersucht die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsmodelle und bewertet diese anhand von sieben definierten Zielkriterien.
Welche Finanzierungsmodelle werden untersucht?
Das Dokument untersucht sechs alternative Finanzierungsmodelle: individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, einzelbetriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung und Bildungsgutscheine.
Welche Zielkriterien werden zur Bewertung der Finanzierungsmodelle verwendet?
Die Bewertung der Finanzierungsmodelle erfolgt anhand von sieben Zielkriterien: Lebenslanges Lernen, Abbau von Benachteiligung, Wahlfreiheit bei Form und Inhalt der Weiterbildung, Gleichstellung von beruflichem und nichtberuflichem Lernen, Unterstützung eines breiten Angebots an Weiterbildungsmaßnahmen, Erfüllung des Effizienzziels und Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzlastverteilung.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält eine Einleitung, einen Abschnitt mit theoretischen Grundlagen zum lebenslangen Lernen und der Weiterbildungsfinanzierung, eine detaillierte Diskussion der sechs Finanzierungsmodelle mit Bewertung anhand der sieben Zielkriterien, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der einzelnen Finanzierungsmodelle?
Für jedes der sechs Finanzierungsmodelle (individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, einzelbetriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung und Bildungsgutscheine) wird eine detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile im Hinblick auf die sieben Zielkriterien (Lebenslanges Lernen, Abbau von Benachteiligung etc.) durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analysen sind im Kapitel 3 des Dokuments ausführlich dargestellt.
Welche Rolle spielt der Staat in der Weiterbildungsfinanzierung laut diesem Dokument?
Die Rolle des Staates in der Weiterbildungsfinanzierung wird im Dokument als ein wichtiger Aspekt der Diskussion betrachtet. Die staatliche Finanzierung ist eines der untersuchten Finanzierungsmodelle, und die Analyse betrachtet die Vor- und Nachteile staatlicher Interventionen in Bezug auf die sieben definierten Zielkriterien.
Was ist der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen?
Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Weiterbildungsfinanzierung wird im Dokument gegeben, jedoch im Detail nicht weiter ausgeführt.
Wo finde ich eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Finanzierungsmodelle und deren Bewertung?
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Finanzierungsmodelle und deren Bewertung anhand der sieben Zielkriterien findet sich in Kapitel 3 des Dokuments.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Dokuments wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Lebenslanges Lernen, Weiterbildungsfinanzierung, alternative Finanzierungsmechanismen, individuelle Selbstfinanzierung, Bildungskonten, betriebliche Finanzierung, Bildungsfonds, staatliche Finanzierung, Bildungsgutscheine, Effizienz, Gerechtigkeit, Zielkriterien, Deutschland.
- Citar trabajo
- Oliver Ellermann (Autor), 2016, Alternative Finanzierungsmechanismen von Weiterbildung. Diskussion der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Finanzierungs- und Anreizsysteme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369001