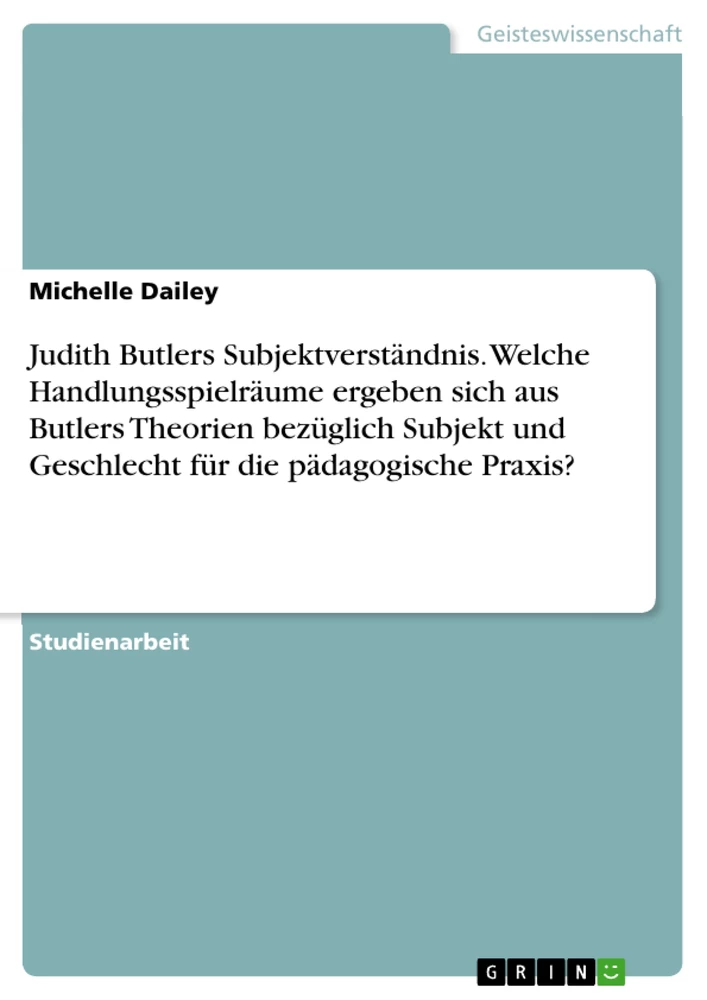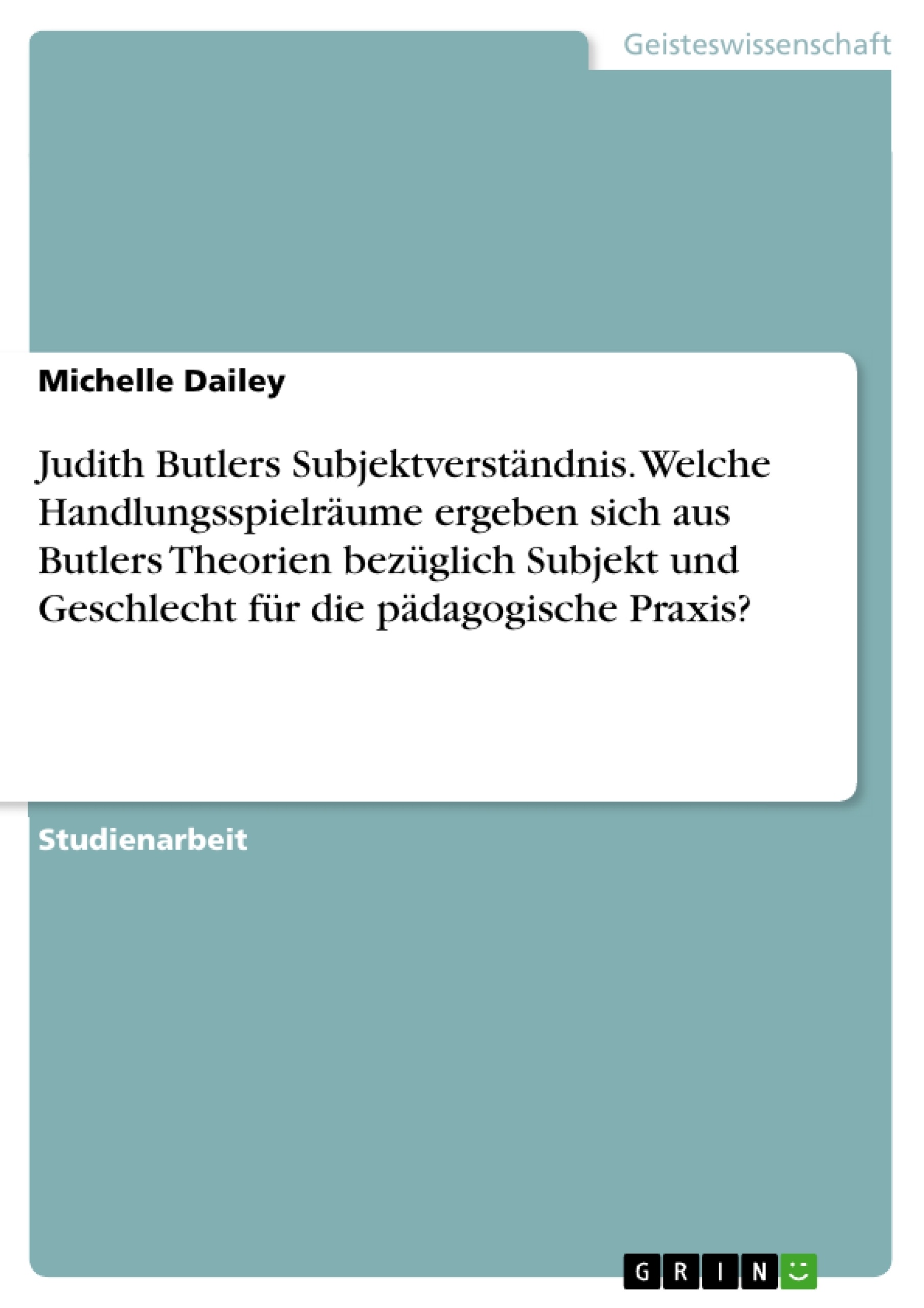Diese Hausarbeit setzt sich mit Judith Butlers Theorien aus erziehungswissenschaftlicher Sicht auseinander und zielt darauf ab, sie auf Handlungsspielräume für die Praxis zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, welches veränderte Subjektverständnis mit Butlers Theorien einhergeht und wie sich dieses auf erziehungswissenschaftliche Fragestellungen auswirkt.
Zu Beginn wird der feministische Diskurs des 20. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung der Frage nach der Analyse der Geschlechterkonstruktion, betrachtet, um Butlers Wirken theoretisch einordnen zu können und um einen theoretischen Bezugsrahmen zu ihren Überlegungen zu bieten, welche im darauf folgenden Kapitel näher beleuchtet werden. Hierfür wird nicht chronologisch vorgegangen, sondern thematisch-problemzentriert die verschiedenen Strömungen des feministischen Diskurses aufgegriffen, welche relevant in Bezug auf die Fragestellung dieser Hausarbeit sind.
Der folgende Abschnitt widmet sich Butlers Subjektverständnis, indem zunächst zentrale Begriffe und Gedanken erläutert werden und anschließend das Verhältnis sowie die Relevanz von Geschlecht und Subjektivierung(spraktiken) in ihren Theorien untersucht werden. Abschließend wird analysiert, in welchem Rahmen Subjekte laut Butler handlungsmächtig beziehungsweise -ohnmächtig sind. Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse in einen erziehungswissenschaftlichen Bezugsrahmen gesetzt und auf ihren Nutzen für die pädagogische Praxis untersucht. Im letzten Abschnitt werden konkrete Handlungsanweisungen für Pädagog*innen ausgearbeitet, welche sich aus den vorangegangenen Ausführungen ergeben. Zuletzt folgt ein Fazit, welches die Ergebnisse zusammenfasst und überblickartig darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Judith Butler
- Die Kategorie Geschlecht im Diskurs
- Überblick über relevante Richtungen der feministischen Debatte
- Pluralisierung von Gender
- Entnaturalisierung von Sex
- Butlers Subjektverständnis
- Diskursive Subjektkonstitution
- Geschlecht und Subjekt
- Handlungsmacht des Subjektes
- Zwischenfazit
- Folgerungen für die pädagogische Praxis
- Pädagogische Praxis als Bezugsrahmen
- Geschlecht und Subjekt in der Erziehungswissenschaft
- Handlungsanforderungen an Pädagog*innen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Judith Butlers Subjektverständnis und untersucht die Handlungsspielräume, die sich aus ihren Theorien bezüglich Subjekt und Geschlecht für die pädagogische Praxis ergeben.
- Die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Gesellschaft und die Notwendigkeit ihrer Dekonstruktion
- Die diskursive Konstruktion von Subjekt und Geschlecht nach Butler
- Die Relevanz von Butlers Theorien für die pädagogische Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Subjektbildung
- Die Analyse von Handlungsmöglichkeiten für Pädagog*innen, die sich aus Butlers Theorien ergeben
- Die Rolle der Sprache und des Diskurses in der Konstitution von Geschlecht und Subjekt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den erziehungswissenschaftlichen Kontext dar und erläutert die Relevanz von Butlers Theorien für die pädagogische Praxis. Sie zeigt auf, dass poststrukturalistische Theorien zwar bereits in der erziehungswissenschaftlichen Literatur rezipiert werden, ihre Anwendung in der Praxis aber bisher aussteht.
Kapitel 2.1 widmet sich der Kategorie Geschlecht im Diskurs. Hierbei wird ein Überblick über relevante Richtungen der feministischen Debatte gegeben, insbesondere die Entnaturalisierung von Geschlecht und die damit einhergehende Pluralisierung von Gender.
Kapitel 2.2 beleuchtet Butlers Subjektverständnis, indem zentrale Begriffe und Gedanken erläutert werden. Es wird das Verhältnis von Geschlecht und Subjektivierung in Butlers Theorien untersucht, sowie die Handlungsmächtigkeit bzw. -ohnmächtigkeit von Subjekten in Bezug auf die diskursive Konstruktion von Geschlecht.
Kapitel 3 setzt die Ergebnisse in einen erziehungswissenschaftlichen Bezugsrahmen und untersucht deren Nutzen für die pädagogische Praxis. Es werden konkrete Handlungsanweisungen für Pädagog*innen ausgearbeitet, die sich aus Butlers Theorien ergeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der vorliegenden Hausarbeit sind Judith Butler, Subjekt, Geschlecht, Diskurstheorie, performative Geschlechtskonstitution, Pädagogische Praxis, Handlungsspielräume, feministische Theorie, Dekonstruktion.
- Arbeit zitieren
- Michelle Dailey (Autor:in), 2017, Judith Butlers Subjektverständnis. Welche Handlungsspielräume ergeben sich aus Butlers Theorien bezüglich Subjekt und Geschlecht für die pädagogische Praxis?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369118