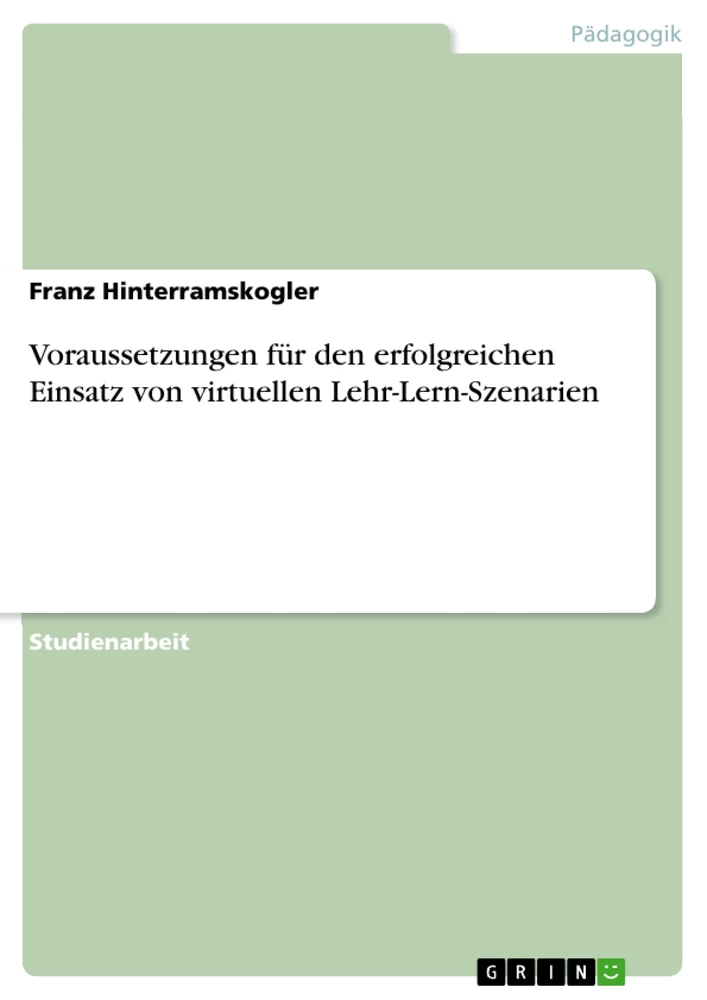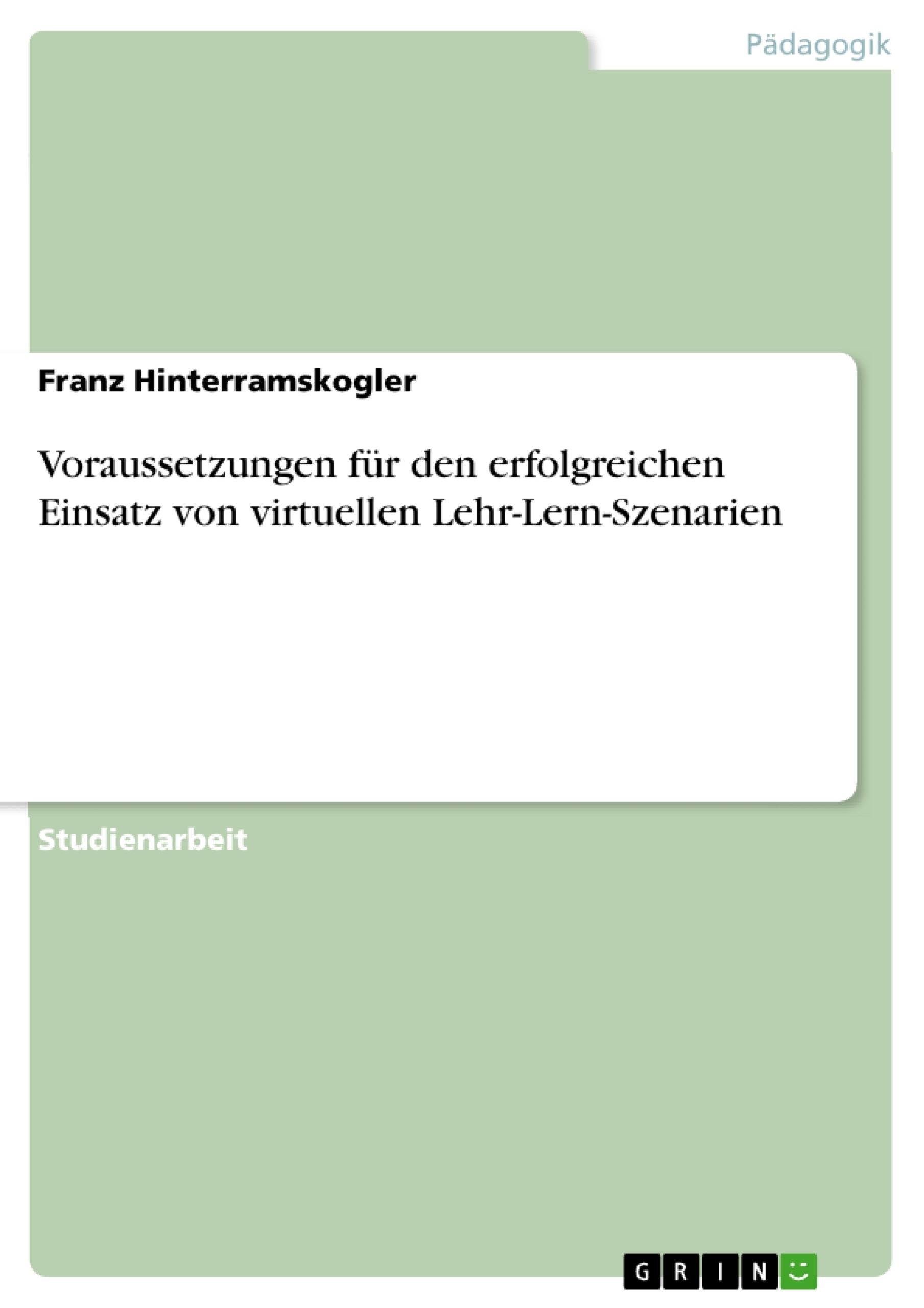Ziel dieser Hausarbeit ist es, anhand relevanter theoretischer Ansätze die notwendigen Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz eines virtuellen Lehr-Lern-Szenarios zu beschreiben.
„In fünf Jahren ist der Spuk vorüber“! So beschreibt Kerres (2004, S. 11) den Ausruf einiger seiner Kollegen zum Thema Multimedia in der Lehre und stellt gleichzeitig die Frage, ob dieser Spuk tatsächlich in fünf Jahren vorbei sein wird, da, wie „Fundamental-Kritiker“ immer schon wussten, Bildung und Medien sich nicht vertragen.
In der Zwischenzeit ist klar, dass dieser sogenannte Spuk noch nicht vorbei ist. Es ist in den letzten Jahren aber auch deutlich geworden, dass isolierte Medienprojekte nicht von alleine zu einer Erneuerung der Lehre führen. Vielmehr muss überlegt werden, welche Strategien notwendig sind, um die Potentiale der neuen Medien im Alltag dauerhaft wirksam werden zu lassen. Wenn man nach den Gründen für die Einführung neuer Medien in der Bildung fragt, erhält man beinahe immer die gleiche Antwort: Neue Medien erleichtern das Lehren und Lernen und führen zu besseren Lernergebnissen und das bei reduzierten Kosten gegenüber bisherigen Verfahren. Doch die Erwartungen wurden vielfach nicht erfüllt, trotz vieler E-Learning-Konzeptionen und Umsetzungen wurde noch keine wirkliche Lösung gefunden.
Da neue Lernmedien nicht immer die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen, ist immer öfter eine Kombination von traditionellen und neuen Medien festzustellen. Auch wenn die anfängliche Euphorie einer Ernüchterung gewichen ist, zahlt es sich aus, in E-Learning zu investieren. Durch schülerorientierten Unterricht kann die Motivation der Lernenden gesteigert werden, die Bereitschaft selbstgesteuert zu lernen wächst und der Horizont weitet sich, hin zum WWW, dem Welt-Weiten-Werden.
Effektives E-Learning kann dann stattfinden, wenn sich die Rolle der Lehrenden, der Lernenden und der Bildungsträger grundlegend ändert. Insgesamt ergeben sich durch den Einsatz neuer Medien große Chancen.
In einer Zeit, in der gesellschaftliche Veränderungen lebenslanges Lernen erfordern, nimmt die Bedeutung von problemorientiertem und eigenverantwortlichem Lernen ständig zu. Dazu wird es notwendig sein, die neuen Medien zur Gestaltung einer neuen zukunftsorientierten Lernkultur zu nutzen.
„Ohne kompetent mit Medien umgehen zu können, werden wir die Welt, in der wir leben, nicht mehr verstehen und in ihr handeln können“ (de Witt, 2005, S. 8).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung: E-Learning – Blended Learning
- Kommunikation und Kommunikationsmodelle
- Definition
- Kommunikationsmodelle
- Computervermittelte Kommunikation (cvK)
- Vorteile von computervermittelter Kommunikation
- Nachteile von computervermittelter Kommunikation
- Besonderheiten medienvermittelter Kommunikation
- Reichhaltigkeit und Passung
- Synchronizität
- Kosten und Nutzen
- Voraussetzungen für virtuelle Lehr-Lern-Szenarien
- Konzeption virtueller Lehr-Lern-Szenarien
- Beschreibung des Lernszenarios
- Vergleich von Theorie und Konzept
- Rahmenbedingungen für erfolgreichen Wissenstransfer
- Die Rolle des Lehrenden
- Die Lernenden
- Der Bildungsträger
- Lösungsansätze und Strategien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz virtueller Lehr-Lern-Szenarien. Sie analysiert die Begriffe E-Learning und Blended Learning und beleuchtet verschiedene Kommunikationsmodelle, um die Besonderheiten computervermittelter Kommunikation zu verstehen. Die Arbeit untersucht die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Wissenstransfer im Kontext virtuellen Lernens und beleuchtet die Rolle des Lehrenden, der Lernenden und des Bildungsträgers.
- Definition und Abgrenzung von E-Learning und Blended Learning
- Analyse von Kommunikationsmodellen und deren Bedeutung für den Lernprozess
- Besonderheiten computervermittelter Kommunikation und deren Einfluss auf die Wissensvermittlung
- Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von virtuellen Lehr-Lern-Szenarien
- Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Wissenstransfer in virtuellen Lernumgebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des E-Learning und Blended Learning ein und verdeutlicht die Bedeutung dieser Lernformen im 21. Jahrhundert. Das zweite Kapitel erläutert die Begriffe E-Learning und Blended Learning und zeigt die verschiedenen Definitionen und Ansätze auf. Kapitel drei beschäftigt sich mit Kommunikation und Kommunikationsmodellen und analysiert die verschiedenen wissenschaftlichen Erklärungsversuche für den Austausch von Botschaften zwischen Menschen. Das vierte Kapitel erläutert die Besonderheiten computervermittelter Kommunikation (cvK) und beleuchtet deren Vor- und Nachteile. Im fünften Kapitel werden die Besonderheiten medienvermittelter Kommunikation im Kontext des Lernens näher betrachtet. Das sechste Kapitel behandelt die Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von virtuellen Lehr-Lern-Szenarien und beschreibt die Konzeption, die Gestaltung und den Vergleich von Theorie und Konzept. Kapitel sieben widmet sich den Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Wissenstransfer und analysiert die Rolle des Lehrenden, der Lernenden und des Bildungsträgers.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: E-Learning, Blended Learning, virtuelle Lehr-Lern-Szenarien, Kommunikationsmodelle, computervermittelte Kommunikation, medienvermittelte Kommunikation, Wissenstransfer, Lehrende, Lernende, Bildungsträger.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen E-Learning und Blended Learning?
E-Learning bezeichnet das Lernen mit digitalen Medien, während Blended Learning eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und virtuellen Lernphasen darstellt.
Welche Vorteile bietet computervermittelte Kommunikation (cvK)?
Zu den Vorteilen zählen zeitliche und örtliche Flexibilität, die Möglichkeit zur asynchronen Kommunikation und der einfache Zugriff auf weltweite Informationsressourcen.
Welche Rolle spielt der Lehrende in virtuellen Lernszenarien?
Die Rolle wandelt sich vom reinen Wissensvermittler hin zum Lernbegleiter oder Coach, der den Lernprozess moderiert und die Selbststeuerung der Lernenden unterstützt.
Warum erfüllen E-Learning-Projekte oft nicht die Erwartungen?
Oft scheitern isolierte Projekte an mangelnden Strategien zur dauerhaften Integration in den Alltag oder an einer rein technologischen statt didaktischen Ausrichtung.
Was sind Voraussetzungen für erfolgreichen Wissenstransfer im Netz?
Notwendig sind eine hohe Medienkompetenz aller Beteiligten, eine klare didaktische Konzeption sowie die Bereitschaft der Bildungsträger zur Veränderung der Lernkultur.
Was bedeutet Synchronizität im Kontext medienvermittelter Kommunikation?
Synchronizität bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit des Austauschs (z.B. Chat vs. E-Mail) und beeinflusst die Reichhaltigkeit und Effizienz der pädagogischen Kommunikation.
- Quote paper
- Franz Hinterramskogler (Author), 2013, Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von virtuellen Lehr-Lern-Szenarien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371948