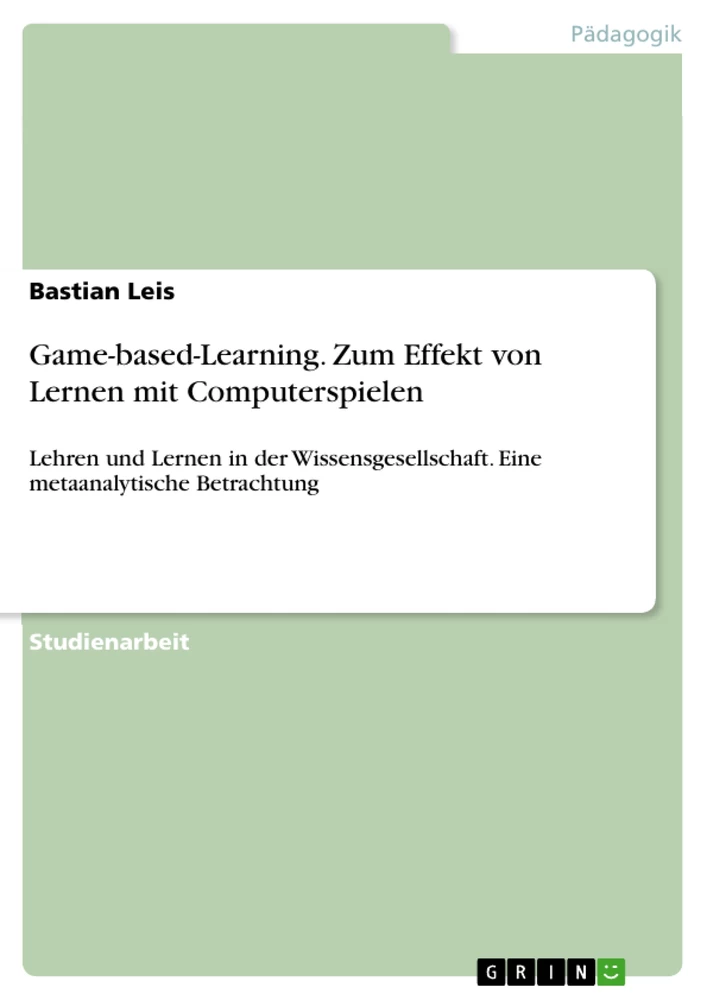In dieser Metaanalyse wird der Frage auf den Grund gegangen, welche Auswirkungen die Nutzung von Computerspielen als Medium in Lernprozessen hat. Bisherige Metaanalysen weisen diesbezüglich neutrale bis positive Effekte auf, beziehen sich aber größtenteils auf veraltete Primärstudien. Die Aktualität der Primärstudien ist jedoch ein besonders schwer ins Gewicht fallender Aspekt hinsichtlich Validität der Forschungsergebnisse, da sich die Computerspielbranche und ihre Technologie stets in einer besonders rasant fortschreitenden Entwicklungsphase befindet. Aufgrund dessen wurde bei der Auswahl der Primärstudien dieser Metaanalyse darauf geachtet, dass diese so aktuell wie nur möglich sind. Die Ergebnisse dieser Metaanalyse basieren auf sieben quantitativen Primärstudien aus den Jahren 2005 und 2006. Ziel ist es, dadurch einen möglichst aktuellen Stand der Forschung darzustellen. Die Datenanalyse dieser Forschungsarbeit weist durchweg positive Effekte durch die Nutzung von Computerspielen in Lernprozessen auf, wie beispielsweise bessere Lernergebnisse, eine erhöhte Behaltensleistung und eine deutliche Steigerung der Motivation. Negative Aspekte hingegen äußern sich verschwindend gering und sind, bis auf einen größeren Aufwand und erhöhte Kosten, auf minderwertige Qualität der Computerspiele zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Forschungsfrage
- Forschungsvariablen
- Operationalisierung der Forschungsvariablen
- Hypothesenbildung
- Informationsquellen
- Schlüsselwörter
- Vorgehensweise bei der Literaturrecherche
- Inklusions- und Exklusionskriterien
- Merkmale und Ergebnisse der Primärstudien
- Einflussgröße der Studienmerkmale und -ergebnisse im Vergleich
- Bewertung der Ergebnisse
- Pro-Contra-Gegenüberstellung von Aspekten der Computerspielnutzung in Lernprozessen
- Gegenüberstellung der Befundlage
- Empfehlungen für zukünftige Studien
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Metaanalyse befasst sich mit dem Effekt der Nutzung von Computerspielen in Lernprozessen. Sie analysiert aktuelle Primärstudien, um einen aktuellen Stand der Forschung darzustellen und den Einfluss von Computerspielen auf Lernergebnisse, Behaltensleistung und Motivation zu untersuchen. Das Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Effekte von Computerspielen im Lernkontext zu gewinnen und die Bedeutung der digitalen Medien im Bildungsbereich zu beleuchten.
- Der Effekt von Computerspielen auf Lernergebnisse und Behaltensleistung
- Die Rolle von Computerspielen in der Steigerung der Motivation im Lernprozess
- Die Bedeutung der Aktualität der Primärstudien im Kontext der rasanten Entwicklung der Computerspielbranche
- Die Gegenüberstellung von positiven und negativen Aspekten der Computerspielnutzung im Lernkontext
- Empfehlungen für zukünftige Studien im Bereich von Game-based-Learning
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Computerspielen in der heutigen Wissensgesellschaft dar und beleuchtet den Einfluss der Digitalisierung auf den Bildungsbereich. Sie führt die Thematik der Computerspielnutzung im Lernkontext ein und beschreibt die Notwendigkeit der Aktualisierung des Forschungsstands in diesem Bereich.
- Forschungsfrage: Die Forschungsfrage wird in diesem Kapitel präzise formuliert und beschreibt den Fokus der Metaanalyse.
- Forschungsvariablen: Hier werden die wichtigsten Variablen der Metaanalyse vorgestellt, die für die Untersuchung des Effekts von Computerspielen im Lernprozess relevant sind.
- Operationalisierung der Forschungsvariablen: Die Operationalisierung der Forschungsvariablen beschreibt, wie die Variablen in der Metaanalyse gemessen und quantifiziert werden.
- Hypothesenbildung: In diesem Kapitel werden die Hypothesen aufgestellt, die im Rahmen der Metaanalyse untersucht werden.
- Informationsquellen: Hier werden die Quellen und Methoden der Literaturrecherche beschrieben, die für die Metaanalyse genutzt wurden.
- Schlüsselwörter: Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Metaanalyse werden vorgestellt.
- Vorgehensweise bei der Literaturrecherche: Die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche wird detailliert erläutert.
- Inklusions- und Exklusionskriterien: Die Inklusions- und Exklusionskriterien für die Auswahl der Primärstudien werden dargestellt.
- Merkmale und Ergebnisse der Primärstudien: Die Merkmale und Ergebnisse der Primärstudien, die in die Metaanalyse aufgenommen wurden, werden in diesem Kapitel zusammengefasst.
- Einflussgröße der Studienmerkmale und -ergebnisse im Vergleich: Die Einflussgröße der Studienmerkmale und -ergebnisse auf die Effektstärke der Computerspielnutzung im Lernprozess wird in diesem Kapitel analysiert.
- Bewertung der Ergebnisse: Die Ergebnisse der Metaanalyse werden bewertet und interpretiert.
- Pro-Contra-Gegenüberstellung von Aspekten der Computerspielnutzung in Lernprozessen: Die positiven und negativen Aspekte der Computerspielnutzung im Lernprozess werden gegenübergestellt.
- Gegenüberstellung der Befundlage: Die Ergebnisse der Metaanalyse werden mit den Ergebnissen anderer Studien zum Thema Game-based-Learning verglichen.
- Empfehlungen für zukünftige Studien: Es werden Empfehlungen für zukünftige Studien im Bereich von Game-based-Learning gegeben.
Schlüsselwörter
Game-based-Learning, Computerspiele, Lernprozess, Metaanalyse, Effektstärke, Motivation, Behaltensleistung, Lernergebnisse, Digitalisierung, Bildung, Wissensgesellschaft, digitale Medien, Medienpädagogik, eEducation.
Häufig gestellte Fragen
Welche positiven Effekte haben Computerspiele in Lernprozessen?
Die Metaanalyse zeigt positive Effekte wie bessere Lernergebnisse, eine erhöhte Behaltensleistung und eine deutliche Steigerung der Motivation der Lernenden.
Gibt es auch negative Aspekte beim Game-based-Learning?
Negative Aspekte sind laut Studie gering und beziehen sich primär auf höheren Aufwand, erhöhte Kosten oder eine minderwertige Qualität der eingesetzten Spiele.
Warum ist die Aktualität der Studien in diesem Bereich so wichtig?
Da sich die Computerspieltechnologie rasant entwickelt, sind ältere Studien oft nicht mehr valide. Diese Metaanalyse konzentriert sich daher auf Primärstudien aus den Jahren 2005 und 2006.
Wie viele Primärstudien wurden in dieser Metaanalyse ausgewertet?
Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung von sieben quantitativen Primärstudien.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Bildungswissenschaft?
Die Arbeit beleuchtet, wie digitale Medien und Computerspiele die traditionelle Wissensgesellschaft verändern und neue Möglichkeiten für die Medienpädagogik und eEducation eröffnen.
- Quote paper
- Bastian Leis (Author), 2016, Game-based-Learning. Zum Effekt von Lernen mit Computerspielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372222