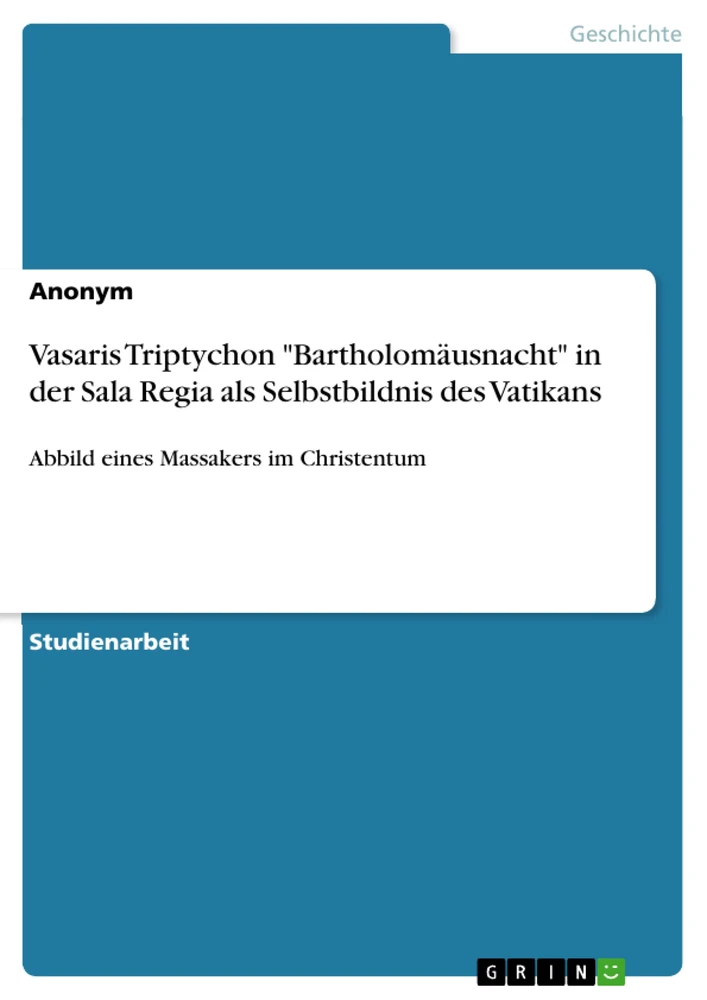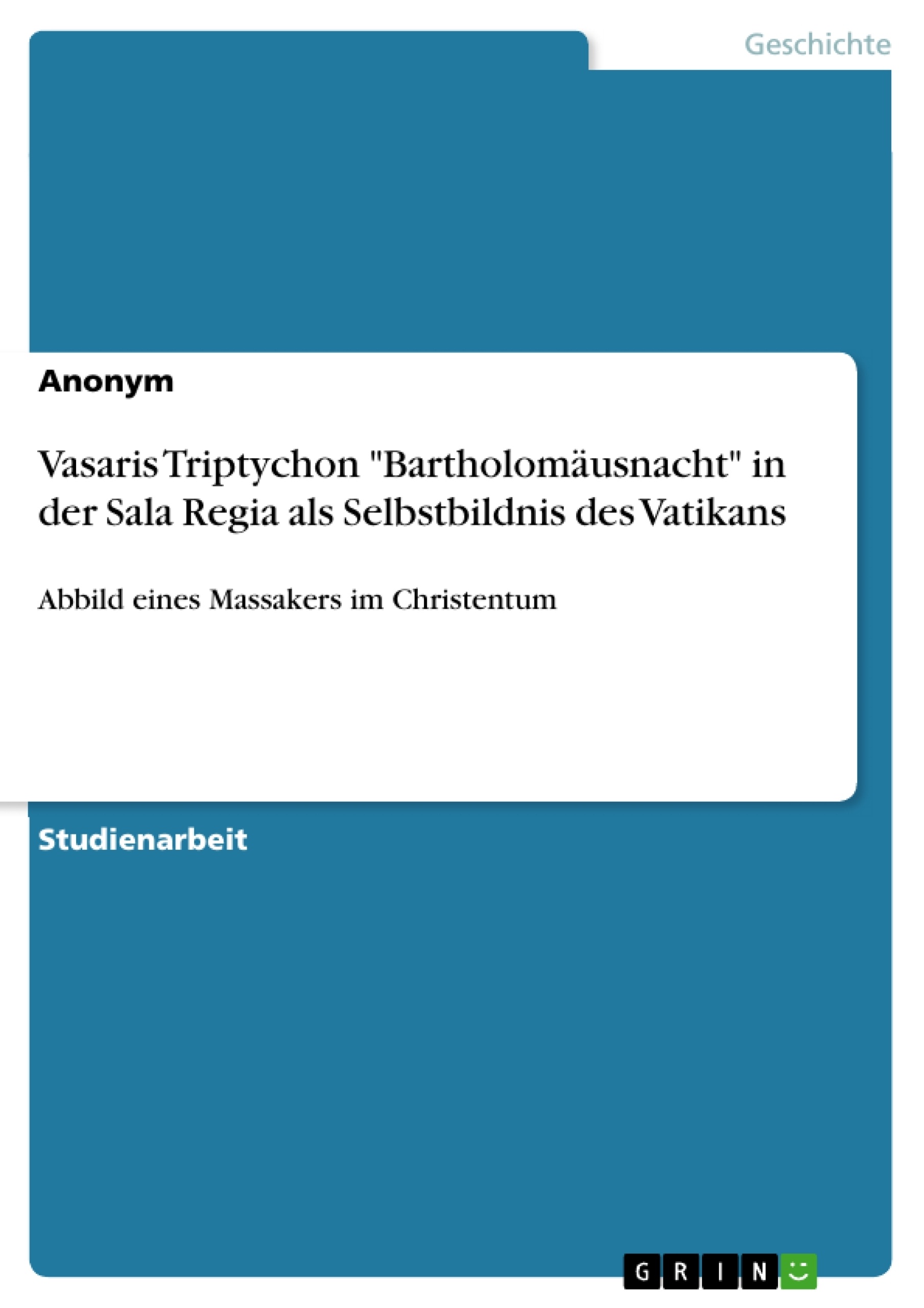Im Folgenden wird Vasaris Triptychons Kunstwerk der "Bartholomäusnacht" thematisiert. Von einem Kunstwerk, das sich in den wichtigsten Audienzräumen des Apostolischen Palastes befindet, darf angenommen werden, dass es den päpstlichen Auffassungen zu Kernfragen seines Pontifikats entsprach. Doch wieso sollte die höchste religiöse Instanz des Christentums diese Szenen der Ermordung zahlreicher Hugenotten in Paris als so bedeutend betrachten, dass der Papst beschloss diese als Rahmen für seinen Thron malen zu lassen? Hatte das Motiv der Gewalt dabei eine besondere Bedeutung? Welche Verbindung bestand zur Ermordung zahlreicher Hugenotten und dem Papst? Ausgehend von diesen Leitfragen soll anhand des Beispiels bildlicher Kommunikationsformen der Bartholomäusnacht in der Sala Regia in dieser Arbeit gezeigt werden, wie die gewaltsamen Vorgänge der Bartholomäusnacht 1572 in Paris für das Selbstverständnis und -bild des Papsttums aufgegriffen und zu eigenen Zwecken umgedeutet wurden. Auf diese Art soll im Kontext des Pontifikats Gregors XIII.die Sicht auf die darunterliegenden Selbst- und Weltdeutungen der frühneuzeitlichen Herrschafts- bzw. Gesellschaftsschicht am Beispiel der Gewaltdarstellung eröffnet werde.
Der Freskenzyklus ist das am wenigsten erforschte Kunstwerk Vasaris. Es ist eines seiner letzten gewesen, bevor er 1574 in Florenz verstarb. Zahlreiche Monografien wie beispielsweise die von Patricia Lee Rubin oder Gerd Blum erwähnen das Kunstwerk auf den letzten Seiten nur nebenbei, ohne ihm eine genauere Besprechung zukommen zu lassen. Der Kunsthistoriker Philipp Fehl sieht dies als indirekte moderne kunsthistorische Kritik am Bildwerk: zu ungenau die Deutungsebenen, zu heikel und verwerflich das Thema. Er betont, dass selbst der Vatikan bei Führungen durch den Palast gerne das Kernstück der Sala unkommentiert lässt.
In Anbetracht dessen, dass es bis jetzt nur eine ausführliche Monografie des gesamten Ausstattungsprogramms der Sala Regia gibt, nämlich die Dissertation „Die Sala Regia im Vatikan als Beispiel der Selbstdarstellung des Papsttums in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts“ von Angela Böck ist es erfreulich, dass sich die Fresken der Bartholomäusnacht von Vasari einem gewissen Forschungsinteresse erfreuen können. Allerdings liegen die Untersuchungen innerhalb der Aufsätze in einem schwankenden Umfang vor: während die erste Bildszene umfassender bearbeitet wurde, fällt die Besprechung der folgenden Zyklen geringer aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- a. Thematisierung
- b. Forschungsstand, Quellenlage und Vorgehensweise
- c. Kontextualisierung: Die Bartholomäusnacht
- 2. Erstes Fresko „Verwundung Coligny's“
- a. Inhalt und Ikonografie
- b. Interpretation
- 3. Zweites Fresko „Die Bartholomäusnacht“
- a. Inhalt und Ikonografie
- b. Interpretation
- 4. Drittes Fresko „König Karl IX. billigt den Mord an Coligny“
- a. Inhalt und Ikonografie
- b. Interpretation
- 5. Schlussbetrachtungen: Die Darstellung der Gewalt im repräsentativen Kontext des Vatikans
- a. Deutungen
- b. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fresken der Bartholomäusnacht von Giorgio Vasari in der Sala Regia des Vatikans. Ziel ist es, die Darstellung der gewaltsamen Ereignisse der Bartholomäusnacht im Kontext des Selbstverständnisses und -bildes des Papsttums unter Gregor XIII. zu analysieren und die dahinterliegenden Selbst- und Weltdeutungen der frühneuzeitlichen Herrschafts- und Gesellschaftsschicht zu beleuchten.
- Die künstlerische Darstellung der Bartholomäusnacht in der Sala Regia
- Die Interpretation der Gewaltdarstellung im Kontext des päpstlichen Selbstverständnisses
- Die Bedeutung der Fresken für das Verständnis frühneuzeitlicher Herrschaftsstrukturen
- Die bisherige Forschungslage zu Vasaris Freskenzyklus in der Sala Regia
- Die Reaktionen auf Gewalt in Form des Massakers im Kontext der Fresken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Fresken der Bartholomäusnacht von Giorgio Vasari in der Sala Regia des Vatikans als zentrale Forschungsfrage. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Bartholomäusnacht und die bisherige Forschungslage, die den Freskenzyklus als wenig erforscht ausweist. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Darstellung der Gewalt im Kontext des päpstlichen Selbstverständnisses zu untersuchen und die dahinterliegenden Deutungen von Herrschaft und Gesellschaft zu analysieren. Die methodische Vorgehensweise wird ebenfalls skizziert, wobei die Analyse der Fresken erweitert werden soll, indem die Reaktionen auf die Gewalt stärker in die Betrachtung miteinbezogen werden.
2. Erstes Fresko „Verwundung Coligny's“: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse des ersten Freskos, welches die Verwundung des Admiral Coligny darstellt. Es beinhaltet die Untersuchung der Ikonografie und eine Interpretation des dargestellten Inhalts, wobei die symbolische Bedeutung der Elemente im Bild und deren Aussagekraft für das Verständnis des Gesamtkontextes erörtert werden.
3. Zweites Fresko „Die Bartholomäusnacht“: Das Kapitel befasst sich mit dem zentralen Fresko des Zyklus, das die Bartholomäusnacht selbst darstellt. Eine umfassende Analyse der Ikonografie und der dargestellten Szenen, ergänzt durch eine eingehende Interpretation, bildet den Kern dieses Kapitels. Die Interpretation soll Aufschluss darüber geben, wie die Ereignisse künstlerisch dargestellt und welche Botschaften damit vermittelt werden.
4. Drittes Fresko „König Karl IX. billigt den Mord an Coligny“: Die Analyse konzentriert sich auf das dritte Fresko, das König Karl IX. bei der Billigung des Mordes an Coligny zeigt. Durch die detaillierte Betrachtung der Ikonografie und der symbolischen Elemente wird die Interpretation des Freskos vertieft. Der Fokus liegt auf der Darstellung der königlichen Zustimmung und den damit verbundenen politischen und religiösen Implikationen.
Schlüsselwörter
Bartholomäusnacht, Giorgio Vasari, Sala Regia, Vatikan, Gregor XIII., Gewaltdarstellung, Ikonografie, frühneuzeitliche Geschichte, Papsttum, Selbstbild, Herrschaftsstrukturen, religiöse Konflikte, politische Propaganda, kollektives Gedächtnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Fresken der Bartholomäusnacht von Giorgio Vasari in der Sala Regia
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Fresken der Bartholomäusnacht von Giorgio Vasari in der Sala Regia des Vatikans. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Gewalt im Kontext des päpstlichen Selbstverständnisses unter Gregor XIII. und den damit verbundenen Selbst- und Weltdeutungen der frühneuzeitlichen Herrschafts- und Gesellschaftsschicht.
Welche Fresken werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei Fresken: „Verwundung Coligny's“, „Die Bartholomäusnacht“ und „König Karl IX. billigt den Mord an Coligny“.
Welche Aspekte der Fresken werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Ikonografie der Fresken, die Interpretation der dargestellten Inhalte und deren Bedeutung im Kontext des päpstlichen Selbstverständnisses und der frühneuzeitlichen Herrschaftsstrukturen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung von Gewalt und den Reaktionen darauf.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert ikonografische Analyse mit einer Interpretation der dargestellten Ereignisse im historischen Kontext. Die Reaktionen auf die Gewalt werden stärker in die Betrachtung miteinbezogen als in bisherigen Forschungsarbeiten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die Darstellung der gewaltsamen Ereignisse der Bartholomäusnacht in den Fresken zu analysieren und die dahinterliegenden Selbst- und Weltdeutungen zu beleuchten. Die Arbeit trägt zum Verständnis frühneuzeitlicher Herrschaftsstrukturen und des päpstlichen Selbstbildes bei.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Analyse des ersten, zweiten und dritten Freskos und Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der Ikonografie und Interpretation der jeweiligen Fresken.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung thematisiert die Fresken und ihre Bedeutung als Forschungsgegenstand. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Bartholomäusnacht, die bisherige Forschungslage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit.
Was ist der Inhalt der Schlussbetrachtungen?
Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen und bieten eine umfassende Deutung der Gewaltdarstellung im repräsentativen Kontext des Vatikans.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bartholomäusnacht, Giorgio Vasari, Sala Regia, Vatikan, Gregor XIII., Gewaltdarstellung, Ikonografie, frühneuzeitliche Geschichte, Papsttum, Selbstbild, Herrschaftsstrukturen, religiöse Konflikte, politische Propaganda, kollektives Gedächtnis.
Wo finde ich weitere Informationen zur bisherigen Forschung zu den Vasari-Fresken?
Die Arbeit selbst beleuchtet den Forschungsstand zu Vasaris Freskenzyklus in der Sala Regia und verweist auf relevante Quellen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Vasaris Triptychon "Bartholomäusnacht" in der Sala Regia als Selbstbildnis des Vatikans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372277