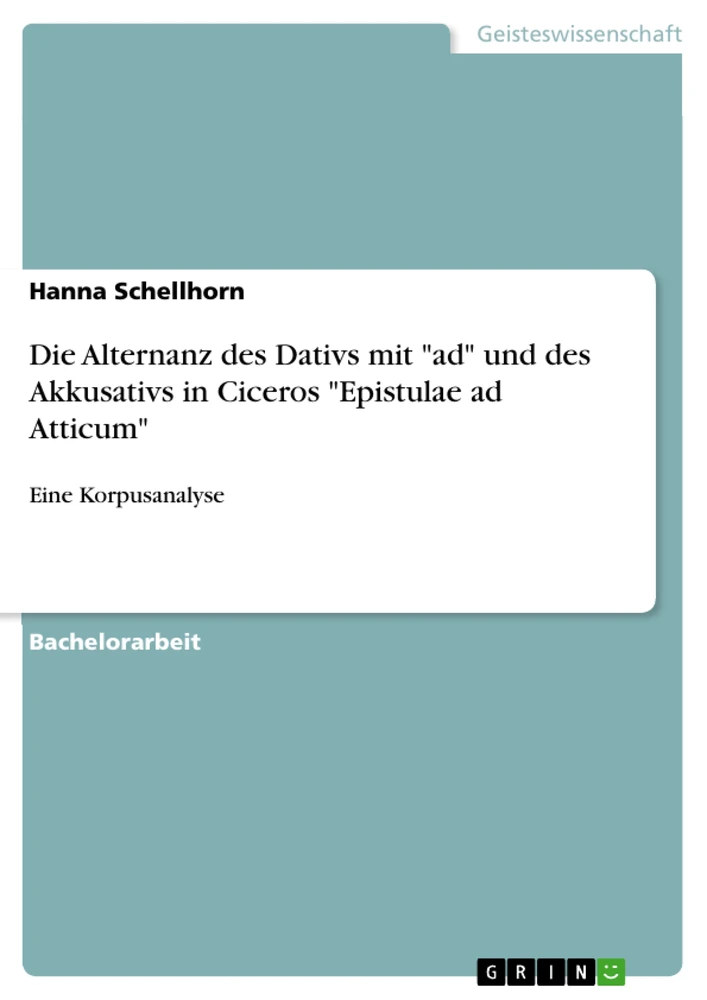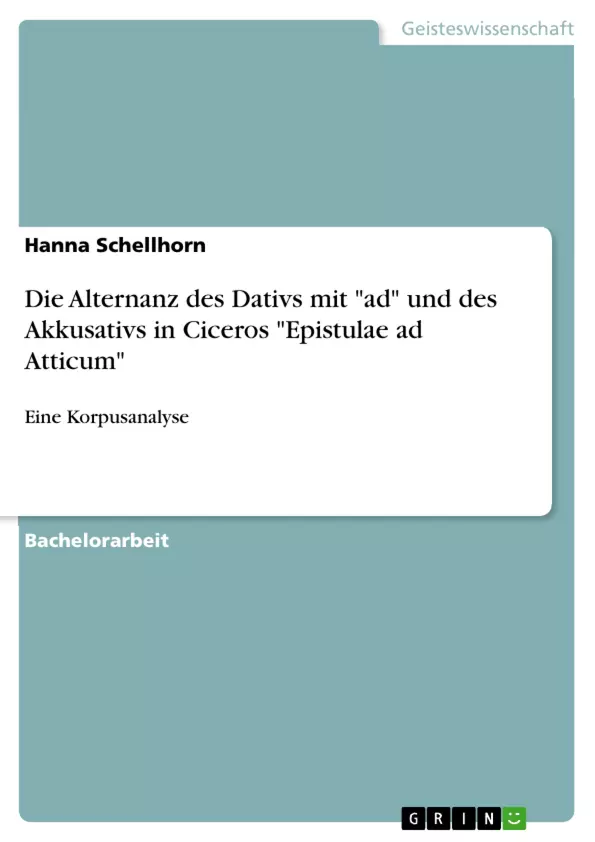Er ist der Albtraum eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin im Französischunterricht, mit dem sie dennoch bereits im ersten Lehrjahr konfrontiert werden: le complément objet indirect. Anders als im Deutschen wird dieser nicht mit einem Kasus, dem Dativ, wiedergegeben, sondern mit der Präposition à und dem darauffolgenden Objekt. Deshalb ist es nötig, bei jedem Verb dazuzulernen, wie das nachfolgende Komplement konstruiert wird. Zu dieser Kategorie gehören viele Beispiele aus dem Bereich der Kommunikation und des Transfers: donner qc à qn, demander qc à qn, dire qc à qn, envoyer qc à qn, écrire qc à qn etc. Die Liste dieser Verben ist lang und bereitet der Mehrheit der deutschen Muttersprachler zumindest zu Beginn ihrer französischen Sprachkarriere Schwierigkeiten.
Diese Tatsache ist der historischen Entwicklung des Romanischen zu verdanken. Denn wenn man zu dessen lateinischen Ursprüngen, der Wurzel des Französischen, zurückgeht, bildete eine Anzahl an Kasus, von denen jeder einzelne bestimmte grammatische Funktionen übernahm, einen erheblichen Teil der Syntax. Doch gab es in diesem System eine entscheidende Schwachstelle. Viele Fälle besaßen je nach Deklinationsart die gleiche Endung. So kam es, dass die Funktion von Endungen allmählich von Präpositionen übernommen wurde, um dadurch größere Klarheit zu schaffen und eventuelle Missverständnisse zu vermeiden.
Der Wechsel zwischen dem Kasus und ad mit Akkusativ ist durchaus kein Phänomen, was sich erst vermehrt in der nachklassischen Zeit finden lässt. Es dient eine Korpusanalyse der epistulae ad Atticum von Cicero als Datengrundlage. Die Verben dare, mittere und scribere stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Normalerweise vom Dativ gefolgt, bezeichnen sie einen Akt des Übergebens und des Transfers, ähnlich wie die Verben im Französischen, die mit dem complément objet indirect gebildet werden. Somit sind sie gut für diese Studie geeignet, denn sie repräsentieren sozusagen die Basis für die Entwicklung eines wichtigen Aspekts der französischen Grammatik.
Inhaltsverzeichnis
- ad mit Akkusativ statt Dativ – ein Phänomen des Spätlateins?
- Kasus und Präposition im Vergleich
- Lateinischer Dativ
- Präposition ad
- Fazit
- Semasiologische Kategorisierungen
- Nominales und pronominales Komplement
- Finite oder infinite Verbform
- Mündliche oder übertragene Lesart
- Fazit
- Theorie der Absenz oder Präsenz des Empfängers
- Ausgangsposition
- Hypothese
- Überprüfen der Hypothese an den Belegen aus ad Atticum
- dare
- mittere
- scribere
- Fazit
- Theorie der Konkretheit oder Abstraktheit der Handlung
- Hypothese
- Differenz zwischen Konkretheit und Abstraktheit
- scribere
- mittere
- Differenz zwischen Belebtheit oder Unbelebtheit
- Fazit
- Theorie der Zugehörigkeit des gesendeten Objekts
- Ausgangsposition und Hypothese
- mittere
- scribere
- Fazit
- Ausgangsposition und Hypothese
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Verwendung von ad mit Akkusativ anstelle des Dativs in Ciceros Epistulae ad Atticum und untersucht, ob es sich dabei um ein Phänomen des Spätlateins handelt. Die Analyse basiert auf einer Korpusuntersuchung und zielt darauf ab, die Gründe für diese Alternanz zu ergründen.
- Analyse der historischen Entwicklung des Dativs im Lateinischen
- Vergleich von Dativ und Präposition ad in Bezug auf ihre Funktionen
- Untersuchung semasiologischer Kategorisierungen, die für die Wahl des Dativs oder der Präposition ad relevant sind
- Entwicklung und Überprüfung von Theorien zur Erklärung der Alternanz, wie z. B. die Präsenz oder Absenz des Empfängers, die Konkretheit oder Abstraktheit der Handlung sowie die Zugehörigkeit des gesendeten Objekts
- Zusammenfassende Analyse der Ergebnisse und deren Bedeutung für das Verständnis des Sprachwandels im Lateinischen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Phänomen des ad mit Akkusativ anstelle des Dativs im Spätlatein. Es wird die historische Entwicklung des Dativs und der Präposition ad im Vergleich dargestellt. Kapitel 2 untersucht die grammatischen Funktionen des Dativs und der Präposition ad im Detail. Dabei werden die verschiedenen semasiologischen Kategorien wie das nominale und pronominales Komplement, die finite oder infinite Verbform sowie die mündliche oder übertragene Lesart betrachtet. Kapitel 3 befasst sich mit der Theorie der Präsenz oder Absenz des Empfängers als möglichem Grund für die Alternanz. Es werden die Verben dare, mittere und scribere anhand von Beispielen aus den Epistulae ad Atticum untersucht. Kapitel 4 präsentiert die Theorie der Konkretheit oder Abstraktheit der Handlung, die ebenfalls für die Wahl des Dativs oder der Präposition ad relevant sein könnte. Die Verben mittere und scribere werden erneut anhand von Beispielen analysiert. Kapitel 5 stellt die Theorie der Zugehörigkeit des gesendeten Objekts als letzten möglichen Erklärungsansatz vor. Die Verben mittere und scribere werden zum Abschluss des Kapitels anhand weiterer Belege analysiert.
Schlüsselwörter
Lateinische Syntax, Dativ, Präposition ad, Kasusalternanz, Spätlatein, Epistulae ad Atticum, Cicero, semasiologische Kategorisierung, Empfänger, Handlung, Objekt, Korpusanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Untersuchung von Ciceros Briefen?
Die Arbeit untersucht die Alternanz (den Wechsel) zwischen dem Dativ und der Präposition "ad" mit Akkusativ in den "Epistulae ad Atticum".
Ist die Verwendung von "ad" statt Dativ nur ein Phänomen des Spätlateins?
Nein, die Korpusanalyse zeigt, dass dieses Phänomen bereits bei Cicero (klassische Zeit) auftritt und somit tiefere Wurzeln in der lateinischen Syntax hat.
Welche Verben stehen im Fokus der Studie?
Die Analyse konzentriert sich primär auf die Verben des Gebens und Sendens: dare, mittere und scribere.
Welche Rolle spielt die Präsenz des Empfängers bei der Wahl der Konstruktion?
Eine Hypothese der Arbeit ist, dass die physische Präsenz oder Absenz des Empfängers die Entscheidung zwischen Dativ und "ad" beeinflussen könnte.
Wie hängen diese lateinischen Konstruktionen mit dem modernen Französisch zusammen?
Die Entwicklung von der Kasusendung hin zur Präposition "à" im Französischen hat ihren Ursprung in diesen lateinischen Alternanzen zur Vermeidung von Unklarheiten.
- Quote paper
- Hanna Schellhorn (Author), 2016, Die Alternanz des Dativs mit "ad" und des Akkusativs in Ciceros "Epistulae ad Atticum", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372429