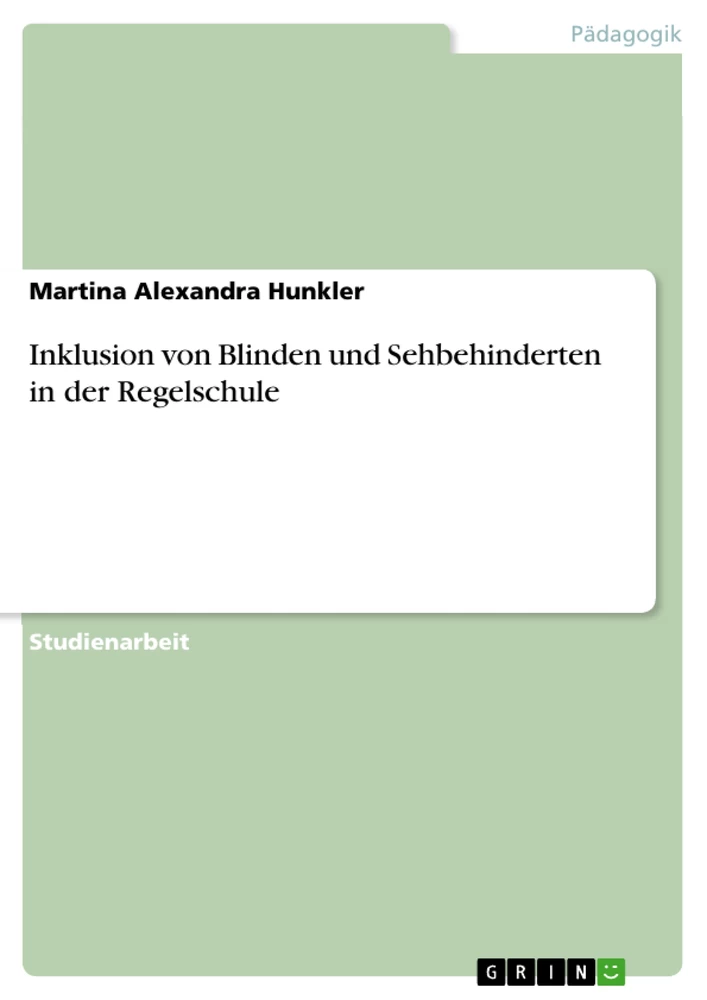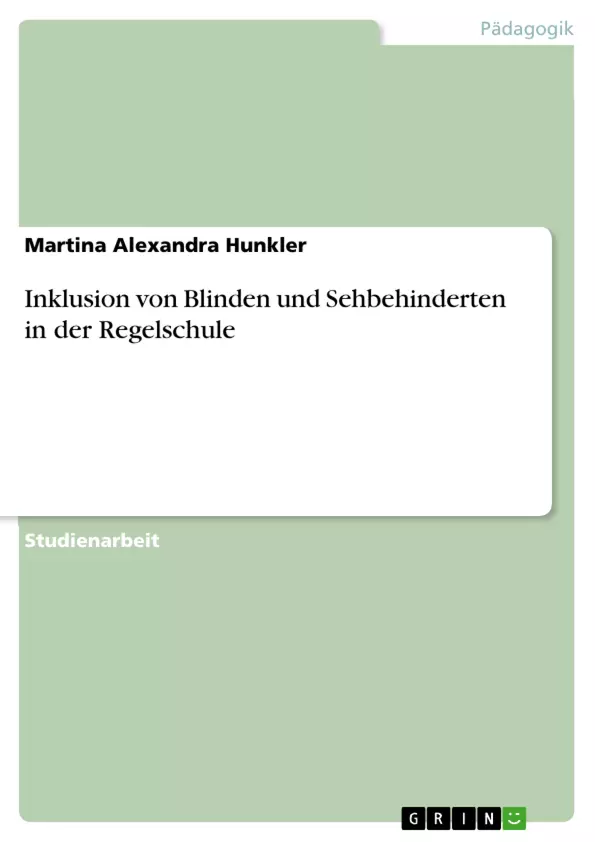Im Jahr 2003 wurden 6.167 Schüler mit einer visuellen Einschränkung registriert. Da diese Schüler aber häufig Regelschulen besuchen, soll der Fokus dieser Arbeit auf den besonderen Anforderungen dieser Schüler an die Institution Schule liegen. Diese Arbeit soll den Weg vom Allgemeinen über das Individuelle zum Besonderen gehen. Daher wird zunächst der Lehrplan für Schule für Blinde und Sehbehinderte zusammengefasst dargestellt. Anhand von Interviews mit zwei Individuen soll dann der Bogen zum Besonderen geschlagen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Das Allgemeine - Der Bildungsplan für die Schule für Blinde und Sehbehinderte 2011
- 2.1 Wahrnehmung und Lernen
- 2.2 Methodenkompetenz
- 2.3 Kommunikation
- 2.4 Identität und Umgang mit anderen
- 2.5 Lebenspraxis
- 2.6 Bewegung, Orientierung und Mobilität
- 2.7 Lebensentwürfe und Lebensplanung
- 3. Das Individuelle und Besondere - ein Interview
- 4. Interview mit Peter
- 4.2 Biographische Informationen
- 4.3 Analyse des Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Prozessen von Integration und Inklusion in Schule und Unterricht, wobei der Fokus auf Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen der visuellen Funktionen liegt. Ziel ist es, die besonderen Anforderungen dieser Schüler an die Institution Schule zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für ihre Bedürfnisse zu entwickeln.
- Der Bildungsplan für die Schule für Blinde und Sehbehinderte 2011 als Grundlage für die Bildung von Schülern mit visuellen Einschränkungen
- Die Bedeutung von Wahrnehmung und Lernen im Kontext der visuellen Einschränkung
- Methodenkompetenz und Kommunikationsmöglichkeiten für Schüler mit Sehbehinderung
- Identität und Umgang mit anderen im schulischen Kontext
- Lebensentwürfe und Lebensplanung von Schülern mit visuellen Einschränkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema, die die Bedeutung von Inklusion und Integration im Bildungssystem beleuchtet. Anschließend wird der Bildungsplan für die Schule für Blinde und Sehbehinderte 2011 vorgestellt, wobei die sieben Bildungsbereiche im Detail erläutert werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Bereich Wahrnehmung und Lernen und der Anpassung des Unterrichts an die Bedürfnisse von Schülern mit Sehbehinderung.
Im weiteren Verlauf werden zwei Interviews mit Schülern mit visuellen Einschränkungen vorgestellt, die Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen im Schulalltag geben.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Sehbehinderung, Bildungsplan für die Schule für Blinde und Sehbehinderte 2011, Wahrnehmung, Lernen, Methodenkompetenz, Kommunikation, Identität, Lebenspraxis, Lebensentwürfe, Lebensplanung.
Häufig gestellte Fragen
Wie gelingt die Inklusion von Blinden an Regelschulen?
Inklusion erfordert spezielle Hilfsmittel (Braille-Zeilen, Screenreader), angepasste Unterrichtsmaterialien und eine Schulung der Mitschüler und Lehrer im Umgang mit Sehbehinderungen.
Was beinhaltet der Bildungsplan für Blinde (2011)?
Der Plan umfasst Bereiche wie Wahrnehmung, Mobilitätstraining (Orientierung), lebenspraktische Fertigkeiten sowie Methodenkompetenz für den Zugriff auf Informationen.
Welche Herausforderungen haben Sehbehinderte im Schulalltag?
Herausforderungen liegen in der schnellen Verarbeitung visueller Informationen (Tafelbilder), der Orientierung im Schulgebäude und der sozialen Interaktion ohne visuelle Signale.
Was bedeutet "Orientierung und Mobilität" (O&M)?
Es ist ein spezielles Training, bei dem blinde Schüler lernen, sich mit dem Langstock sicher und selbstständig in ihrer Umgebung zu bewegen.
Wie wichtig ist die Identitätsbildung bei behinderten Schülern?
Die Arbeit zeigt durch Interviews, dass der Umgang mit der eigenen Einschränkung und die Akzeptanz durch die Peer-Group entscheidend für den Schulerfolg und die Lebensplanung sind.
- Quote paper
- Martina Alexandra Hunkler (Author), 2016, Inklusion von Blinden und Sehbehinderten in der Regelschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372522