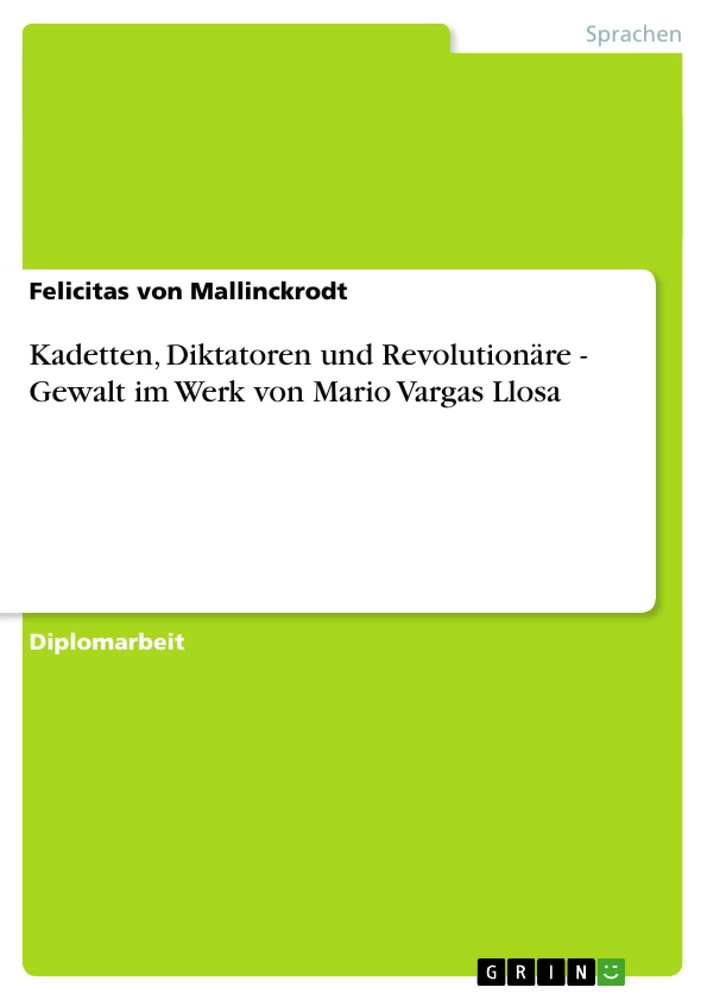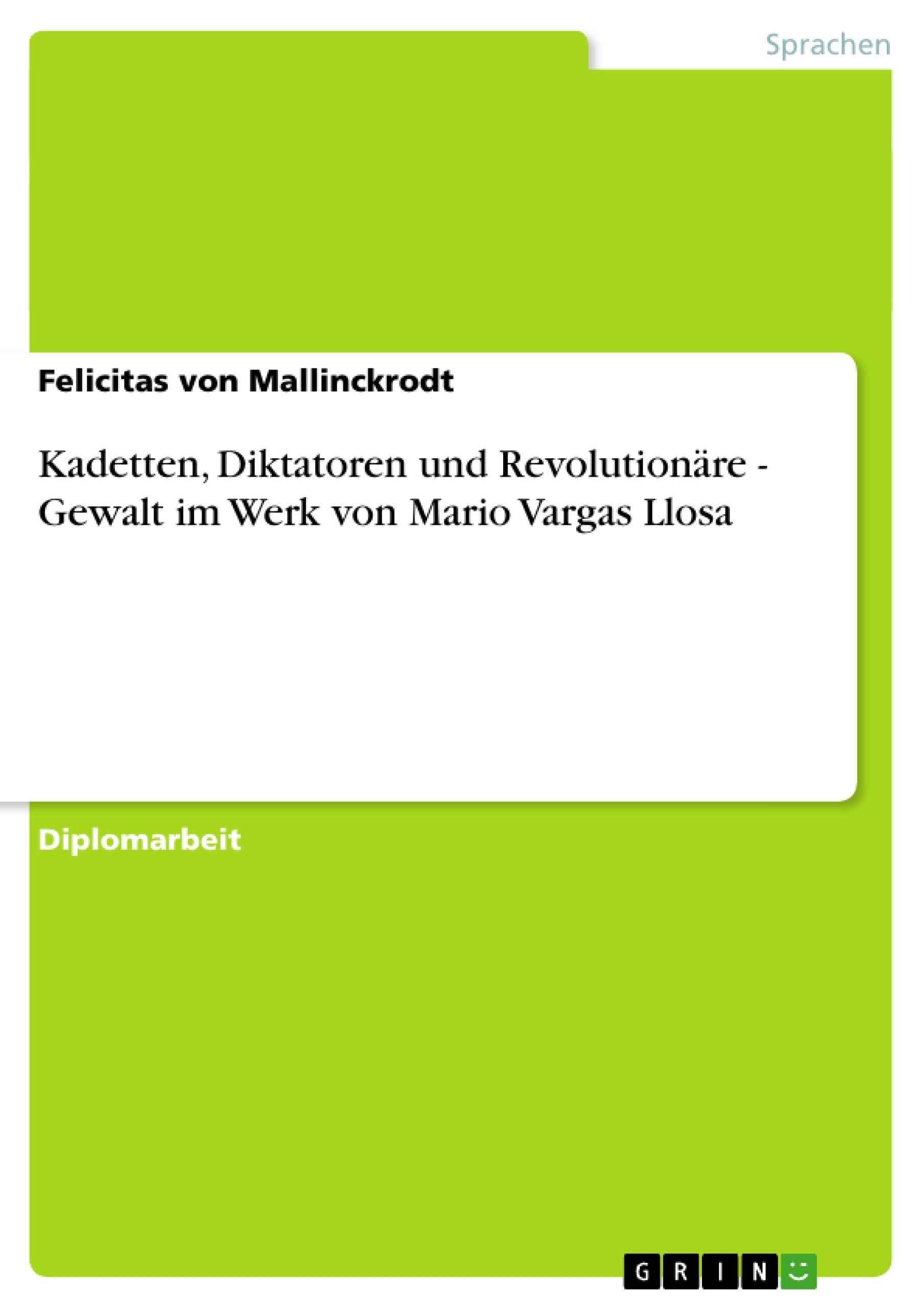Einleitung
Mario Vargas Llosa gehört mit Sicherheit zu den renommiertesten und meistgelesenen lateinamerikanischen Autoren unserer Zeit. Sein literarisches Werk umfaßt dabei, neben mittlerweile vierzehn Romanen, auch Erzählungen und Theaterstücke. Doch Vargas Llosa beschränkt sich nicht allein auf fiktive Texte. In García Márquez: historia de un deicidio1 und La orgía perpetua: Flaubert y Mademe Bovary2 widmet er sich literaturkritischen Themen und formuliert seine eigene Romantheorie. Daneben nimmt er in verschieden Essaybänden, die wichtigsten unter ihnen sind Contra viento y marea I-III3, sowie in unzähligen Zeitungsartikeln und Interviews immer wieder Stellung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Diese Vielschichtigkeit der Themen zeigt, wie wichtig das Spannungsverhältnis von Realität und Fiktion für das Schaffen des peruanischen Autors ist.
Aus diesem Grund soll eben jenes Spannungsverhältnis auch an dieser Stelle den Hintergrund für die Analyse der Gewalt im Werk Mario Vargas Llosas bilden. Gewalt ist ein konstanter Bestandteil seiner Romane. Schon bei der oberflächlichen Lektüre fällt auf, wie sehr diese fiktiven Welten von Gewalt durchdrungen sind, wie sehr sowohl öffentliches, als auch privates Leben von ihr dominiert werden. Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, die genaue Rolle zu analysieren, die der Gewalt in drei ausgewählten Romanen Vargas Llosas zukommt. Dabei soll aber auch das Verhältnis von Realität und Fiktion nicht außer Acht gelassen werden, denn wie sich später zeigen wird, weisen die Romane trotz ihres fiktiven Charakters auch immer einen deutlichen Bezug zur peruanischen Wirklichkeit auf.
Um nun den sehr umfangreichen Begriff ‚Gewalt‘ besser fassen und analysieren zu können, sollen drei seiner Erscheinungsformen herausgegriffen werden: gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus als Form von staatlicher Gewalt und terroristische Gewalt. Im ersten Teil dieser Arbeit soll zunächst darauf eingegangen werden, inwieweit diese drei Formen in der peruanischen Geschichte eine Rolle gespielt haben und in welchem Umfang sie dort auch noch heute anzutreffen sind. ...
---
1 VARGAS LLOSA, Mario: García Márquez: Historia de un deicidio; Barcelona 1971.
2 VARGAS LLOSA, Mario: La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary; Barcelona 1975.
3 VARGAS LLOSA, Mario: Contra viento y marea I-III; Barcelona 1983, 1986, 1990.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Erscheinungsformen der Gewalt
- 1.1 Gewalt in der Gesellschaft
- 1.2 Die Tradition des Autoritarismus
- 1.3 Terroristische Gewalt
- Kapitel 2: Realität und Fiktion
- 2.1 Abrechnung mit der Realität: Ein Autor und seine Dämonen
- 2.2 Der Gottesmord und die Schaffung einer neuen Realität
- Kapitel 3: Darstellung von Gewalt: Die Romane
- 3.1 La ciudad y los perros oder: Das Gesetz des Dschungels
- 3.2 Chronik eines angekündigten Scheiterns: Conversación en La Catedral
- 3.3 Historia de Mayta oder: Die Abrechnung mit der Radikalität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Gewalt im Werk Mario Vargas Llosas, wobei das Spannungsverhältnis zwischen Realität und Fiktion im Mittelpunkt steht. Es werden drei Erscheinungsformen von Gewalt – gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus und terroristische Gewalt – untersucht und ihre Präsenz in Vargas Llosas ausgewählten Romanen beleuchtet. Die Analyse fokussiert auf den Einfluss der peruanischen Realität auf die fiktiven Welten des Autors und die Rolle der Gewalt in der Gestaltung seiner Romane.
- Die verschiedenen Erscheinungsformen von Gewalt im peruanischen Kontext
- Das Verhältnis von Realität und Fiktion im Werk Vargas Llosas
- Die Rolle der Gewalt in der Konstruktion der Romanwelten
- Analyse der Gewalt in drei ausgewählten Romanen Vargas Llosas
- Vargas Llosas Romantheorie und sein Schaffensprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Mario Vargas Llosa als einen der bedeutendsten lateinamerikanischen Autoren vor. Sie betont die Vielschichtigkeit seines Werks, das sowohl fiktionale Texte als auch literaturkritische und essayistische Arbeiten umfasst. Das Spannungsverhältnis zwischen Realität und Fiktion wird als zentraler Aspekt für das Verständnis seines Schaffens hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Rolle von Gewalt in drei ausgewählten Romanen und deren Bezug zur peruanischen Wirklichkeit. Drei Erscheinungsformen von Gewalt – gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus und terroristische Gewalt – werden als analytische Schwerpunkte definiert.
Kapitel 1: Erscheinungsformen der Gewalt: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen von Gewalt in der peruanischen Geschichte und Gegenwart. Es analysiert gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus als Form staatlicher Gewalt und terroristische Gewalt, um das tatsächliche Vorhandensein von Gewalt in Peru zu belegen und die Grundlage für die spätere Analyse der Romane zu schaffen. Die Kapitelteile untersuchen den historischen und soziopolitischen Kontext, in dem diese Gewaltformen wurzeln und wirken.
Kapitel 2: Realität und Fiktion: Kapitel 2 befasst sich mit der Transformation der peruanischen Realität in die fiktiven Welten Vargas Llosas. Es untersucht, wie die Wirklichkeit in seine Romane einfließt und beleuchtet seine Romantheorie, die dem Leser Werkzeuge zum Verständnis seines Schaffens liefert. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen autobiografischen Elementen, gesellschaftlichen Beobachtungen und der künstlerischen Gestaltung der fiktiven Erzählungen. Die Analyse zeigt, wie Vargas Llosa die Realität verarbeitet und in literarische Form umwandelt.
Kapitel 3: Darstellung von Gewalt: Die Romane: Dieses Kapitel analysiert exemplarisch drei Romane Vargas Llosas: "La ciudad y los perros", "Conversación en La Catedral", und "Historia de Mayta". Jeder Roman wird im Hinblick auf eine spezifische Erscheinungsform von Gewalt untersucht: "La ciudad y los perros" beleuchtet die Gewalt in der Gesellschaft, "Conversación en La Catedral" den Autoritarismus und staatliche Repression, und "Historia de Mayta" die terroristische Gewalt. Die Kapitel bieten detaillierte Analysen der jeweiligen Romane und deren Darstellung von Gewalt im Kontext der peruanischen Geschichte und Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Mario Vargas Llosa, Gewalt, Peru, Realität und Fiktion, Autoritarismus, Terrorismus, Gesellschaftliche Gewalt, Romantheorie, La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, Historia de Mayta, lateinamerikanische Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Gewalt im Werk Mario Vargas Llosas
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Gewalt im Werk Mario Vargas Llosas, wobei der Fokus auf dem Spannungsverhältnis zwischen Realität und Fiktion liegt. Es werden drei Erscheinungsformen von Gewalt – gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus und terroristische Gewalt – untersucht und deren Präsenz in ausgewählten Romanen Vargas Llosas beleuchtet.
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch drei Romane Vargas Llosas: "La ciudad y los perros", "Conversación en La Catedral" und "Historia de Mayta". Jeder Roman wird im Hinblick auf eine spezifische Erscheinungsform von Gewalt untersucht.
Welche Erscheinungsformen von Gewalt werden untersucht?
Die Arbeit untersucht gesellschaftliche Gewalt, Autoritarismus als Form staatlicher Gewalt und terroristische Gewalt im peruanischen Kontext.
Wie wird das Verhältnis von Realität und Fiktion behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie die peruanische Realität in die fiktiven Welten Vargas Llosas einfließt. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen autobiografischen Elementen, gesellschaftlichen Beobachtungen und der künstlerischen Gestaltung der fiktiven Erzählungen. Die Analyse zeigt, wie Vargas Llosa die Realität verarbeitet und in literarische Form umwandelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 analysiert die Erscheinungsformen der Gewalt in Peru. Kapitel 2 behandelt das Verhältnis von Realität und Fiktion im Werk Vargas Llosas. Kapitel 3 analysiert die Darstellung von Gewalt in den drei ausgewählten Romanen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Gewalt in der Konstruktion der Romanwelten Vargas Llosas zu analysieren und den Einfluss der peruanischen Realität auf sein Schaffen zu beleuchten. Sie untersucht Vargas Llosas Romantheorie und seinen Schaffensprozess.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mario Vargas Llosa, Gewalt, Peru, Realität und Fiktion, Autoritarismus, Terrorismus, Gesellschaftliche Gewalt, Romantheorie, La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, Historia de Mayta, lateinamerikanische Literatur.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet detaillierte Zusammenfassungen der Einleitung und der drei Hauptkapitel. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und methodischen Ansätze.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten gedacht, die sich mit dem Werk Mario Vargas Llosas, der lateinamerikanischen Literatur und der Darstellung von Gewalt in der Literatur auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Felicitas von Mallinckrodt (Autor), 2004, Kadetten, Diktatoren und Revolutionäre - Gewalt im Werk von Mario Vargas Llosa, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37277