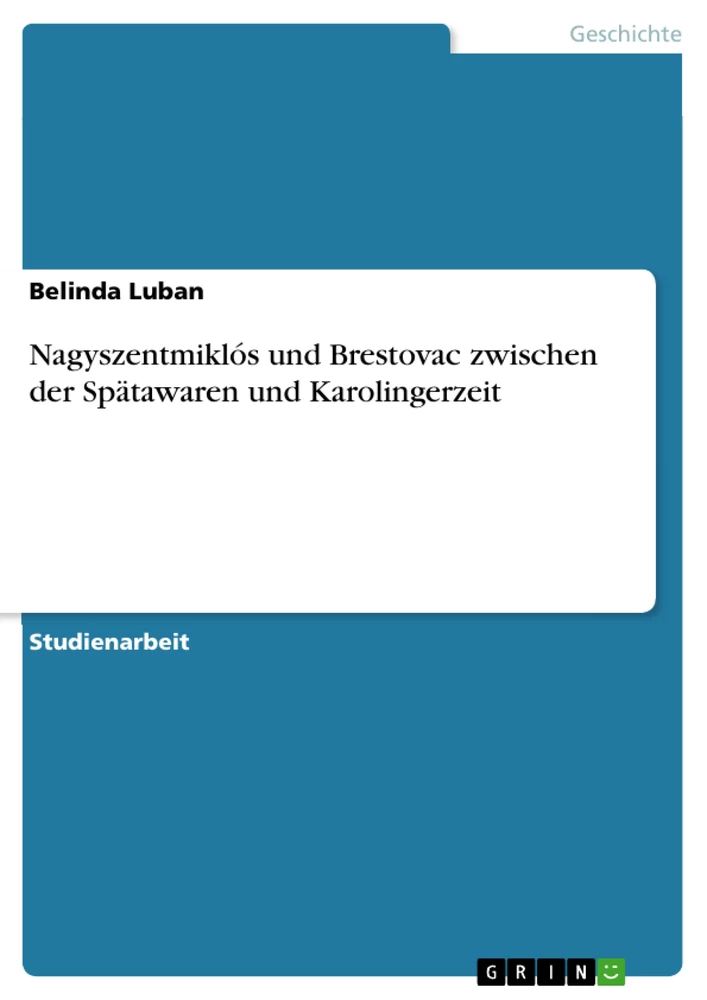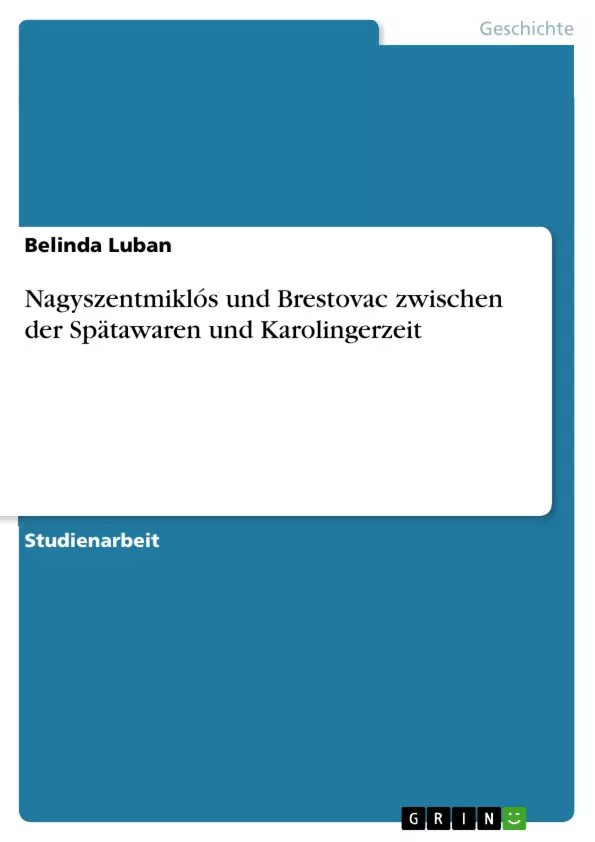Der sogenannte „Schatz des Attila“ und der Schatzfund von Brestovac stellen einen grundlegenden archäologischen Forschungsbereich im Karpatenbecken zwischen der Spätawaren und Karolingerzeit dar. Die Entdeckung beider Schätze Anfang des 19. Jhs. erweckten ein reges Interesse an der Untersuchung der reichen Goldfunde des frühen Mittelalters. Seither gab es eine Vielzahl an Forschungsansätzen verschiedener Archäologen, die sich mit dem Schatz von Nagyszentmiklós auseinandergesetzt haben, jedoch laut des Ungarn Csanád Bálint nicht ein zufriedenstellendes Resultat seinerseits erzielen konnten. Er kritisiert sogar namentlich Robert Göbl, der das Augenmerk nicht auf das Alter des Schatzes gelenkt hat und somit nicht genaue Ergebnisse erzielen konnte.
In der Vergangenheit wurden Themen wie „Inschriftsanalysen“, „Metallgefäßkunst“ und „Nutzungsmöglichkeiten“ erforscht - die wichtige Frage stellt sich nichtsdestotrotz, wenn man die Schätze miteinander vergleicht und so das Alter erschließen möchte. Relevante Ansätze dazu überlieferten der oben genannte ungarische Archäologe und Birgit Bühler, deren Buch Der „Schatz“ von Brestovac, Kroatien letztes Jahr erschien. Aufschlüsse über besondere Materialanalysen bis hin zu kulturellen Bezügen in der Spätawarenzeit des 8. Jh. n.Ch. konnten ebenfalls gegeben werden.
Im Zuge der Hausarbeit möchte ich auf die oben erwähnten einzelnen Aspekte eingehen, die Schätze aber auch auf Form und Gebrauchsspuren untersuchen. Die Entdeckungsgeschichte wird dabei nur einen kleinen Teil umfassen, da die Auswertung und der Vergleich der gefundenen Objekte im Raum Ungarn/Kroatien/Rumänien einen viel größeren Punkt ausmachen.
Abschließend soll nicht nur die Altersfrage geklärt werden, sondern auch inwiefern diese Schätze eine so aussagekräftige Rolle im Bezug zu der damaligen christianisierenden Lebenseinstellung spielten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historische Überblick
- 3. Der „Goldschatz von Nagyszentmiklós“
- 4. Der „Goldschatz von Brestovac“
- 5. Datierung, Parallelen und Unterschiede
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Schätze“ von Nagyszentmiklós und Brestovac, bedeutende archäologische Funde aus der Spät-Awaren- und Karolingerzeit im Karpatenbecken. Ziel ist es, die Funde zu vergleichen, ihre Datierung zu klären und ihre Bedeutung im Kontext der damaligen christianisierenden Gesellschaft zu erörtern.
- Vergleich der Goldschätze von Nagyszentmiklós und Brestovac
- Klärung der Datierung beider Schätze
- Analyse der Form und der Gebrauchsspuren der Fundobjekte
- Bedeutung der Schätze im Kontext der Christianisierung
- Untersuchung der kulturellen Bezüge in der Spätawarenzeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Goldschätze von Nagyszentmiklós und Brestovac, bedeutende Funde aus dem Karpatenbecken, die bis heute Gegenstand intensiver Forschung sind. Die Arbeit will die Schätze miteinander vergleichen, ihre Datierung klären und ihre Bedeutung im Kontext der damaligen christianisierenden Gesellschaft erörtern. Bisherige Forschungsansätze werden kritisch bewertet, und es werden neue Methoden zur Datierung und Interpretation der Fundobjekte vorgestellt.
2. Der historische Überblick: Dieses Kapitel beschreibt die Entdeckungsgeschichte der beiden Schätze. Der Schatz von Nagyszentmiklós (gefunden 1799) besteht aus 23 Goldgefäßen und wird volkstümlich dem Hunnenkönig Attila zugeschrieben. Der Schatz von Brestovac (gefunden 1821) beinhaltet ebenfalls zahlreiche Goldobjekte, von denen ein Teil nach der Auffindung verkauft wurde. Beide Funde geben Aufschluss über den Goldreichtum der Region in der Spät-Awarenzeit und der frühen Karolingerzeit und werfen Fragen zur Herkunft und Verwendung dieser kostbaren Objekte auf.
3. Der „Goldschatz von Nagyszentmiklós“: Dieses Kapitel befasst sich eingehender mit dem Schatz von Nagyszentmiklós. Es wird auf die Zusammensetzung des Schatzes eingegangen, die einzelnen Fundstücke werden beschrieben und die verschiedenen Theorien zu ihrer Entstehung und Verwendung diskutiert. Die vorherrschende Meinung zum Herkunftszeitraum des Schatzes wird kritisch hinterfragt und es werden neue Ansätze präsentiert, um das Alter der Funde genauer zu bestimmen. Die Bedeutung des Schatzes im Kontext der awarischen Kultur wird ausführlich betrachtet.
4. Der „Goldschatz von Brestovac“: Ähnlich dem vorherigen Kapitel analysiert dieses den Schatz von Brestovac detailliert. Die Komposition des Schatzes, die einzelnen Objekte, und ihre möglichen Funktionen werden beschrieben und diskutiert. Die Umstände der Auffindung und die anschließenden Ereignisse werden ebenso erläutert. Die Bedeutung des Schatzes im Kontext der regionalen Kultur und seine mögliche Verbindungen zum Schatz von Nagyszentmiklós werden untersucht.
Schlüsselwörter
Nagyszentmiklós, Brestovac, Spätawarenzeit, Karolingerzeit, Goldschatz, Archäologie, Karpatenbecken, Datierung, Christianisierung, Awaren, Goldgefäße, Metallgefäßkunst, Materialanalyse, kulturelle Bezüge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Vergleich der Goldschätze von Nagyszentmiklós und Brestovac
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die archäologischen Goldschätze von Nagyszentmiklós und Brestovac aus der Spät-Awaren- und Karolingerzeit im Karpatenbecken. Sie untersucht deren Datierung, analysiert Form und Gebrauchsspuren der Fundobjekte und erörtert ihre Bedeutung im Kontext der damaligen Christianisierung.
Welche Schätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den „Goldschatz von Nagyszentmiklós“ (gefunden 1799, bestehend aus 23 Goldgefäßen) und den „Goldschatz von Brestovac“ (gefunden 1821, ebenfalls mit zahlreichen Goldobjekten). Ein Teil des Brestovac-Schatzes wurde nach der Auffindung verkauft.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Hauptziele sind der Vergleich der beiden Schätze, die Klärung ihrer Datierung, die Analyse von Form und Gebrauchsspuren der Fundstücke, die Erforschung ihrer Bedeutung im Kontext der Christianisierung und die Untersuchung kultureller Bezüge in der Spät-Awarenzeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen historischen Überblick, Kapitel zu den einzelnen Schätzen (Nagyszentmiklós und Brestovac), ein Kapitel zur Datierung, Parallelen und Unterschieden, sowie ein Fazit. Es werden auch die bisherigen Forschungsansätze kritisch bewertet und neue Methoden zur Datierung und Interpretation vorgestellt.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und die Forschungsziele. Kapitel 2 (Historischer Überblick): Beschreibung der Entdeckungsgeschichte beider Schätze und deren Bedeutung im Kontext des Goldreichtums der Region. Kapitel 3 (Goldschatz von Nagyszentmiklós): Detaillierte Analyse des Schatzes, Beschreibung der Fundstücke und Diskussion verschiedener Theorien zu Entstehung und Verwendung. Kapitel 4 (Goldschatz von Brestovac): Ähnliche Analyse wie in Kapitel 3, aber bezogen auf den Schatz von Brestovac. Kapitel 5 (Datierung, Parallelen und Unterschiede): Vergleichende Analyse beider Schätze hinsichtlich ihrer Datierung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kapitel 6 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Nagyszentmiklós, Brestovac, Spätawarenzeit, Karolingerzeit, Goldschatz, Archäologie, Karpatenbecken, Datierung, Christianisierung, Awaren, Goldgefäße, Metallgefäßkunst, Materialanalyse, kulturelle Bezüge.
Welche Bedeutung haben die Schätze im Kontext der Christianisierung?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Schätze im Kontext der damaligen christianisierenden Gesellschaft. Es wird analysiert, wie die Funde mit dem Prozess der Christianisierung in Verbindung stehen könnten.
Welche Methoden werden zur Datierung der Schätze verwendet?
Die Arbeit erwähnt die kritische Bewertung bestehender Datierungsmethoden und die Präsentation neuer Ansätze zur genaueren Bestimmung des Alters der Funde. Die genauen Methoden werden im Text detailliert beschrieben.
- Citation du texte
- Belinda Luban (Auteur), 2015, Nagyszentmiklós und Brestovac zwischen der Spätawaren und Karolingerzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372862