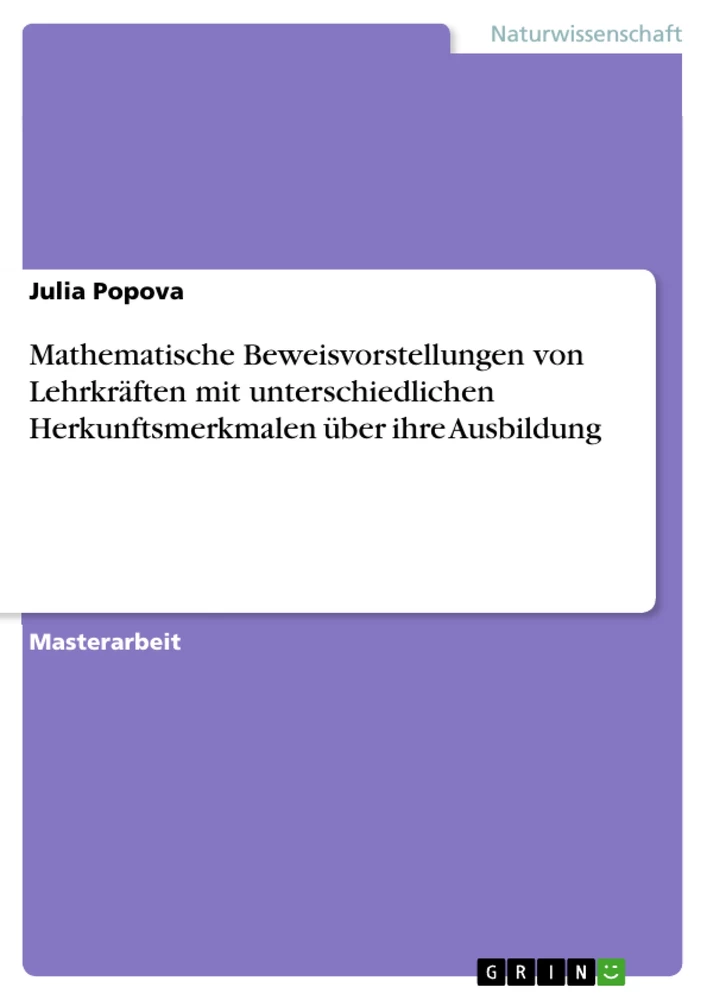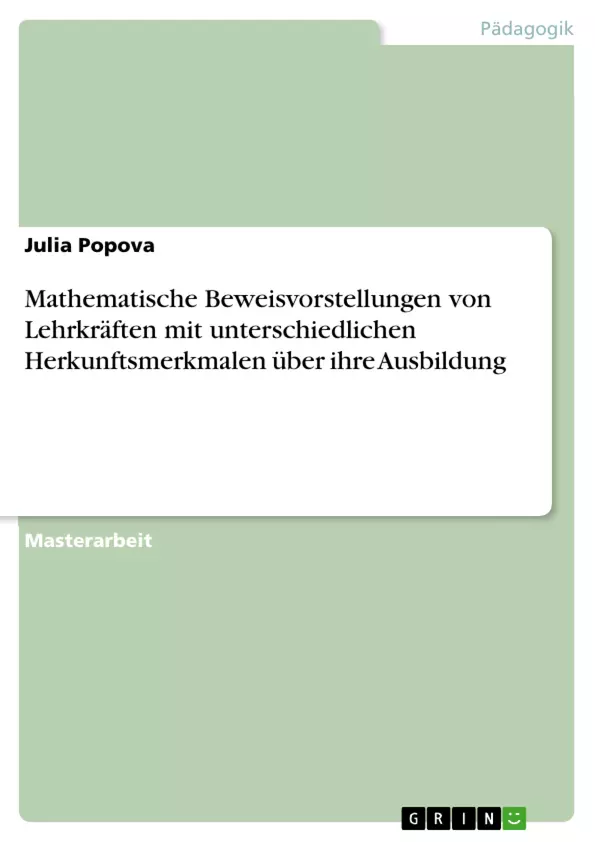Die Forschung der Masterarbeit richtet sich darauf, die sowohl fach- und schulbezogenen Vorstellungen von Lehrern über mathematische Beweise und ihre Funktionen festzuhalten, als auch ihre emotionalen beziehungsweise motivationalen Aspekte zu untersuchen.
Die Arbeit besteht aus drei Hauptbestandteilen. Auf die Einleitung folgt der erste Teil, der in die theoretischen Grundlagen des mathematischen Beweisens einführt. Dabei wird zwischen den Begriffen Beweisprodukt und –prozess unterschieden und im Weiteren hinsichtlich der schulbezogenen Beweiskompetenz mit dem Argumentieren und Begründen erweitert. Demnach werden verschiedene Beweisschema, angelehnt an empirische Befunde von Harel und Sowder, verfasst. Die Funktionen des Beweises werden ebenfalls dargestellt wobei eine von De Villiers vorgeschlagene didaktische Strategie zu ihrer Anwendung beachtet wird. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit Überlegungen zur Lehrerrolle beim Beweisen Lernen hinsichtlich der psychologischen Entwicklungsspezifik des Kindes.
Im zweiten Teil wird das methodologische Vorgehen dargestellt, welches auf den Grundlagen der qualitativen Sozialforschung von Mayring basiert. Die Datenerhebung für das Forschungsvorhaben erfolgte mit problemzentrierten, leitfadengestützen Interviews. Dieser Ansatz wurde gewählt, da in einem persönlichen Gespräch Lehrkräfte umfassender ermöglicht wird, ihre persönlichen Einstellungen, ihr Fachwissen und ihr Vorgehen zu erläutern. Zudem bieten sich Möglichkeiten für direkte Nachfragen bei Verständnisproblemen und zur Vertiefung bestimmter Aspekte. Darauf folgt der dritte Teil der Arbeit, in dem zunächst die ausgewerteten Forschungsergebnisse dargestellt werden und abschließend nach aufgetretenen Beweispraktiken der befragten Lehrpersonen analysiert und theoriegeleitet diskutiert werden. Eine Zusammenfassung mit einem Forschungsausblick schließt diese Arbeit ab.
In diesem Zusammenhang entwickelte sich das vergleichende Forschungsinteresse der Autorin zu Beweisvorstellungen der Lehrkräfte der Stadt Bremen, die über unterschiedliche Herkunftsmerkmale ihrer Lehramtsausbildung verfügen. Einerseits wird damit deutlich, dass aufgrund von Globalisierung und Migration das pädagogische Kollegium kulturell immer heterogener wird,; andererseits spiegelt das die individuellen, während der interkulturelle Bildungsbahn gebildeten Beweisvorstellungen der Autorin.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsklärungen
- Beweis und Beweisen
- Der mathematische Beweis: deduktive und argumentative Strukturen
- Beweiskompetenz in der Schule
- Argumentieren, Begründen und Beweisen
- Beweisvorstellungen und ihre Kategorien
- Funktionen von Beweisen
- Beweisfunktionen im Mathematikunterricht
- Das Beweisprinzip als Kommunikationsmittel
- Zur Lehrerrolle im Mathematikunterricht
- Begriffsklärungen
- Forschungsdesign
- Methodologische Überlegungen
- Stichprobenauswahl
- Erhebungsmethode
- Interviewleitfaden
- Analysemethode nach P. Mayring
- Transkriptionsregeln
- Auswertung
- Frau K.
- Frau P.
- Herr K.
- Frau S.
- Herr W.
- Frau P.
- Diskussion der Ergebnisse
- Empirische und anwendungsbezogene Beweisschemata: Frau K., Frau P., Herr K.
- Kommunizieren in mathematischen Inhalten als Prinzip: Frau S., Herr W., Frau P.
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Beweisverständnis von Lehrkräften in Deutschland und Russland und untersucht, wie kulturelle Unterschiede die Lehr- und Lernprozesse im Mathematikunterricht beeinflussen. Die Arbeit analysiert die Beweisvorstellungen von Lehrkräften anhand von Interviews und untersucht, wie diese ihre Unterrichtsgestaltung prägen.
- Das Beweisverständnis von Lehrkräften in Deutschland und Russland
- Kulturelle Unterschiede im Mathematikunterricht
- Die Rolle von Beweisen im Mathematikunterricht
- Die Bedeutung von Argumentation und Begründen im Mathematikunterricht
- Der Einfluss von Lehrerpersönlichkeiten auf den Mathematikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und stellt die Relevanz des Beweisverständnisses im Mathematikunterricht dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Beweisens, einschließlich der Definitionen, Funktionen und unterschiedlichen Perspektiven auf das Beweisen. Kapitel 3 beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit, einschließlich der methodischen Überlegungen, der Stichprobenauswahl, der Erhebungsmethode und der Datenanalyse. Kapitel 4 präsentiert die Auswertung der Interviews mit den Lehrkräften, wobei die Ergebnisse für jede Person separat dargestellt werden. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Analyse und beleuchtet die empirischen und anwendungsbezogenen Beweisschemata sowie die Bedeutung der Kommunikation in mathematischen Inhalten. Die Zusammenfassung und der Ausblick geben einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse der Arbeit und zeigen mögliche weitere Forschungsansätze auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Beweisverständnis, Mathematikunterricht, Kulturvergleich, Lehrkräftepersönlichkeiten, Argumentation, Begründen, Beweisfunktionen, empirische Beweisschemata, Kommunikation in mathematischen Inhalten.
- Quote paper
- Julia Popova (Author), 2016, Mathematische Beweisvorstellungen von Lehrkräften mit unterschiedlichen Herkunftsmerkmalen über ihre Ausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373100