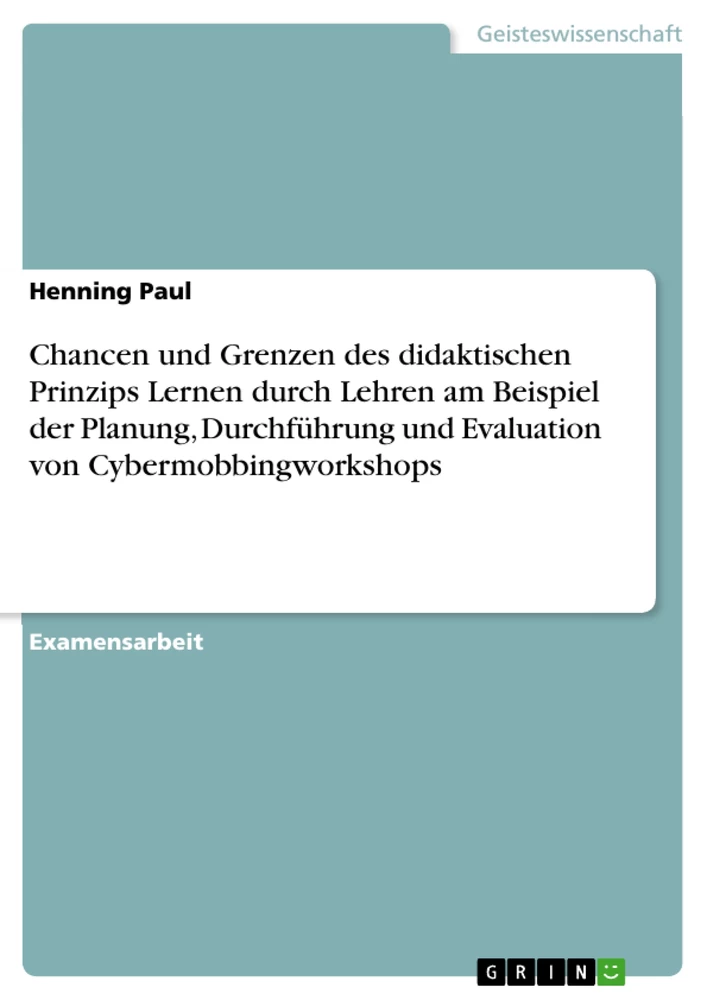Diese Arbeit stellt den Versuch dar, ein Vorgehen zu entwickeln, welches die Anforderungen auf curricularer als auch gesellschaftlicher Ebene so miteinander verbindet, dass beiden gleichsam entsprochen wird. Folgende Leitfragen sollen die Arbeit mit einem strukturellen Bezugsrahmen unterfüttern:
Wie können Schüler und Schülerinnen (SuS) eines beruflichen Gymnasiums für die Notwendigkeit der Entwicklung eines (sozialpädagogischen) Handlungskonzeptes vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Problemstellung mit sozialpädagogischer Handlungsaufforderung sensibilisiert werden? Unterstützt Lernen durch Lehren (Ldl) einen Kompetenzzuwachs bzgl. der Planung und Durchführung und Erstellung eines solchen Handlungskonzeptes? Konstituiert sich die inhaltliche Schwerpunktsetzung bzgl. der Terminologie „Cybermobbing“ im Rahmen eines doppelten pädagogischen Bezugs? Welche Auswahl an Unterrichtsmaterialien, Sozialformen, Methoden und Inhalten ist sinnvoll und notwendig und lässt sich Ldl adäquat bewerten? Ist es sinnvoll, das hier vorgelegte Vorhaben als schulinterne, obligatorische Unterrichtseinheit an der BBS Friedenstraße zu installieren?
Nachdem im ersten Abschnitt dieser Arbeit eine Legitimation des Vorgehens durch curriculare Vorgaben und die Einordnung der Kompetenzbereiche nach APVO-Lehr vorgenommen wird, ergänzt sich der hier vorangestellte Begründungszusammenhang durch die Analyse der Lerngruppen. Der zweite Abschnitt dieser Arbeit konkretisiert das Vorgehen durch einen theoretischen Bezugsrahmen, wobei (fach-)didaktische und theoretische Elemente gleichsam Beachtung finden. Dieser Abschnitt wird durch die Herausarbeitung einer Handlungsaufforderung an die Institution berufsbildende Schule geschlossen, um einen Begründungszusammenhang für die im darauffolgenden Abschnitt zu beschreibende Durchführung der Unterrichtseinheit zu konstruieren. Den Abschluss markieren eine Evaluation der Unterrichtseinheit, sowie die Herausarbeitung (möglicher) Konsequenzen, um die Chancen und Grenzen des Vorhabens fundiert darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung-Docendo doscimus?
- 1. Begründungszusammenhang
- 1.1. Legitimation durch curriculare und schulinterne Vorgaben
- 1.2 Einordnung bezüglich der Kompetenzbereiche APVO-Lehr
- 1.3. Analyse der Lerngruppe(n)
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1. Lernen durch Lehren
- 2.1.1. Definitorische Merkmale und Grundstruktur des Ldl
- 2.1.2 Ldl als innovativ-emanzipatorische Didaktik?
- 2.1.3 Ldl i.S. einer Schülerorientierung
- 2.1.4 Ldl i.S. einer [sozial-] konstruktivistischen Didaktik
- 2.1.5 Ldl und der Aufbau von Schlüsselqualifikationen (Kompetenzen)
- 2.1.6 Ldl i.S. des kooperativen Lernens
- 2.2 Cybermobbing
- 2.2.1 Definitorische Merkmale
- 2.2.2 Auswahl- und Reduktionsentscheidung im Rahmen der Cybermobbing-Workshops
- 2.2.3 Die konkrete Handlungsaufforderung an Institution Schule
- 2.1. Lernen durch Lehren
- 3. Durchführung der Unterrichtseinheit
- 4. Evaluation der Workshops
- 4.1 Auswertung der Erhebung,,berufliches Gymnasium“
- 4.2 Auswertung der Erhebung,,Berufsfachschule Sozialassistenz-Schwerpunkt Sozialpädagogik“
- 4.3 Konsequenzen der Evaluation - Chancen und Grenzen des LdL
- Abschließende Betrachtung -„Docendo doscimus!“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein didaktisches Konzept für die Gestaltung einer Unterrichtseinheit zum Thema Cybermobbing zu entwickeln und zu evaluieren. Ziel ist es, Schüler*innen für die Notwendigkeit der Entwicklung eines (sozialpädagogischen) Handlungskonzeptes im Kontext gesellschaftlicher Problemstellungen mit sozialpädagogischer Handlungsaufforderung zu sensibilisieren.
- Lernen durch Lehren (Ldl) als pädagogisches Konzept
- Cybermobbing als sozialpädagogische Handlungsaufforderung
- Entwicklung von Handlungskonzepten im Unterricht
- Integration von Theorie und Praxis in der Sozialpädagogik
- Evaluation von Unterrichtseinheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Cybermobbing in den Kontext des didaktischen Prinzips „Lernen durch Lehren“ (Ldl) und erläutert die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes vor dem Hintergrund der curricularen und schulischen Vorgaben. Kapitel 1 beleuchtet die Legitimation des Vorhabens durch die curricularen Vorgaben und die Einordnung in die Kompetenzbereiche der APVO-Lehr. Es werden die Lerngruppen analysiert, die an dem Cybermobbing-Workshop teilnehmen.
Kapitel 2 legt den theoretischen Bezugsrahmen für die Arbeit dar und erläutert das didaktische Prinzip des LdL. Es werden die definitorischen Merkmale und die Grundstruktur des LdL sowie seine Bedeutung als innovativ-emanzipatorische Didaktik und im Kontext der Schülerorientierung und des konstruktivistischen Lernens betrachtet. Darüber hinaus wird das Thema Cybermobbing im Detail behandelt, wobei die definitorischen Merkmale und die Auswahl- und Reduktionsentscheidungen im Rahmen der Cybermobbing-Workshops erläutert werden. Abschließend wird die konkrete Handlungsaufforderung an die Institution Schule im Kontext des Cybermobbings dargestellt.
Kapitel 3 beschreibt die Durchführung der Unterrichtseinheit. Kapitel 4 widmet sich der Evaluation der Workshops und der Auswertung der Erhebungsdaten aus dem beruflichen Gymnasium und der Berufsfachschule Sozialassistenz. Abschließend werden die Konsequenzen der Evaluation, die Chancen und Grenzen des LdL, erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lernen durch Lehren, Cybermobbing, Handlungskonzepte, Sozialpädagogik, curriculare Vorgaben, Kompetenzen, Evaluation, Unterrichtseinheit, Sozialassistenz, Berufliches Gymnasium.
- Citar trabajo
- Henning Paul (Autor), 2013, Chancen und Grenzen des didaktischen Prinzips Lernen durch Lehren am Beispiel der Planung, Durchführung und Evaluation von Cybermobbingworkshops, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373134