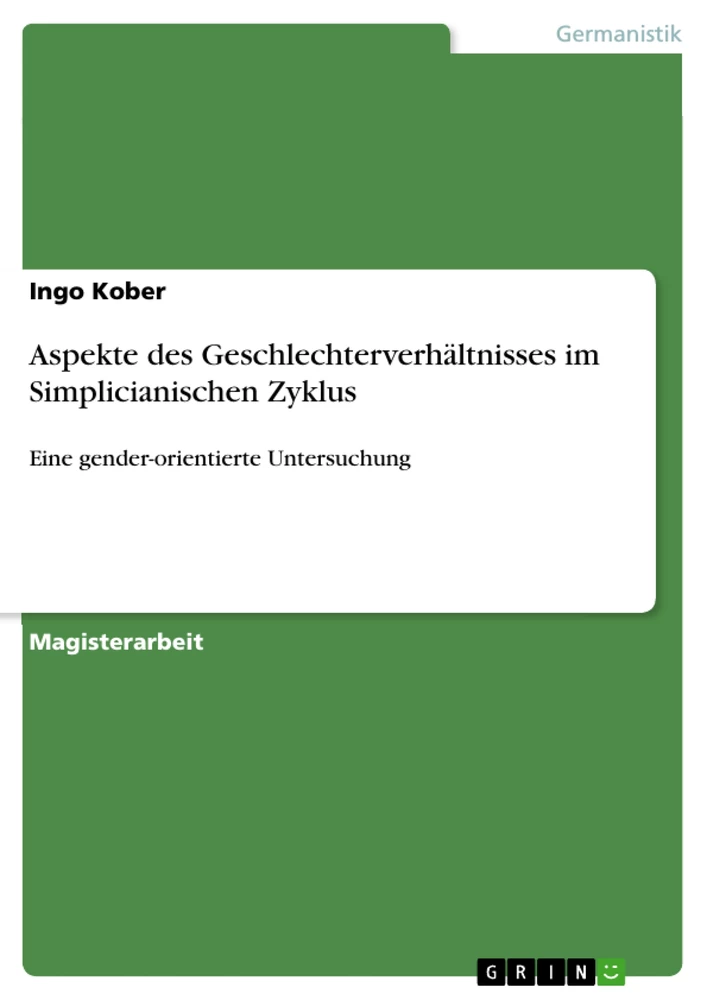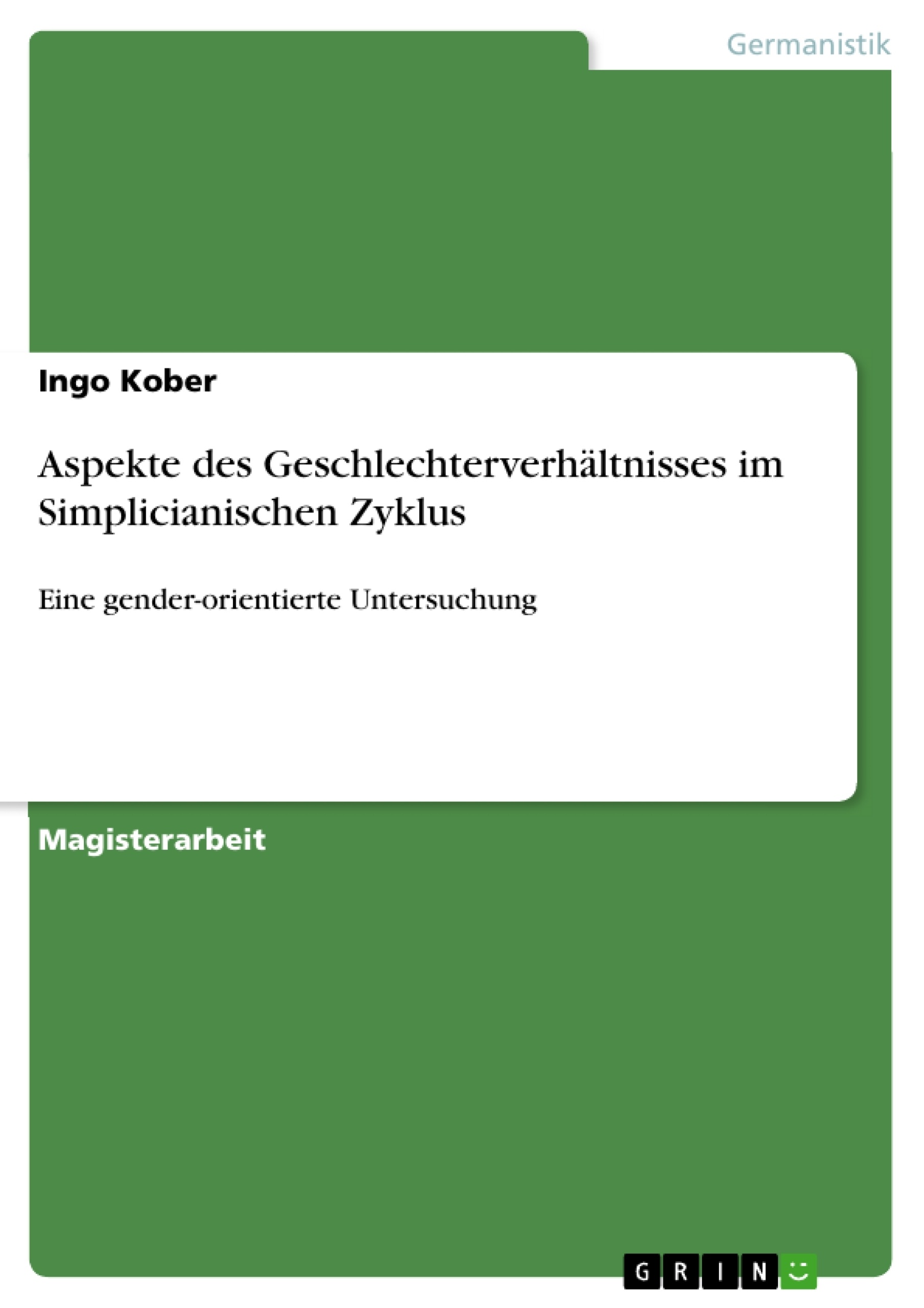Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis der Geschlechter im Spiegel des Simplicianischen Zyklus. Vordergründig steht Grimmelshausen damit in der frauenfeindlichen Tradition des literarischen Diskurses im Barock.
Die eingehendere Analyse erweist jedoch eine überraschende Doppelbödigkeit der Texte. Immer wieder wird der dort vorzufindende, scheinbar affirmative Diskurs durch die fragwürdige Moral der männlichen Figuren unterminiert. Eine Idealisierung der Frauengestalten findet gleichwohl nicht statt. Auch sie leiden an zahlreichen größeren und kleineren Schwächen. Von den Männern unterscheidet sie im Wesentlichen ihre Opferrolle. Grimmelshausen zeichnet in der durchgängigen Ambivalenz seiner Figuren ein pessimistisches Menschenbild, fern jeder Erlösung.
Das Bemühen richtet sich darauf, die geschichtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Diskurse zu ermitteln, die das Verhältnis, genauer die Verhältnisse, der Geschlechter, teils performativ, erzeugen, sie regeln und beschreiben. So groß ist die Strahlkraft der Namen Simplicissimus und Courasche, dass andere Figuren, die das Werk Grimmelshausens bevölkern, daneben blass geblieben sind. Wer kennt schon den namenlosen Kaufmann, dem ein fahrender Schüler ein Vogelnest verschafft, dessen Besitz den Träger unsichtbar macht, wer die Leiherin, deren Geldgier sie schließlich auf den Scheiterhaufen bringt, von den vielen anderen, Bürgern, Bauern, Landfrauen, Mägden, Offizieren, marodierenden Soldaten und Huren zu schweigen? Und doch nehmen all diese Gestalten einen wichtigen Platz im Simplicianischen Zyklus ein und lassen ihn zu einem bunten Reigen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Zur Methode
- 2. Erzählperspektiven
- II. Interpretation des Geschlechts
- 1. Namen
- a. Der Name als Signal
- b. Eugenia, Esther und der Kaufmann. Entlarvender Zynismus
- c. Libuschka, Janco und Courasche. Scheitern, Flucht und Zwang
- d. Spring-ins-Felt. Die korrosive Macht der Lächerlichkeit
- e. Simplicius Simplicissimus. Schande über die Mutter
- f. Rick su mir mein Hertz! Der Kosename als Entpersönlichung
- g. Margretha - Gred – Secret. Eine verräterische Verwechslung
- h. Schimpfnamen
- 2. Die Frau, der unvollkommene Mann
- 3. Kleidung und Gender
- 4. Kosmetik, Hygiene und Körperpflege
- 5. „mit der Hand in Schlitz“. Der Sexus entscheidet
- 6. Hermaphroditen
- 1. Namen
- III. Frauentypen
- 1. Die Adlige
- a. Bildung
- b. Tätigkeiten
- 2. Die Bürgerliche
- a. Bildung
- b. Tätigkeiten
- 3. Bäuerinnen und Mägde
- 4. Die Dirne
- 5. Die Soldatenfrau
- 1. Die Adlige
- IV. Frauenrollen
- 1. Das Objekt der Begierde
- 2. Die Ehefrau
- a. Ehefrauen und ihre Männer
- b. Courasche als Ehefrau
- 3. Mutter und Kind
- 4. Die Hexe
- V. Erotik und Sexualität
- 1. Erotik im Simplicianischen Zyklus ?
- 2. Die Rede von der Sexualität
- a. Sexualität als Erzähltopos
- b. Sexualität als Figurenrede
- 3. Gelebte Sexualität
- a. Voreheliche Sexualität. Der Kampf um das Kränzlein
- b. Sexualität in der Ehe
- c. Der Ehebruch
- d. Sexualität und Gewalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Geschlechterverhältnis im Simplicianischen Zyklus von Grimmelshausen. Ziel ist es, die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in den Romanen und Episoden zu analysieren und ihren kulturellen Kontext in der frühen Neuzeit zu beleuchten.
- Darstellung von Frauenfiguren in unterschiedlichen sozialen Schichten
- Analyse von Namensgebung und ihrer Bedeutung für die Charakterisierung
- Rollen und Erwartungen an Frauen im Kontext der „Querelle des femmes“
- Die Darstellung von Erotik und Sexualität im Zyklus
- Verwendung narrativer Verfahren zur Konstruktion von Geschlecht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Untersuchung des Geschlechterverhältnisses im Simplicianischen Zyklus. Sie hebt die Bedeutung des Themas im Kontext der „Querelle des femmes“ hervor und betont die bisherige Forschungslücke einer umfassenden Analyse dieses Aspekts in Grimmelshausens Werk. Die Einleitung legt die Methodik der gender-orientierten Literaturwissenschaft fest, die sowohl literaturwissenschaftliche als auch geschichtliche und gesellschaftliche Diskurse berücksichtigt, ohne sich auf bloße biologische Aspekte zu reduzieren.
II. Interpretation des Geschlechts: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Geschlecht anhand verschiedener Aspekte. Die Namensgebung wird untersucht, um aufzuzeigen, wie Namen die soziale Stellung und die Rolle der Figuren im Zyklus widerspiegeln und ihre Identität konstruieren. Die Analyse untersucht verschiedene Beispiele, von den bedeutungsvollen Namen der Hauptfiguren bis hin zu Schimpfworten und Spitznamen. Es wird weiterhin die Darstellung von Kleidung, Kosmetik, Körperpflege und sexueller Identität erörtert, um ein umfassendes Bild der Geschlechterrollen im Werk Grimmelshausens zu zeichnen. Die Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Darstellung des Geschlechts als soziales Konstrukt und den verschiedenen Strategien, mit denen dieses in den Texten konstruiert wird.
III. Frauentypen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse verschiedener Frauentypen im Simplicianischen Zyklus, von adligen Frauen bis hin zu Bäuerinnen, Mägden und Prostituierten. Für jeden Typus werden Bildung, Tätigkeiten und soziale Rolle im Kontext der jeweiligen Zeit untersucht. Die Analyse beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Frauentypen und untersucht, wie diese in der Erzählung präsentiert werden, um die vielschichtige Realität weiblicher Lebenserfahrungen im 17. Jahrhundert abzubilden.
IV. Frauenrollen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rollen, die Frauen im Simplicianischen Zyklus einnehmen. Es untersucht die Frau als Objekt der Begierde, als Ehefrau (mit Unterkapiteln zu Ehefrauen und ihren Männern sowie Courasche als Beispiel), als Mutter und als Hexe. Die Analyse konzentriert sich auf die jeweiligen Erwartungen und Konventionen, die mit diesen Rollen verbunden sind, und die Art und Weise, wie diese im Werk Grimmelshausens dargestellt werden. Der Fokus liegt darauf, die komplexen und vielschichtigen Rollen von Frauen im Kontext der Zeit zu erforschen.
V. Erotik und Sexualität: Das Kapitel analysiert die Darstellung von Erotik und Sexualität im Simplicianischen Zyklus. Es untersucht die Erotik als erzählerisches Mittel und als Thema der Figurenrede, analysiert die gelebte Sexualität sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ehe sowie die Darstellung von Ehebruch und Gewalt im Zusammenhang mit Sexualität. Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedlichen Aspekte sexueller Erfahrungen und deren kulturellen Kontext, um einen umfassenden Einblick in die Sichtweise von Grimmelshausen auf diese Themen zu geben.
Schlüsselwörter
Simplicissimus, Courasche, Grimmelshausen, Geschlechterverhältnis, Frauenrollen, „Querelle des femmes“, frühe Neuzeit, Literaturanalyse, Gender Studies, Weiblichkeit, Männlichkeit, Narrative Verfahren, Soziale Rollen, Erotik, Sexualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Geschlechterverhältnis im Simplicianischen Zyklus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Geschlechterverhältnis im Simplicianischen Zyklus von Grimmelshausen. Sie untersucht die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in den Romanen und Episoden und beleuchtet ihren kulturellen Kontext in der frühen Neuzeit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Frauenfiguren in verschiedenen sozialen Schichten, die Analyse der Namensgebung und ihrer Bedeutung für die Charakterisierung, die Rollen und Erwartungen an Frauen im Kontext der „Querelle des femmes“, die Darstellung von Erotik und Sexualität im Zyklus und die Verwendung narrativer Verfahren zur Konstruktion von Geschlecht.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine gender-orientierte literaturwissenschaftliche Methodik, die literaturwissenschaftliche, geschichtliche und gesellschaftliche Diskurse berücksichtigt, ohne sich auf bloße biologische Aspekte zu reduzieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Interpretation des Geschlechts, Frauentypen, Frauenrollen und Erotik und Sexualität. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Darstellung von Geschlecht und Geschlechterrollen im Simplicianischen Zyklus.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, begründet die Untersuchung des Geschlechterverhältnisses im Simplicianischen Zyklus und hebt die Bedeutung des Themas im Kontext der „Querelle des femmes“ hervor. Sie legt die Methodik der Arbeit fest.
Was wird im Kapitel „Interpretation des Geschlechts“ untersucht?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Geschlecht anhand von Namensgebung, Kleidung, Kosmetik, Körperpflege und sexueller Identität. Es untersucht, wie Geschlecht als soziales Konstrukt dargestellt wird.
Worauf konzentriert sich das Kapitel „Frauentypen“?
Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse verschiedener Frauentypen im Zyklus (Adlige, Bürgerliche, Bäuerinnen, Mägde, Dirnen, Soldatenfrauen), untersucht ihre Bildung, Tätigkeiten und soziale Rollen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels „Frauenrollen“?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rollen von Frauen als Objekt der Begierde, Ehefrau, Mutter und Hexe, untersucht die damit verbundenen Erwartungen und Konventionen.
Wie wird Erotik und Sexualität im Zyklus dargestellt (Kapitel V)?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Erotik und Sexualität als erzählerisches Mittel und Thema der Figurenrede, untersucht die gelebte Sexualität (vorehelich, in der Ehe, Ehebruch), und den Zusammenhang von Sexualität und Gewalt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Simplicissimus, Courasche, Grimmelshausen, Geschlechterverhältnis, Frauenrollen, „Querelle des femmes“, frühe Neuzeit, Literaturanalyse, Gender Studies, Weiblichkeit, Männlichkeit, Narrative Verfahren, Soziale Rollen, Erotik, Sexualität.
Welche konkreten Beispiele werden im Text genannt?
Der Text nennt zahlreiche Beispiele, darunter die Analyse von Namen wie Eugenia, Esther, Libuschka, Janco, Courasche und Simplicius Simplicissimus, um die Konstruktion von Geschlecht und sozialen Rollen zu veranschaulichen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Aspekte und Ergebnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler*innen, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Literatur der frühen Neuzeit, Gender Studies und der Darstellung von Frauen in der Literatur auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Ingo Kober (Autor), 2011, Aspekte des Geschlechterverhältnisses im Simplicianischen Zyklus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373544