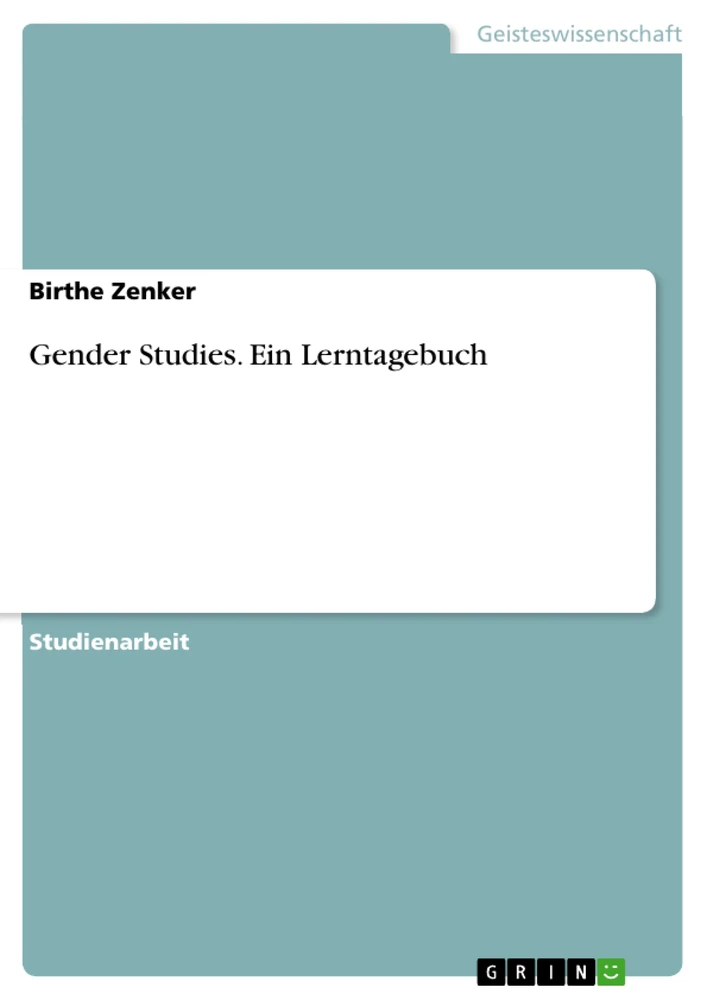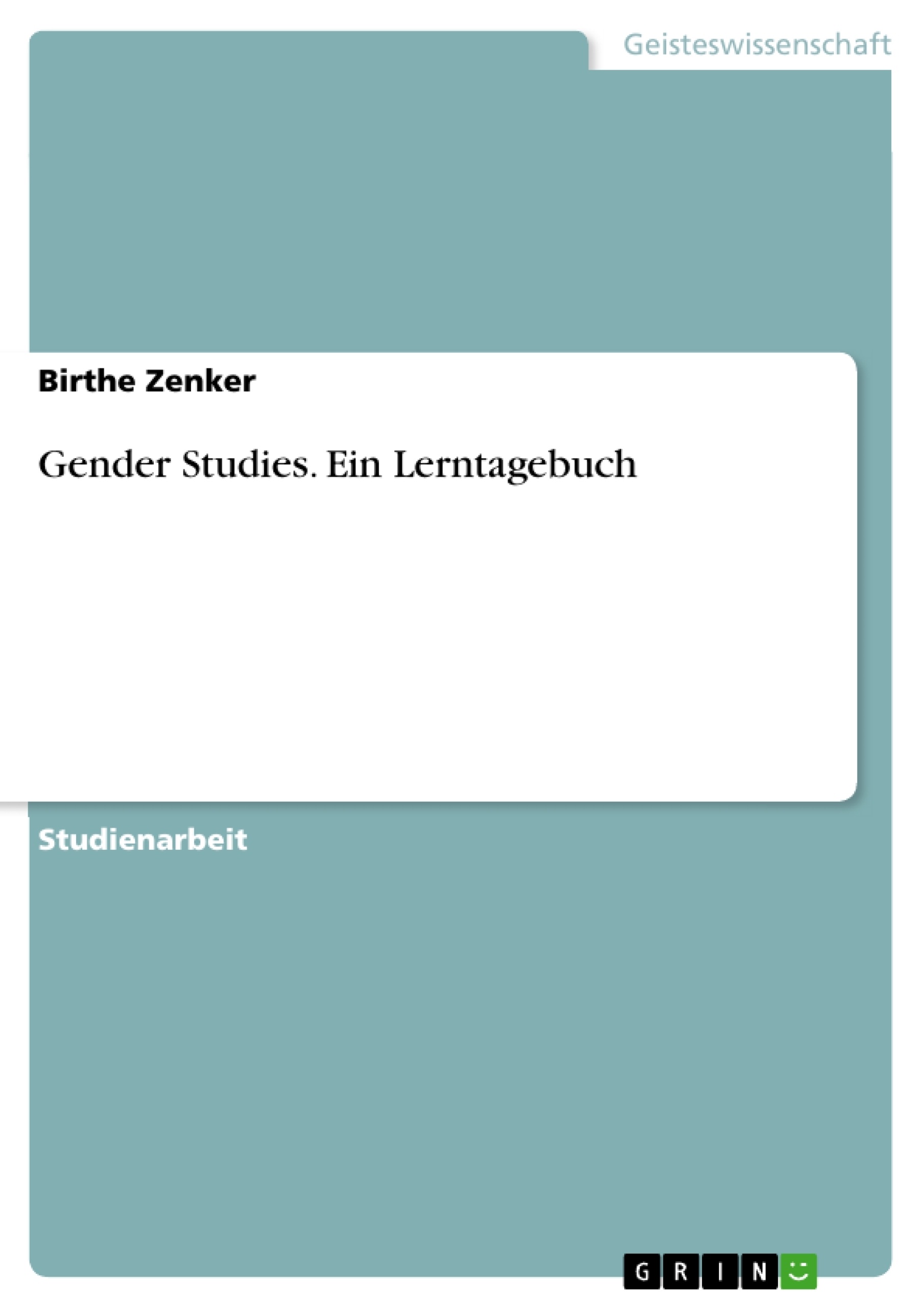Als Begrifflichkeit wurde "gender" erstmals in der Medizin in der Forschung mit Intersexuellen in den 1960er Jahren verwendet, um die Annahme zu verdeutlichen, dass die Sozialisation der Individuen für die Geschlechterzugehörigkeit bzw. Geschlechtsidentität verantwortlich ist. So wurde das soziale Geschlecht (gender) im weiteren Verlauf als unabhängig vom biologischen Geschlecht (sex) betrachtet.
In den 70er Jahren wurde der englische Begriff gender im feministischen Sprachgebrauch als Analysekategorie aufgenommen, um die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialen Geschlecht zu betonen und so einen Ansatz zu entwickeln, der die Veränderbarkeit von Geschlecht in den Blickpunkt rückt: Geschlechterrollen sind kein biologisches Phänomen, sondern stellen soziale Zuschreibungen dar.
Sie werden in sozialen Interaktionen und symbolischen Ordnungen konstruiert und sind damit veränderbar. Mit gender werden scheinbare geschlechtsspezifische Fähigkeiten, Zuständigkeiten und Identitäten in Frage gestellt und kritisiert – danach gibt es keine homogene Gruppe von "Frauen" oder "Männern" bzw. keine Definition dafür, was es heißt männlich oder weiblich zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Situation von Frauen in der Gesellschaft (Studienergebnisse)
- Was bedeutet es, Junge oder Mädchen, Mann oder Frau zu sein? (Judith Butler)
- Kulturelle Gendermuster in Buch und Bild
- Genderkompetenz in der sozialen Arbeit
- Was ist Gender Mainstreaming?
- Schärfen oder trüben mediale Bilder von Körpern und Sexualität den Blick auf das Sexuelle?
- Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen (Steffens)
- Respekt und Zumutung bei der Begegnung von Schwulen/Lesben und Muslimen
- Der neue Antifeminismus / Relativierung von Gewalt gegen Frauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Themenfeld Genderstudies und untersucht, wie Gender in verschiedenen Lebensbereichen konstruiert und erlebt wird. Die Arbeit analysiert die gesellschaftliche Situation von Frauen, die Bedeutung von Genderrollen, die Auswirkungen medialer Bilder und die Herausforderungen von Diskriminierung.
- Die gesellschaftliche Situation von Frauen und die Darstellung von Gender in Medien
- Die Konstruktion von Genderrollen und die Bedeutung von Genderkompetenz in der Sozialen Arbeit
- Die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen
- Die Rolle von Gender Mainstreaming im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in den Begriff Gender und beleuchtet die verschiedenen Facetten des Themas. Das zweite Kapitel fokussiert sich auf die Situation von Frauen in der Gesellschaft und analysiert relevante Studienergebnisse. Das dritte Kapitel widmet sich der philosophischen Perspektive auf Gender und setzt sich mit Judith Butlers Werk auseinander. Das vierte Kapitel untersucht die Darstellung von Gender in kulturellen Kontexten, insbesondere in Buch und Bild. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Thema Genderkompetenz in der sozialen Arbeit und beleuchtet die Bedeutung einer gendersensiblen Arbeitsweise. Das sechste Kapitel definiert den Begriff Gender Mainstreaming und erläutert seine Relevanz für gesellschaftliche Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Gender, Geschlecht, Geschlechterrollen, Geschlechterverhältnis, Frauen, Männer, Diskriminierung, Gender Mainstreaming, Sozialisation, Medien, Kultur, Identität, Sozialarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „sex“ und „gender“?
„Sex“ bezeichnet das biologische Geschlecht, während „Gender“ das soziale Geschlecht beschreibt, das durch Sozialisation und gesellschaftliche Zuschreibungen konstruiert wird.
Was bedeutet Gender Mainstreaming?
Es ist eine Strategie, bei der die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern bei allen gesellschaftlichen Vorhaben berücksichtigt werden.
Welche Rolle spielt Judith Butler in den Gender Studies?
Butler ist eine zentrale Theoretikerin, die die Veränderbarkeit von Geschlechtsidentitäten betont und zeigt, wie diese in sozialen Interaktionen konstruiert werden.
Was versteht man unter Genderkompetenz in der sozialen Arbeit?
Es bezeichnet die Fähigkeit, Geschlechteraspekte in der pädagogischen Arbeit zu erkennen und diskriminierungsfreie Unterstützung für alle Geschlechter anzubieten.
Wie beeinflussen Medien unser Bild von Körper und Sexualität?
Mediale Bilder können den Blick auf das Sexuelle schärfen oder trüben, indem sie oft stereotype oder idealisierte Körperbilder vermitteln.
- Quote paper
- Birthe Zenker (Author), 2016, Gender Studies. Ein Lerntagebuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374189