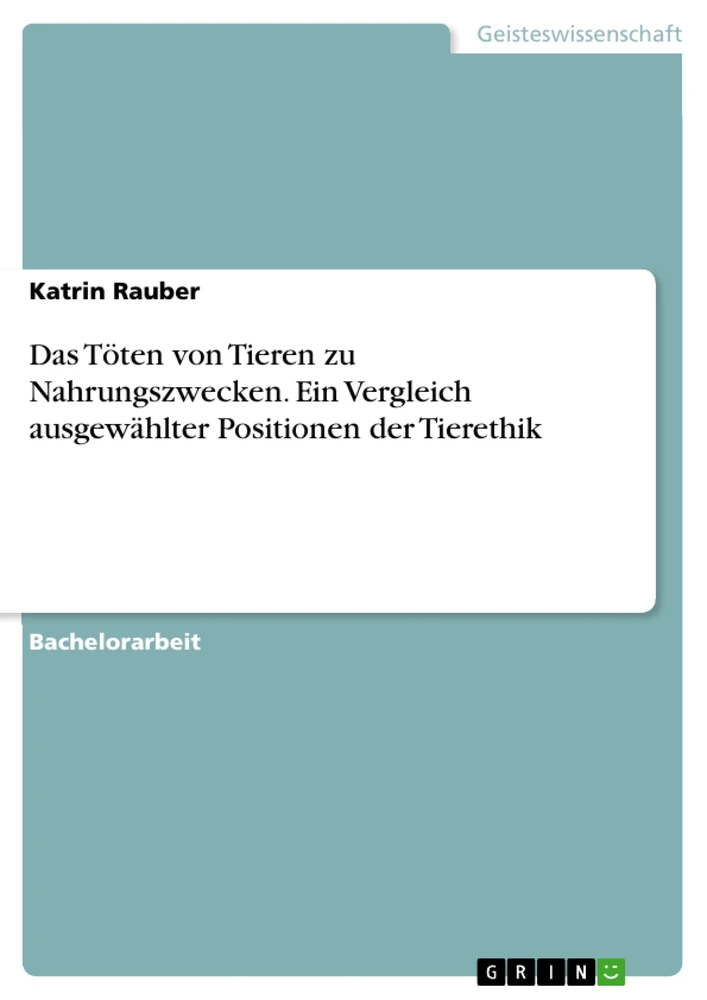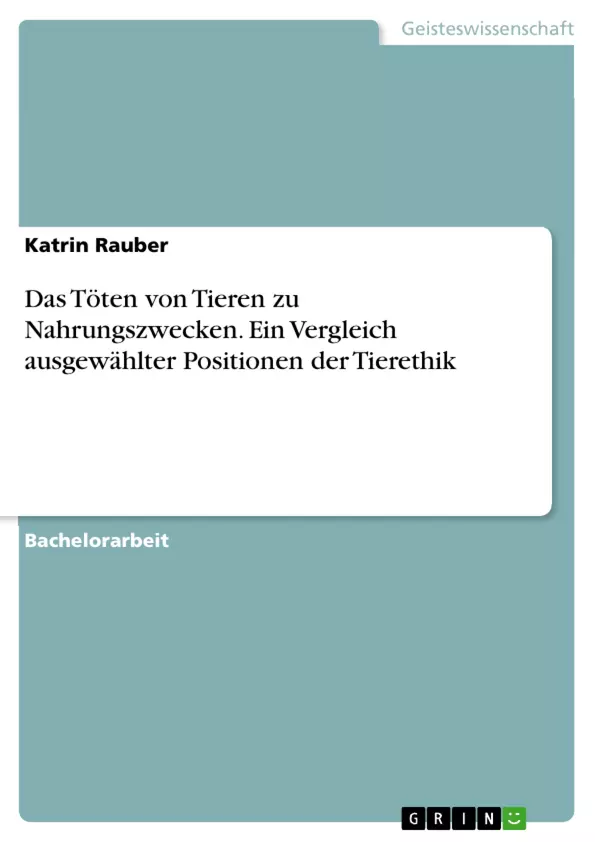Tiere sind in unserer Gesellschaft ebenso allgegenwärtig wie selbstverständlich. Ob man sie dabei als Nahrungsquelle, Haustier oder Schuhsohle betrachtet, differiert jedoch erheblich. Schon seit Urzeiten machen sich Menschen die Tiere zu nutzen, der Schutz derselben scheint jedoch für viele immer wichtiger zu werden. Dieser Entwicklung im Denken der Menschen wird auch die Politik gerecht, indem 2002 der Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen und somit zum Staatsziel erklärt wird.
Eine Reihe von bedeutenden Neuerungen tritt dann mit der Reform des Tierschutzgesetzes 2013 in Kraft, wobei unter anderem Bestimmungen zur Nutztierhaltung novelliert wurden. Durch die Gesetzeslage sind Tiere dem Menschen jedoch weder gleichgestellt, noch ist deren Nutzung verboten. Der Boom des Vegetarismus beweist allerdings, dass insbesondere die Nutzung der Tiere zu Nahrungszwecken immer mehr in Kritik gerät. Die Gruppe der moralischen Vegetariern, welche mit 60% die größte Gruppe innerhalb der Vegetarier selbst darstellt, lehnt Fleisch grundsätzlich ab, da sie es als unmoralisch ansehen, dass Tiere für ihren Genuss gequält und getötet werden.
Die bis heute andauernde Diskussion über die moralisch angemessene Behandlung von Tieren wurde maßgeblich von Peter Singer angestoßen. In seinem Buch „Practical Ethics“ (1979) beschäftigt er sich unter anderem mit der Tierethik. Diese ist von besonderer Bedeutung, da sie sich einerseits als Teilgebiet der angewandten Ethik mit einer Thematik befasst, mit der man tagtäglich konfrontiert ist. Andererseits können durch die Frage der Tiere Moraltheorien explizit in den Blick genommen und Grenzen einer Position aufgezeigt werden. Diese Arbeit ersucht, angelehnt an eine bisher immer aktuelle Debatte, zu erörtern, ob das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken zu rechtfertigen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Utilitarismus Peter Singers
- 2.1 Die Grundlage des Utilitarismus: Nützlichkeit als Moralprinzip
- 2.2 Die Begründung von Tierrechten
- 2.3 Kritik an dem utilitaristischen Ansatz
- 3. Tom Regan und die Theorie der Tierrechte
- 3.1 Der inhärente Wert des Lebens als moralische Grundkonzeption
- 3.2 Die Ausweitung des Konzeptes auf Tiere
- 3.3 Einwände gegen Regans theoretischen Ansatz
- 4. Immanuel Kants Vernunftmoral
- 4.1 Die Autonomie als Quelle der Moral
- 4.2 Die Aufstellung indirekter Argumente für Tierrechte
- 4.3 Kritik an der Moralphilosophie Kants
- 5. Anwendung der theoretischen Konzepte
- 5.1 Das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken aus der Perspektive Singers
- 5.2 Das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken aus der Perspektive Regans
- 5.3 Das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken aus der Perspektive Kants
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die ethische Rechtfertigung des Tötens von Tieren zu Nahrungszwecken. Die Arbeit analysiert verschiedene Positionen der Tierethik, insbesondere den Utilitarismus Peter Singers, die Tierrechtetheorie Tom Regans und die Vernunftmoral Immanuel Kants. Ziel ist es, die zentralen Prinzipien dieser Positionen zu erläutern und ihre jeweiligen Implikationen für den Umgang mit Tieren zu beleuchten.
- Der Utilitarismus und seine Anwendung auf die Frage der Tierrechte
- Die Tierrechtetheorie und ihre Kritik am Utilitarismus
- Kants Moralphilosophie und ihre indirekten Argumente für Tierrechte
- Die Anwendung der Theorien auf das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken
- Die ethischen Grenzen und Herausforderungen der verschiedenen Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Aktualität des Themas "Töten von Tieren zu Nahrungszwecken" heraus und skizziert den historischen Kontext der Debatte. Sie führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein und erläutert die Vorgehensweise.
- Kapitel 2: Der Utilitarismus Peter Singers
Dieses Kapitel behandelt die Grundlage des Utilitarismus, ein moralisches Prinzip, das Handlungen an ihren Folgen bewertet. Singers utilitaristische Position wird vorgestellt und ihre Implikationen für Tierrechte diskutiert. Zudem werden kritische Einwände gegen den utilitaristischen Ansatz erörtert.
- Kapitel 3: Tom Regan und die Theorie der Tierrechte
Regans Tierrechtetheorie wird in diesem Kapitel vorgestellt, die den inhärenten Wert des Lebens als Grundlage für moralische Rechte sieht. Die Ausweitung dieses Konzepts auf Tiere und die Kritik am theoretischen Ansatz Regans werden untersucht.
- Kapitel 4: Immanuel Kants Vernunftmoral
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Kants Vernunftmoral, die die Autonomie als Quelle der Moral sieht. Kants indirekte Argumente für Tierrechte und kritische Einwände gegen seine Moralphilosophie werden erörtert.
- Kapitel 5: Anwendung der theoretischen Konzepte
Die im ersten Teil vorgestellten Theorien werden in diesem Kapitel auf den konkreten Anwendungsfall des Tötens von Tieren zu Nahrungszwecken angewendet. Die Implikationen der verschiedenen Positionen für diese Praxis werden diskutiert und die ethischen Herausforderungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der Tierethik, insbesondere die Frage nach dem moralischen Status von Tieren und der Rechtfertigung des Tötens von Tieren zu Nahrungszwecken. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen: Utilitarismus, Tierrechte, inhärenter Wert des Lebens, Autonomie, Vernunftmoral, deontologische Ethik, Konsequentialismus, Nutztierhaltung, moralische Vegetarier.
Häufig gestellte Fragen
Wie begründet Peter Singer Tierrechte utilitaristisch?
Singer nutzt das Prinzip der Nützlichkeit und Leidensfähigkeit: Da Tiere Schmerz empfinden können, müssen ihre Interessen moralisch berücksichtigt werden.
Was ist Tom Regans Theorie der Tierrechte?
Regan argumentiert mit dem "inhärenten Wert des Lebens". Er kritisiert den Utilitarismus und fordert feste Rechte für Tiere, unabhängig von ihrem Nutzen für Menschen.
Wie steht Immanuel Kant zum Thema Tierrechte?
Kant sieht Moral an Vernunft und Autonomie gebunden, die Tieren fehlt. Er liefert jedoch indirekte Argumente: Grausamkeit gegen Tiere schade der menschlichen Moralität.
Ist das Töten von Tieren zur Nahrung laut Singer vertretbar?
Die Arbeit analysiert Singers Perspektive, wonach die industrielle Nutztierhaltung aufgrund des massiven Leids meist nicht zu rechtfertigen ist.
Was sind "moralische Vegetarier"?
Dies ist die größte Gruppe unter den Vegetariern (ca. 60 %), die Fleischkonsum ablehnen, weil sie das Quälen und Töten von Tieren für unmoralisch halten.
- Citation du texte
- Katrin Rauber (Auteur), 2017, Das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken. Ein Vergleich ausgewählter Positionen der Tierethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374761