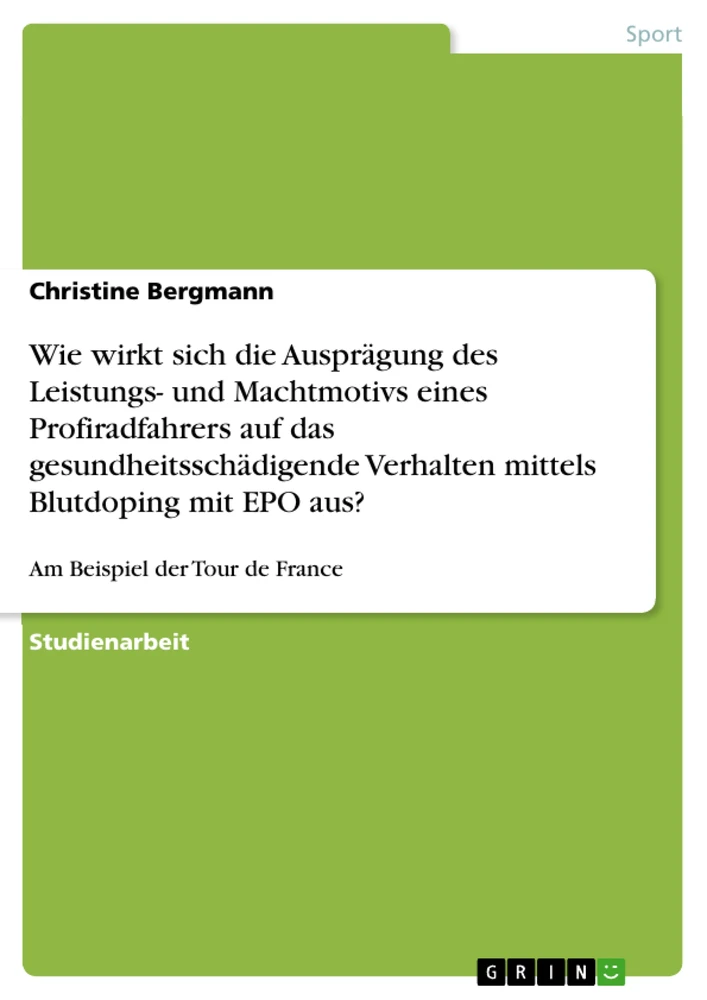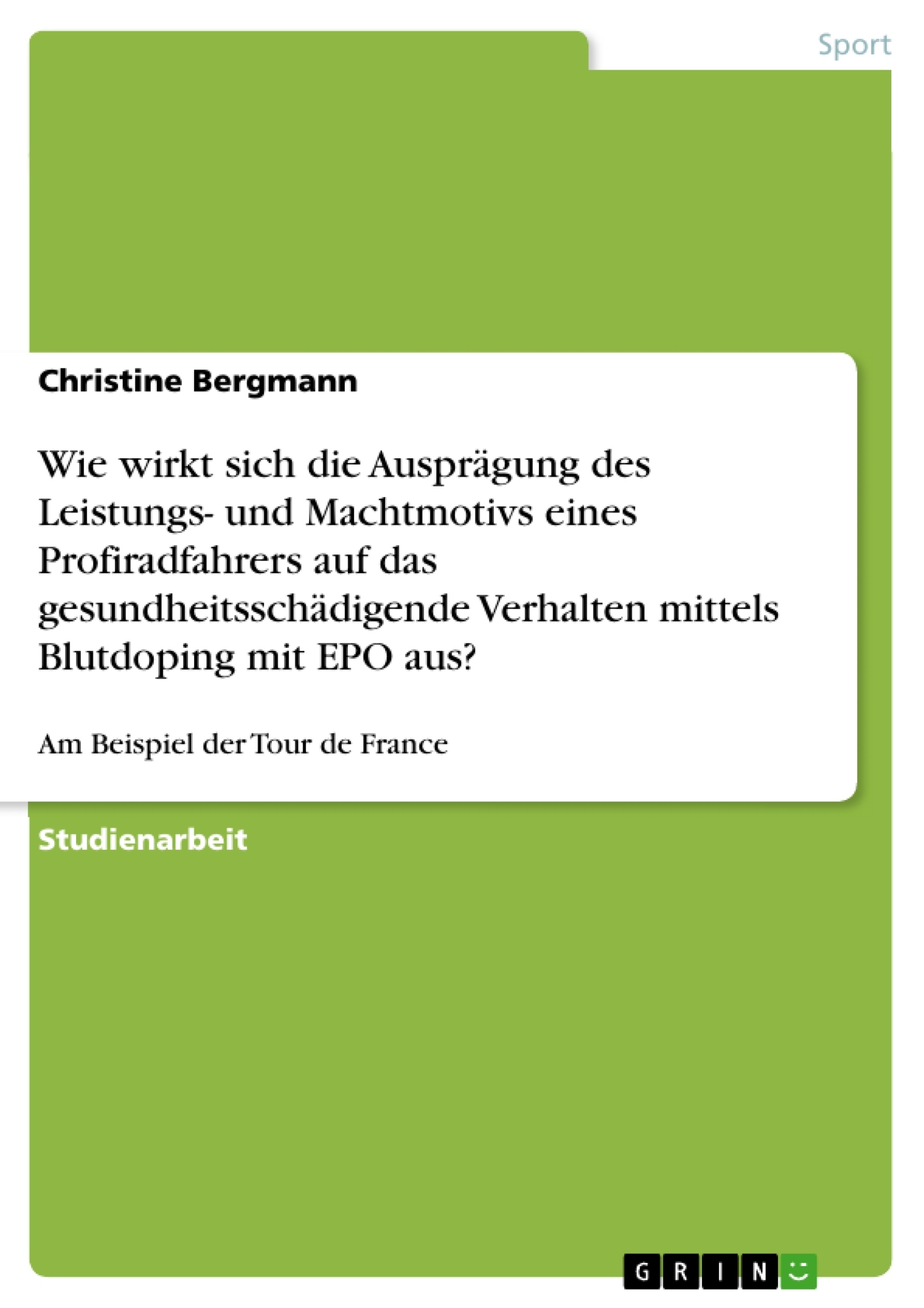Doping ist ein immer wiederkehrendes und ständig aktuelles Thema in den Medien und zieht sich durch sämtliche Sportarten mit verschiedenen Methoden. Vor allem die Profifahrer der Tour de France, der Königsklasse des Radsports, geraten immer wieder in den Fokus des Themas Blutdoping mit EPO. Ein Expertenteam der WADA stufte 2008 Straßen- und Bahnradfahren als Hochrisikosportarten für Doping ein. Ermittlerteams aus Frankreich, Spanien und Italien deckten ganze Doping-Netzwerke auf. Aufgrund von Blutdoping mit EPO wurde 2006 das Starterfeld der Tour massiv ausgedünnt. Von 1998 bis 2005 gibt es keinen Tour-Sieger mehr, da Lance Armstrongs sieben Titel aberkannt wurden und die nachrückenden Fahrer allesamt in Doping-Affairen mit Blutdoping/EPO verwickelt waren. Blut-Doping mit EPO wird im Profiradsport flächendeckend betrieben und schädigt die Gesundheit massiv. Das Bundesverwaltungsamt bestätigt erhebliche Gesundheitsschäden aufgrund von Doping, selbst über Generationen hinaus. Die Kosten, die durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs entstehen, beliefen sich im Jahr 2008 jeweils auf 2.542.800 €, Tendenz steigend. Hierunter fallen auch Folgeschäden durch Doping, die an der Solidargemeinschaft hängenbleiben, denn diese werden nicht aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegrenzt.
Profiradfahrer der Tour de France sind männlichen Geschlechts. Das Anforderungsprofil umfasst 8,5 Monate im Jahr Wettkampfsaison, in denen sie durchschnittlich 100-120 Wettkampftage abarbeiten. Dabei legen sie Distanzen bis zu 300 km am Tag zurück, was ca. 5-7 Stunden im Sattel entspricht , über bis zu drei Wochen Dauer täglich bei den großen Rundfahrten. Die Tour de France zieht sich ebenfalls über drei Wochen mit zwei Ruhetagen. 2016 umfasste die 103. Tour insgesamt 21 Etappen über eine Gesamtlänge von 3.519 km. In einer Bergetappe durch die Dolomiten oder Alpen sammeln die Profis bis zu 6.000 Höhenmeter. Hinzu kommt das Training von bis zu 40.000 km im Jahr.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- Motive und Doping
- Leistungs- und Machtmotiv im Profiausdauersport
- Gesundheitsgefährdung durch Doping
- 3. Untersuchungsmethode
- 4. Vorstellung der Theorien und Modelle
- 4.1 Theorien der untersuchten Motive
- 4.1.1 Leistungsmotiv
- 4.1.2 Machtmotiv
- 4.2 Blutdoping mit EPO
- 5. Untersuchung und Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 5.1 „Schneller, höher, weiter“ - Doping und das Leistungsmotiv
- 5.2 Machtspiele - Doping und das Machtmotiv
- 5.2.1 Das selbstbezogene M2-Machtmotiv
- 5.2.2 Das eigennützige M3-Machtmotiv
- 6. Diskussion - führen hohe Motive in Leistung und Macht zu Doping?
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss des Leistungs- und Machtmotivs auf das gesundheitsschädigende Verhalten mittels Blutdoping mit EPO bei Profiradfahrern der Tour de France zu untersuchen. Die Studie analysiert, ob die Ausprägung dieser Motive als Prädiktor für Dopingmissbrauch dienen kann, um präventive Maßnahmen zu entwickeln und die Gesundheit der Sportler zu schützen.
- Das Leistungs- und Machtmotiv von Profiradfahrern
- Die Rolle von Doping im Profisport, insbesondere Blutdoping mit EPO
- Die gesundheitlichen Risiken und Folgen von Doping
- Motivationspsychologische Ansätze zur Erklärung des Dopingverhaltens
- Die Möglichkeit der frühzeitigen Erkennung und Prävention von Dopingmissbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Doping im Sport, insbesondere Blutdoping mit EPO bei Profiradfahrern der Tour de France, vor und erläutert die Relevanz des Forschungsgegenstands. Das Kapitel „Forschungsstand“ beleuchtet Studien zum Dopingverhalten von Sportlern, die verschiedene Motive und Faktoren für Doping hervorheben. Der Abschnitt „Motive und Doping“ analysiert die psychologischen Aspekte des Dopingverhaltens und die Rolle von Motiven wie Leistung und Macht. Im Abschnitt „Leistungs- und Machtmotiv im Profiausdauersport“ werden die beiden Motive im Kontext des Profiradsports näher untersucht, und es wird dargelegt, wie sie zu Dopingmissbrauch beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Doping, Blutdoping, EPO, Leistungsmotiv, Machtmotiv, Motivationspsychologie, Profisport, Tour de France, Gesundheitsgefährdung und Prävention. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Motiven, Dopingverhalten und gesundheitlichen Folgen, um ein besseres Verständnis des Phänomens Doping im Sport zu gewinnen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist EPO-Doping im Radsport so gefährlich?
EPO (Erythropoetin) erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen, was das Blut verdickt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Krebs massiv steigert.
Welchen Einfluss hat das Leistungsmotiv auf Doping?
Ein extrem ausgeprägtes Leistungsmotiv („schneller, höher, weiter“) kann dazu führen, dass Sportler gesundheitliche Risiken ignorieren, um ihre Leistungsgrenzen künstlich zu verschieben.
Wie hängen Machtmotive mit Doping zusammen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen selbstbezogenen und eigennützigen Machtmotiven, die den Wunsch antreiben, Konkurrenten zu dominieren und den Status als Sieger zu sichern.
Warum wird die Tour de France als Hochrisikosportart eingestuft?
Aufgrund der extremen physischen Belastung (bis zu 3.500 km in 3 Wochen) und der historischen Aufdeckung ganzer Doping-Netzwerke gilt sie als besonders anfällig.
Wer trägt die Kosten für die Folgeschäden von Doping?
Die Kosten für die Behandlung von Langzeitschäden werden oft von der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherungen getragen, da diese nicht ausgegrenzt werden.
- Citation du texte
- Christine Bergmann (Auteur), 2017, Wie wirkt sich die Ausprägung des Leistungs- und Machtmotivs eines Profiradfahrers auf das gesundheitsschädigende Verhalten mittels Blutdoping mit EPO aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375137